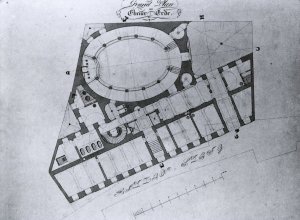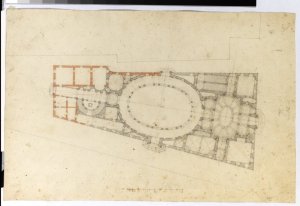Im Vergleich mit dem frühen Präsentationsentwurf
Borrominis (entstanden vor 1642), der sich noch heute bei den Bauakten im
Archiv der Universität befindet,
wird deutlich, daß auf Barrières Stich der Grundriß stark verkleinert ist, wohl
um eine graphisch ausgewogenere Verteilung von Mauerwerk und Binnenraum zu
erzielen. Das der Konstruktion zugrundeliegende Dreieck ist so verkleinert, daß
zwei seiner Ecken genau auf den inneren Korridorwänden liegen. Eine vollkommen
analoge Verkleinerung des Grundrisses zeigen mehrere Zeichnungen Borrominis in
Wien, von denen seit längerem vermutet wird, daß sie Vorarbeiten zu
Kupferstichen sind.
Dieses Faktum beweist nicht nur, daß der Kupferstich auf Borrominis
Vorzeichnung zurückgeht, sondern auch, daß die genannten Zeichnungen keine
Projektstadien wiedergeben, sondern ebenfalls im Hinblick auf die Publikation
geschaffen wurden.
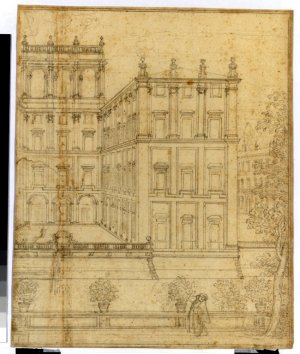 Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des
Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als
eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben
werden.
Offenbar waren Borrominis Publikationspläne noch umfangreicher als bisher
bekannt. Durch die seitenverkehrte Anlage gibt sich die Zeichnung
unmißverständlich als Stichvorlage zu erkennen. Links ist sie beschnitten, es
fehlt der Südflügel, den Borromini nicht ausgeführt hatte. Vielleicht hat
er selber kurz vor seinem Tod diesen
Teil entfernt, damit er nicht von einem anderen als eigene Erfindung ausgegeben
werden konnte.
Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des
Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als
eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben
werden.
Offenbar waren Borrominis Publikationspläne noch umfangreicher als bisher
bekannt. Durch die seitenverkehrte Anlage gibt sich die Zeichnung
unmißverständlich als Stichvorlage zu erkennen. Links ist sie beschnitten, es
fehlt der Südflügel, den Borromini nicht ausgeführt hatte. Vielleicht hat
er selber kurz vor seinem Tod diesen
Teil entfernt, damit er nicht von einem anderen als eigene Erfindung ausgegeben
werden konnte.
Bei einer vervollständigten Rekonstruktion des Blattes
wird noch deutlicher, daß das Blatt vonder Hand Barrières stammt. Die die
höfischen Figuren im Vordergrund und die feine Eleganz der perspektivischen
Anlage sprechen die gleiche Sprache wie die Stiche der Sapienza oder die
Ansichten der Villa Pamphili, die Barrière in den gleichen Jahren schuf.
Mit dem perspektivischen Schaubild war ein Modus gefunden,
der sich besonders dazu eignete, die realisierten Bauwerke Borrominis in
ästhetisch ansprechender, leicht idealisierter Gestalt wiederzugeben. Eine
ähnliche Wirkung dürften die Wachsmodelle des Architekten erzielt haben. Doch
auch dieser Modus paßte nicht ohne weiteres zu den Texten Virgilio Spadas, die
systematisch die einzelnen Bauteile und ihre Problemlösungen abhandelten. Daher
engagierte Spada für das Buch über das Oratorium einen Zeichner, der diese
Blätter anfertigte; leider fielen sie nicht so zufriedenstellend aus, das Spada
das Werk veröffentlichen konnte.
Erst in den 1720er Jahren nahm der Verleger Sebastiano Giannini die Mühe und
die Kosten auf sich, die Tafeln professionell ergänzen zu lassen.
In der Folgezeit erlitt Borrominis Projekt der Publikation
seiner Entwürfe mehrere Schicksalsschläge. Der erste Schlag traf 1662, als
Virgilio Spada starb. Mit ihm verlor Borromini nicht nur seinen Mentor, der ihn
immer wieder protegiert und bei Streitigkeiten mit den Auftraggebern in Schutz
genommen hatte, sondern auch den Autor der Texte für das geplante Buch. Als
hervorragender Kenner und Liebhaber der Architektur, der besonders die
Qualitäten Borrominis zu würdigen wußte, war er so etwas wie der „gute Geist“ in
dessen Leben gewesen und hatte immer wieder schützend die Hand über ihn
gehalten.
Glücklicherweise hatte der Architekt inzwischen einen
neuen Freund gewonnen: Fioravante Martinelli.
Dieser war zwar kein Experte in architektonischen Fragen, aber dafür in
ähnlicher Weise auf dem Gebiet der Altertumskunde profiliert. Martinelli war
gleich alt wie Borromini und in Rom in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Er
wurde Priester und machte Karriere als Sekretär und Erbe des Kardinals Orazio
Giustiniani, des Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, der wie Spada den
Oratorianern angehörte. 1636 wurde er scriptor
hebraicus an der Bibliotheca Vaticana, ein Jahr später scriptor latinus; möglicherweise war er ein getaufter Jude.
Er trat hervor als Autor des Reiseführers „Roma ricercata“ und mehrerer
topographisch-antiquarischer Abhandlungen zur römischen Kirchengeschichte. Über
die Oratorianer, deren antiquarische Interessen er teilte, dürfte er Borromini
um 1650 kennengelernt haben.
In gewisser Weise paßten Martinellis Texte besser zu
Borrominis Zeichnungen. Seine Guiden wendeten sich an ein gebildetes Publikum
und behandelten hauptsächlich historische und antiquarische Fragen, weniger die
Funktionalität der Bauwerke. Um 1660 begann Martinelli mit der Niederschrift der
Guida „Roma Ornata“, die ausführliche
Erläuterungen zu den Kunstwerken Roms enthielt. Das Manuskript gab er Borromini
zur Korrektur, und der Architekt machte viele handschriftliche Bemerkungen und
Zusätze. Das Manuskript, eine erstrangige Quelle zum römischen Barock, blieb
leider unpubliziert und wurde erst 1969 veröffentlicht.
Daneben schrieb Martinelli auch eine längere Monographie über die Sapienza, die
Illustrationen Borrominis enthalten sollte;
er fügte sie später dem Manuskript bei. Anscheinend war nun Martinelli
Borrominis Autor, mit dem zusammen der Architekt die Veröffentlichung seiner
Entwürfe in einer anpruchsvollen und ganz neuartigen Weise verwirklichen
wollte.
In den folgenden Jahren verschlechterte sich Borrominis
berufliche Situation immer mehr. Um 1665 hatte er fast alle bedeutenden
Aufträge verloren, allen voran S. Giovanni in Laterano und S. Agnese in Piazza
Navona. S. Ivo alla Sapienza und das Collegio di Propaganda Fide waren beide
weitgehend fertiggestellt. Anfang April 1665 starb Borrominis wichtigster
Freund und Mäzen, der Marchese Paolo Del Bufalo,
der auch seine antiquarischen Interessen teilte.
Infolgedessen blieb der unvollendete Chorbau von S. Andrea delle Fratte liegen.
Da Borromini unter Alexander VII. keine Änderung dieser
Lage erwarten konnte, wandte er sich in den letzten Jahren seines Lebens
verstärkt dem geplanten Stichwerk zu. Offenbar überarbeitete und variierte er
nun – wie Bernardo es schildert – viele seiner Entwürfe im Hinblick auf die
Publikation bzw. bereitete Zeichnungen als Stichvorlagen vor. Viele der Blätter
im Besitz der Albertina stammen nicht aus dem Entwurfsprozeß, sondern sind
phantasievolle Variationen bzw. enthalten Überarbeitungen, die nicht zur
Ausführung, sondern zur Veröffentlichung bestimmt waren. Dieses Faktum wird der
Borromini-Forschung erst seit einigen Jahren bewußter. Zuvor hat es zu
zahlreichen Fehldeutungen geführt; der Anteil der nicht projektbezogenen
Blätter ist noch nicht endgültig bestimmt.
Im folgenden möchte ich zeigen, wie Borrominis Lebensende
mit dem Scheitern seines letzten Projektes, der Publikation seiner Entwürfe,
verbunden ist. Um dies zu erhellen, habe ich eine chronologische Tabelle der
bekannten Fakten aus Borrominis letzten Lebenstagen angefertigt.
|
1662
|
+ Virgilio Spada
|
|
1665
|
Arbeiten an S. Ivo und der Propaganda Fide abgeschlossen
|
|
1665 Frühjahr
|
+ Marchese Paolo del Bufalo; Ende der Bautätigkeit bei S. Andrea
delle Fratte
|
|
Dezember 1666
|
Beginn der Tätigkeit Berninis bei S. Agnese in Agone, im Auftrag
von Olimpia Aldobrandini und Kardinal Azzolini
|
|
vor 6. Februar 1667
|
+ Camillo Arcucci. Borromini wird nicht wieder als Architekt des
Oratoriums eingestellt
|
|
Frühjahr?
|
Reise Borrominis in die Lombardei als Reaktion auf die Ernennung
Berninis
|
|
1667
|
Publikation von Berninis Veränderungen durch Cruyl/De Rossi und
Falda
|
|
26. Juni
|
Inthronisation Clemens’ IX. Kardinal
Azzolini wird Staatssekretär. Fortsetzung der Protektion Berninis.
|
|
1. Juli
|
Beschluß zur Ausführung des Grabmals Innozenz’ X. durch Bernini
|
|
3. Juli
|
possesso Clemens’
IX.
|
|
20./21. Juli ?
|
+ Fioravante Martinelli
|
|
22. Juli
|
St. Maria Magdalena. Seit
diesem Tag fühlt Borromini sich krank und geht nicht mehr aus dem Haus
|
|
|
Borromini übergibt seinem Notar Olimpio Ricci in Anwesenheit von 7
Zeugen ein verschlossenes Testament
|
|
24. Juli
|
Eintrag über die provisorische Beerdigung des Fioravante
Martinelli, der „repentina morte in
Suburbio Pio obiit“ (vermutlich in seiner Villa am Monte Mario)
|
|
23./24. Juli
|
Borromini geht nach S. Giovanni (in Laterano) „per pigliare il giubileo” (anläßlich der Thronbestigung Clemens’
IX)
|
|
29. Juli
|
Borromini verlangt von seinem Notar das Testament zurück und erhält
es. Dieses Testament ist verloren
|
|
30. Juli ?
|
Borromini verbrennt seine Zeichnungen
|
|
1. August
|
Besuch des Neffen Bernardo - Nachts beginnt Borromini, ein neues
Testament zu schreiben
|
|
2. August
|
Im Morgengrauen (ore 8 e mezza = 4 Uhr) verweigert sein Diener und
Gehilfe Francesco Massari ihm das Licht zum Schreiben. Daraufhin wirft sich
Borromini in seinen spadino -
Borromini diktiert sein letztes Testament zugunsten seines Neffen Bernardo,
unter der Bedingung, daß dieser eine Enkelin von Carlo Maderno heiratet.
|
|
3. August
|
Borromini stirbt abends um die 10. Stunde
|
Für Borrominis Selbstbewußtsein muß das Jahr 1667, sein
letztes Lebensjahr, besonders niederschmetternd begonnen haben. Nach dem Tod
Arcuccis wurde er nicht an das Oratorium zurückgerufen. Aber es kam noch
schlimmer: Seit kurzem hatten Donna Olimpia Aldobrandini, die Witwe Camillo
Pamphilis, und ihr Vertrauter, Kardinal Decio Azzolini, seinem Widersacher
Bernini den Bau von S. Agnese in Piazza Navona übertragen.
Dies war das erste Mal, daß Bernini ein Werk Borrominis in die Hände fiel, und
er ließ die Gelegenheit nicht aus: Ohne zu zögern veränderte er die Fassade,
entfernte den Giebel, das große Lünettenfenster, die Reliefdekoration und
setzte die schwere Attika auf; auch im Inneren nahm er tiefgreifende Änderungen
vor.
Über die psychologische Wirkung
dieser Sachlage auf Borromini gibt auch Lione Pascoli Auskunft, ohne jedoch den
Bau direkt zu nennen: „essendo certa
fabbrica, che dovea esser condotta da lui, come quegli, che fatto ne avea il
disegno, stata data a condurre al Bernini, tanto se ne accorò, e se ne
afflisse, che per divertire la fiera malinconia, ch l’opprimeva, risolvè di
fare un viaggio; e se ne andò in Lombardia”. Die Reise in die Heimat, die seinen
gekränkten Stolz wiederherstellen sollte, ist allerdings archivalisch bisher
nicht faßbar.
Pascoli zufolge kehrte mit der Rückkehr nach Rom auch die malinconia zurück, und so habe sich
Borromini wieder seinem Publikationsprojekt zugewandt: „... stava le settimane intere serrato in casa senza mai uscire, facendo
però sempre nuovi disegni di grosse fabbriche di cappriccio, e per genio. Così
s’andava egli svariando, e pasceva l’elevato suo ingegno di nuove nobili ideE,
di pellegrine invenzioni, e di vaghi, e bizzarri pensieri; ed avendone fatta
copiosa raccolta, determinò di farli tutti intagliare; perché veder sempre
potessero gli emuli, ed i posteri le maravigliose sue operazioni”. Auch wenn der Schriftsteller
hier vielleicht aus Gründen der Rhetorik übertreibt, so finden sich dennoch –
der überlieferten Verbrennung der Zeichnungen zum Trotz – Anhaltspunkte dafür,
daß Borromini immer wieder über bereits vollendete Bauten oder längst verlorene
Aufträge weiterphantasierte. Ausgearbeitete Stichvorlagen sind in seinem
Zechnungsnachlaß in der Albertina nicht mehr vorhanden; es finden sich jedoch
zahlreiche Blätter, die als Vorarbeiten angesehen werden müssen. So gehören z.
B. die idealisierten Grundrißdiagramme des Campanile und des Tiburio von S.
Andrea delle Fratte vermutlich nicht zum Bauprojekt,
und ein Grundriß von S. Agnese und dem Collegio Innocenziano (Abb.) zeigt
Überarbeitungen, von denen man ausschließen kann, daß sie im Auftrag Innozenz’
X. oder Camillo Pamphilis entstanden sind.
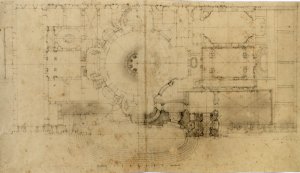 Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,
denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu
schaffen.
Borromini hatte diesen Papst als seinen persönlichen Förderer besonders verehrt
und bezeichnete sich selber als „architetto
della Santa memoria di Papa Innocentio X.o“.
In seinem Nachlaßinventar ist ein Portrait des Papstes aufgeführt.
Daß Berninis Projekt letztendlich auch scheiterte, hat Borromini nicht mehr
miterlebt.
Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,
denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu
schaffen.
Borromini hatte diesen Papst als seinen persönlichen Förderer besonders verehrt
und bezeichnete sich selber als „architetto
della Santa memoria di Papa Innocentio X.o“.
In seinem Nachlaßinventar ist ein Portrait des Papstes aufgeführt.
Daß Berninis Projekt letztendlich auch scheiterte, hat Borromini nicht mehr
miterlebt.
Über die Vorkommnisse der letzten Woche des Juli 1667 und
über die näheren Umstände von Borrominis Tod sind wir durch drei Quellen
unterrichtet: Erstens durch das Protokoll der amtlichen Vernehmung Borrominis
nach seiner Selbstverwundung,
zweitens durch den biographischen Bericht seines Neffen Bernardo, und drittens,
auf indirekte Weise, durch mehrere Urkunden in den Akten seines Notars.
Am 2. August 1667 gab Borromini dem befragenden Arzt zu
Protokoll, er sei seit dem Magdalenentag (dem 22. Juli) krank gewesen und nicht
mehr aus dem Hause gegangen, außer Samstag und Sonntag (den 23. und 24. Juli),
an welchen Tagen er zur Kirche S. Giovanni (in Laterano) gepilgert sei per pigliare il giubileo, d. h. um den
von dem neugewählten Papst Clemens IX. Rospigliosi ausgeschriebenen Jubelablaß
zu erwerben.
Von dem Nachfolger Alexanders VII. konnte der Architekt nicht viel erhoffen,
zumal Kardinal Azzolini nun Staatssekretär wurde.
Es dürfte sich schnell herausgestellt haben, daß Berninis dominierende Rolle
als Kunstintendant nicht geschmälert wurde; im Gegenteil, schon bald erhielt er
den Auftrag zu den Figuren der Engelsbrücke.
Diesen für seine seelische Verfassung sicher nicht
unwesentlichen Sachverhalt erwähnte Borromini bei der Befragung nicht.
Ebensowenig teilte er mit, daß er an eben jenem 22. Juli, dem Tag seiner
Erkrankung, seinem Notar Olimpio Ricci ein verschlossenes Testament übergeben
hatte.
Diese Tatsache verwundert nicht wenig, denn gewöhnlich verfaßt jemand seinen
letzten Willen nicht gleich am ersten Krankheitstag.
Borromini verschwieg auch das entscheidende Ereignis, das
ihm - wie ich meine - den letzten Lebenswillen nahm, nämlich den Tod seines
Freundes Fioravante Martinelli. Er starb morte
repentina, also plötzlich und unerwartet, in suburbio Pio, also außerhalb der Stadtmauern, nördlich des Borgo
Pio, vermutlich in oder bei seinem villino
am Monte Mario, unweit der Villa Madama.
Das Datum ist nicht ganz sicher: Alle Wissenschaftler, denen die zeitliche Nähe
dieses Ereignisses zu Borrominis Tod aufgefallen ist, geben den 24. Juli an,
übersehen aber dabei, daß unter diesem Datum Martinellis provisorische
Bestattung in der Kirche S. Michele Arcangelo eingetragen ist;
er kann ohne weiteres ein paar Tage eher gestorben sein.
Mir erscheint die auffallende zeitliche Koinzidenz
zwischen Borrominis plötzlicher Erkrankung und Martinellis Ableben viel zu
unwahrscheinlich, um vollkommen zufällig zu sein. Ich möchte daher vermuten,
daß Borrominis rätselhafte Krankheit, die er selbst in der genannten Befragung
als indispositione bezeichnet, und
sein Neffe in seinem Bericht als umore
malinconico oder umore ipocondrico,
unmittelbar durch die Kenntnis von Martinellis Tod ausgelöst wurde. Mit der
Annahme, dieser sei bereits am 20. oder 21. Juli erfolgt, erklärt sich
Borrominis Verhalten ganz logisch, beinahe zwangsläufig.
Das plötzliche Hinscheiden des Freundes muß Borromini in
eine tiefe Depression gestürzt haben. Mit ihm verlor er nicht allein einen
engen Vertrauten, sondern auch den einzig verbliebenen Autor für sein geplantes
Buch, das letzte Projekt, in dem er seine architektonischen Ideen noch
verwirklichen konnte. Es muß ihm klar gewesen sein, daß mit diesem
Schicksalsschlag die Publikation endgültig gescheitert war. Zugleich wird aber
auch verständlich, warum er am 22. Juli sein Testament machte. Martinellis Tod
dürfte ihm schlagartig bewußt gemacht haben, daß auch sein eigenes Sterben
unausweichlich und Vorsorge notwendig war. Leider wissen wir nicht, was dieses
– anscheinend erste – Testament enthielt.
In den Tagen nach Martinellis Tod muß Borromini sich
verzweifelte Gedanken um das Schicksal seines Lebenswerks gemacht haben. Die
einzige Person, auf die er noch Hoffnungen setzen konnte, war sein 24jähriger
Neffe Bernardo. Nach dem Tod seines Bruders Giovanni Domenico 1659 hatte er
seine familiäre Pflicht erfüllt und den damals 16jährigen Knaben bei sich
aufgenommen, um ihn auszubilden.
Es war wohl nicht allein die individuelle Pflicht dem verstorbenen Bruder
gegenüber, die Borromini dazu veranlaßt hatte, sondern auch der seit
Generationen gepflegte Zusammenhalt der Bauhandwerkersippen aus dem Tessin. In
ganz Europa waren Mitglieder einiger weniger, aus einem geographisch eng
umgrenzten Gebiet stammender Familien (z. B. der Castelli, Maderna, Tencalla,
Fontana u. a.) im Baugewerbe tätig, und zwar über Jahrhunderte.
Die Nachkommen wurden von den Älteren nicht nur ausgebildet, sondern auch
empfohlen und vermittelt, und durch Eheschließungen zwischen den Zweigen wurde
der Zusammenhalt gefestigt. Auf gleiche Weise war Borromini in seiner Jugend
von Carlo Maderno, der mit seiner Familie verschwägert war, an die
Petersbauhütte geholt worden,
und fühlte sich ohne Zweifel dieser Tradition verpflichtet.
Bernardo hatte sich aber vermutlich damals schon auf dem
Gebiet der Architektur als weitgehend unfähig erwiesen. Er war seit einiger
Zeit an der im Bau befindlichen Fassade von San Carlino beteiligt;
nach Borrominis Tod gelang es ihm, durch sein Eingreifen im oberen Teil „ein
Meisterwerk Borrominis bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen“, wie Thelen zu
Recht schreibt,
und dadurch die Kunstgeschichte lange Zeit zu verwirren.
Wenn die durch Bernardo überlieferte Nachricht stimmt,
dann hat Borromini in den Tagen vor seinem Tod alle zur Publikation
ausgearbeiteten Zeichnungen verbrannt. Da er aber nach seiner Verwundung noch
mehr als einen Tag lebte, könnte die Verbrennung auch nachher stattgefunden
haben. Jedenfalls muß Borromini sehr überlegt vorgegangen sein, denn in seinem
Nachlaß haben sich über 700 Blätter verschiedenster Bestimmung erhalten,
ausgearbeitete Stichvorlagen sind aber nicht darunter. Aus dem Vorgang können
wir zwei Dinge schließen: Erstens, Borromini hielt sein Publikationsprojekt für
endgültig gescheitert; ob er auch sein Leben für abgeschlossen hielt, sein
Selbstmord also vorausgeplant war, ist fraglich, aber nicht auszuschließen.
Zweitens, er traute seinem Neffen nicht zu, das Vorhaben nach seinem Tod
alleine zustande zu bringen.
Bernardo scheinen die Pläne seines Onkels aus finanziellen
Gründen beunruhigt zu haben. Argwöhnisch vermerkte er die große Summe, die der
Onkel in die Anfertigung der Kupferplatten gesteckt hatte.
Daß nun diese Investition durch die Vernichtung der monatelang in mühevoller
Arbeit angefertigten Vorzeichnungen in Rauch aufging, muß ihm wie Irrsinn
erschienen sein. Vielleicht hat er gar nicht verstanden, daß sein Versagen
einer der Beweggründe für die Zerstörungstat Borrominis war; vermutlich sah er
vor allem sein künftiges Erbe bedroht.
Und das nicht von ungefähr: Genau eine Woche nach dem
Ausbruch seiner Depression, am 29. Juli, verlangte Borromini sein Testament vom
Notar wieder zurück und erhielt es auch.
Dies bedeutet zunächst, daß er geistig noch in der Lage war, selbständig
Entscheidungen zu treffen, und daß zumindest sein Notar nicht an seiner
Zurechnungsfähigkeit zweifelte. Die meisten Forscher nehmen an, daß ein Legat
an Martinelli enthalten war, welches Borromini nach dessen Ableben tilgen
wollte.
Ob Borromini seinem gleichaltrigen, nicht bedürftigen Freund wichtige Dinge zu
vererben gehabt hätte, sei dahingestellt - vielleicht seine Bücher. Borromini
seinerseits wird in Martinellis letztwilliger Verfügung nicht bedacht, ja nicht
einmal erwähnt.
Fraglich ist auch, ob es überhaupt nötig gewesen wäre, das nicht vollstreckbare
Vermächtnis zu streichen. Eine lebensbedrohende Krankheit Borrominis hätte
jedenfalls geboten, die Änderung vorzunehmen und das Dokument schnellstmöglich
wieder beim Notar zu deponieren. Das geschah jedoch nicht, vielmehr vernichtete
Borromini die Urkunde oder behielt sie bei sich.
Aus welchen Gründen er das Testament zurücknahm, und warum
er nun zögerte, ein neues abzufassen, wissen wir nicht. Anscheinend suchte er bei seinem Beichtvater Rat: „lo consolò più volte il padre Orazio
Callera, suo parochiano e confessore“, schreibt Bernardo. Die Kernfrage war für Borrominis
sicherlich, wie es um seinen Nachruhm bestellt war, nachdem das
Publikationsprojekt gescheitert war, und wie Bernardo den Nachlaß verwalten
würde.
Drei Tage später, am 1. August, besuchte Bernardo, seiner
handschriftlichen nottizia zufolge,
den Onkel. Aus welchen Gründen er zu jener Zeit nicht mehr bei ihm wohnte, ist
nicht bekannt; um Borromini kümmerte sich der mit im Hause wohnende Gehilfe
Francesco Massari. Zunächst war Borromini der Besuch willkommen, mostrò di gradire la visita, doch nach
einer Weile warf er den Neffen wieder hinaus, licenziò il detto nipote.
Nachdem dieser das Haus verlassen hatte, ging Borromini zum Abendessen; er war
also nicht bettlägerig, non stava al
letto, wie Bernardo zugibt. Es liegt auf der Hand, daß an diesem Nachmittag
zwischen beiden etwas vorgefallen sein muß, was Bernardo verschweigt, denn nach
dem Abendessen begann Borromini, eigenhändig und, wie gewohnt mit dem toccalapis, ein neues Testament zu
schreiben: hiersera mi venne in pensiero
di far testamento e scriverlo di mia propria mano e lo cominciai a scriverlo,
che me ci trattenni da un’hora incirca doppo che hebbi cenato; e trattenutomi
così, scrivendo col toccalapis, sino alle tre hore di notte in circa, wie
Borromini bei der Befragung erklärte.
Er schrieb bis tief in die Nacht und ging dann zu Bett. Als er frühmorgens um
die fünfte Stunde aufstehen und weiterschreiben wollte, verweigerte ihm Massari
das notwendige Licht. Nach drei Stunden wachsender Verzweiflung und Ungeduld
und stürzte er sich all’hore otto e mezzo
in circa, also ungefähr morgens um vier Uhr, in seinen Degen: essendomi anco accresciuta l’impatienza di
non avere il lume, disperato ho presa la detta spada.
Auffällig ist, daß in Bernardos Bericht zwei wichtige
Fakten fehlen. Zwar sagt er, daß Borromini schreiben wollte, verschweigt aber,
daß es sich um sein Testament handelte. Außerdem berichtet er, der Diener habe
Borromini mitgeteilt, der Arzt habe ihm absolute Ruhe verordnet, il medico li aveva imposto che lo lasciasse
riposare, und habe auch auf Borrominis wiederholtes Drängen beteuert, er handle auf Weisung des Arztes: sempre si scusava che aveva ordine dal
medico di lasciarlo riposare. In
Wirklichkeit setzte Massari nicht in erster Linie durch, was die Ärzte geraten
hatten, sondern handelte auf Anweisung Bernardos, wie Pascoli mit
wünschenswerter Deutlichkeit hervorhebt: Chiamò
il nipote a consulta i medici, sentì il parere degli amici, lo fece più volte
visitare da’ religiosi; e tutti unitamente conchiusero, che non si lasciasse
mai solo, che gli si togliesse ogni occasion d’applicare, e che in ogni modo si
procurasse di farlo dormire … Questo fù l’ordine preciso, che ebbero dal nipote
i servidori, e questo essi eseguirono. Selbst die Weigerung des Dieners
wird in einem anderen Wortlaut wiedergegeben: Dicendogli il servidore, che ciò gli era stato proibito da’ medici, e
dal nipote. Offensichtlich benutzt Pascoli hier nicht die auf
Bernardos nottizia beruhende Vita
Baldinuccis, sondern andere Quellen, die vielleicht die Vorgänge eher aus der
Sicht Massaris beschrieben.
Francesco Massari war, wie Bonaccorso gezeigt hat, kein
einfacher Diener, sondern ein begabter Steinmetz und schon 1664 Governatore der
Marmorzunft. Nach dem Tod von Francesco Righi 1664 (?) war er Borrominis
engster Mitarbeiter und zeichnete für ihn.
Borromini schätzte ihn anscheinend fachlich höher als den eigenen Neffen, und
dies dürfte ihm die Feindschaft Bernardos eingetragen haben, nicht zuletzt
deshalb, weil Borromini dem Massari die außergewöhnlich hohe Summe von 500
scudi hinterließ. So verwundert es nicht, daß Bernardo in seiner nottizia ein äußerst ungünstiges Bild
des Gehilfen zeichnet und ihm sogar unterstellt, er habe Borromini eine Droge
verabreicht per farli voltare il cervello.
Als Massari Borromini das Licht zum Schreiben verweigerte,
handelte er auf Anweisung Bernardos. Welche Absichten der Neffe genau
verfolgte, muß offenbleiben; nach außen hin behauptete er, die Empfehlungen der
Ärzte durchzusetzen. Es läßt sich aber denken, daß er befürchtete, die
Erbschaft stehe auf dem Spiel. Vermutlich wollte er vor allem verhindern, daß
Borromini in seiner collera weiteren
Schaden anrichtete; vielleicht wußte er aber auch, daß Borromini sein Testament
zurückgefordert hatte und im Begriff war, ein neues zu verfassen. Daran konnte
ihm nicht gelegen sein, denn ohne Testament wäre ihm, als dem Alleinerben, die
ungeteilte Hinterlassenschaft von etwa 10000 scudi, angelegt in luoghi di monte, zur freien Verfügung
anheimgefallen. Daß seine Befürchtungen nicht unbegründet waren, bestätigt auch
der Zeitgenosse Passeri: [Borromini] non
hebbe amore ad accumular denari per gl’eredi.
Wenn Borromini in jener Nacht die Ränke seines Neffen
geahnt hat, dann ist seine Verzweiflung verständlich. Aus zahlreichen Quellen
ist bekannt, wie empfindlich er auf treuloses Verhalten reagierte, wenn er
Loyalität erwarten durfte; aus diesem Grund hatte er auch mit seinem Freund
Bernini gebrochen.
Daß der eigene Neffen sich genauso verhielt, hat Borromini sicherlich tief
enttäuscht, traf ihn jedoch vermutlich nicht ganz unvorbereitet. Als ihm aber
auch der bis dahin getreue Massari den Beistand verweigerte, muß er sich
vollkommen entmündigt gefühlt haben. Das ist wohl der Grund für seine
verzweifelte Reaktion: Um sich aus der totalen Isolation zu befreien, schien
sich ihm kein anderer Ausweg zu bieten, als sich selbst so schwer zu verletzen,
daß seine Umgebung zum Handeln gezwungen war und Hilfe von außerhalb holen
mußte: „Subito ho cominciato a pensare se
come potevo fare a farmi alla mia persona qualche male, stante che il detto
Francesco mi havesse negato di accendermi il lume“. Ob er sich wirklich
gezielt zu Tode bringen wollte, bleibt fraglich. Indem er sich den Degen in die
Flanke stieß, war die Wahrscheinlichkeit hoch, daß kein lebenswichtiges Organ
getroffen und er nicht unmittelbar sterben würde. Vermutlich war es der Zustand
tiefer Depression, der ihn das Leben achtlos in die Waagschale werfen ließ.
Am hellen Tag war Borromini zwar tödlich verwundet, aber
offenbar wieder Herr seiner selbst, und gab in voller geistiger Klarheit, aber
bedachtsam und mit Diskretion, dem Arzt Auskunft über die Vorgänge. Alle
Hinweise auf die Auseinandersetzung mit dem Neffen ließ er beiseite und gab nur
die bloßen Tatsachen preis. Außerdem beichtete er und diktierte sein drittes
Testament. Darin wird der Neffe zwar zum Universalerben eingesetzt, aber unter
harten Auflagen: Er mußte Architektur studieren, in Rom leben und eine Enkelin
Carlo Madernos heiraten. Verschiedenen Personen und Einrichtungen wurden Legate
ausgesetzt; das restliche Vermögen blieb in depositi
vincolati angelegt und stand dem Neffen nur zum geringen Teil zur Verfügung
a fare casa sua.
Zum Testamentsvollstrecker wurde der Kardinal Ulderico Carpegna bestellt,
dessen Verfügungen Bernardo gewiß nicht zu umgehen wagen würde. Bernardo hielt
sich zwar an die Auflagen, aber ein professioneller Architekt wurde er nicht;
er und seine drei Söhne konnten zeitlebens von den Zinsen von Borrominis
Vermögen leben.
Man kann sich des Eindruck nicht ganz erwehren, Borromini
habe sich das Verhalten Innozenz’ X. zum Vorbild genommen. Wie Borromini seinen
Neffen für die Architektur, so hatte Innozenz den Nepoten Camillo für das
Kardinalat vorgesehen. Beide widersetzten sich den Absichten des Onkels;
Camillo Pamphili heiratete und wurde Oberhaupt einer Familiendynastie, mußte
aber zu Lebzeiten strenge Auflagen seines Onkels hinnehmen. Erst nach dessen
Tod konnte er nach seinem eigenen Gutdünken leben.
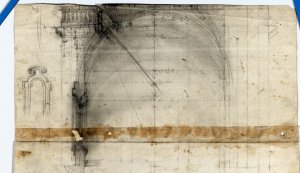 Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß
er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.
Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene
Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat
Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung
seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer
Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute
Tambouraufsatz abgeschnitten.
Damit vernichtete der Architekt alle finanziell verwertbaren Zeichnungen,
hinterließ dem Neffen aber mit vollem Bewußtsein sein Skizzenmaterial und die
lediglich vorbereitenden Zeichnungen als Studienmaterial. Diese hatte damals
noch keinen Marktwert (wie um 1730, als der Baron Stosch die Sammlung kaufte),
sondern Bernardo mußte sich alles selbst erarbeiten und aneignen.
Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß
er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.
Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene
Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat
Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung
seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer
Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute
Tambouraufsatz abgeschnitten.
Damit vernichtete der Architekt alle finanziell verwertbaren Zeichnungen,
hinterließ dem Neffen aber mit vollem Bewußtsein sein Skizzenmaterial und die
lediglich vorbereitenden Zeichnungen als Studienmaterial. Diese hatte damals
noch keinen Marktwert (wie um 1730, als der Baron Stosch die Sammlung kaufte),
sondern Bernardo mußte sich alles selbst erarbeiten und aneignen.
Vermutlich ist also der Grund für Borrominis Selbstmord
zunächst seine Depression, weil er nach dem Tod von Martinelli sein letztes
Projekt, die Publikation seiner Werke, als gescheitert ansah. Hinzu kam das
Gefühl, dem Neffen ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Daß Borromini der
befragenden Amtsperson diese privaten Dinge nicht mitteilte, weder die
Auseinandersetzung mit Bernardo noch den Tod seines Freundes, kann kaum
verwundern; wohl aber, daß selbst der Neffe in seiner Biographie Martinellis Tod
nicht erwähnt, der doch eine so wichtige Rolle gespielt haben muß. Es scheint
fast, als ob hier bewußt ein Geheimnis bewahrt werden sollte.
Das Geheimnis wird nicht gelüftet werden können, aber
welche Erklärungsmöglichkeiten kommen in Betracht? Vielleicht war Borromini in
irgendeiner Weise schuldig am Tod Martinellis, was bei dessen morte repentina ja nicht ganz
ausgeschlossen werden kann.
Vielleicht erklärt sich der Mantel des Schweigens aber auch dadurch, daß
zwischen Borromini und Martinelli eine als unschicklich geltende homoerotische
Beziehung bestand. Passeri schreibt, er habe nie geheiratet, um unbeschwert
durch den peso di famiglia leben zu
können.
Daß sich in Borrominis Leben viele männliche Bezugspersonen finden und kaum weibliche, läßt sich ohne
Schwierigkeiten durch die im Kirchenstaat herrschende Sozialstruktur erklären.
Kann man aus der subtilen Einschränkung in Bernardos letztem Satz „si crede che fusse uomo casto“ eine
Andeutung herauslesen?
Wie dem auch sei, eigenartig ist, daß die Möglichkeit
einer homosexuellen Veranlagung – die unter Künstlern und Gelehrten zweifellos
weitaus häufiger anzutreffen ist als Geisteskrankheiten - Borrominis in der
Forschung bisher noch nicht erwogen worden ist. Andererseits glaube ich weder,
daß Homosexualität eine Krankheit ist, noch daß damit irgendeine Besonderheit
seines künstlerischen Werkes erklärt werden kann.
Zum Abschluß möchte ich dafür plädieren, die Person
Borrominis nüchterner und in einem kühleren Licht zu betrachten. Es gibt keinen
Hinweis auf Wahnsinn, Geistesgestörtheit oder Schizophrenie. Im Gegenteil, ich
finde seine Verhaltensweise nicht unverständlich und zum großen Teil rational
bestimmt. Die fundamentale Kritik des Klassizismus geht fehl, die ihm
Regellosigkeit und frenesia vorwirft.
Borrominis Architektur basiert, wie ich in meinem Buch über das
„Architektursystem“ Borrominis gezeigt habe, auf den gleichen Regeln, auf die
sich auch die Klassizisten beriefen, und strebte wie sie nach Einheit,
Klarheit, Logik und System, die sich nicht zuletzt in der reinweißen Farbe der
Innenräume äußert, die Borromini wie dem Klassizismus gemeinsam ist.
Nicht von ungefähr gab es zu allen Zeiten Stimmen, die diese rationalen
Eigenschaften der Architektur Borrominis erkannten und ihn nicht allein als Erfinder
dekorativer, aber lächerlicher stravaganze
sahen.
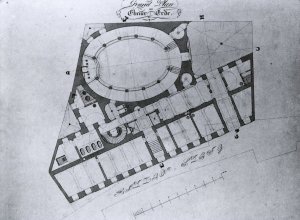
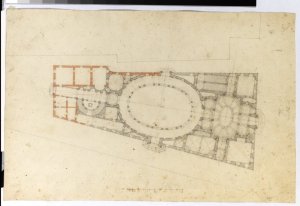
An nur einem Beispiel möchte ich zeigen, daß Borromini
sogar auf den Klassizismus einen gewissen Einfluß gehabt hat, und zwar an der
Synagoge, dem sog. „Stadttempel“ in Wien, einem Bau, den der relativ unbekannte
Architekt Joseph Kornhäusel 1826 errichtete.
Der Innenraum, eine klassizistische Ovalrotunde mit ionischen Säulen, zeigt
deutlich, das er ein Werk vom Anfang des 19. Jahrhunderts ist; im Grundriß
(Abb. links) sind
jedoch, wie ich meine, deutlich Anregungen von Borrominis Entwürfen für den
Palazzo Carpegna (Abb. rechts) zu spüren. Tatsächlich ist es theoretisch möglich, daß
Kornhäusel Zugang zu dem damals in der Wiener Hofbibliothek aufbewahrten „Atlas
Stosch“ hatte und die darin enthalten Zeichnungen Borrominis studieren konnte.
Man beachte den ovalen Säulenkranz, die hufeisenförmige Treppe, die
ausgerundeten Ecken des Hofes und das subtile Ineinandergreifen der einzelnen
Räume, das so charakteristisch für Borrominis Gestaltungsweise ist.
Auch diese Zeichnungen Borrominis für den Palazzo Carpegna
geben möglicherweise kein Bauprojekt wieder, sondern sind vielleicht nur
phantasievolle Ideen, die zeigen, was möglich gewesen wäre,
Variationen über ein architektonisches Thema, und damit Teil von Borrominis
letztem Projekt, das ihn im letzten Drittel seines Lebens beschäftigte.
[79] Bonavia, M. - Francucci, R. -
Mezzina, R., San Carlino alle Quattro Fontane: Le fasi della costruzione, le
techniche caratteristiche, i prezzi del cantiere, in: Ricerche di storia
dell'arte, 20 (1983), pp. 11-38; Bonavia, M., La chiesa ed il convento di S.
Carlino alle Quattro Fontane, in: BollStorArchit, 30 (1983), pp. 87-93.
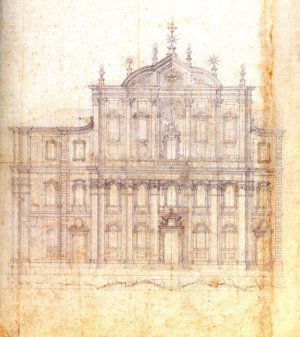 Nur wenig später, um 1650, begann Fra Juan de San
Bonaventura, der Prokurator von San Carlo alle Quattro Fontane, ebenfalls mit
der Abfassung einer relazione. Sie
betraf den Bau von Kloster und Kirche auf dem Quirinal und hob auch andere Leistungen
Borrominis lobend hervor.[12]
Der Text, der in einem von Hispanizismen durchsetzten Italienisch geschrieben
ist, eignete sich nicht ohne weiteres für den Druck, doch enthielt er
zahlreiche Hinweise Borrominis und konnte vielleicht als Grundlage für eine
spätere Publikation dienen. Einzelne Zeichnungen, die aber nicht von Borromini
stammen, illustrieren das vorhandene Manuskript.[13]
Nur wenig später, um 1650, begann Fra Juan de San
Bonaventura, der Prokurator von San Carlo alle Quattro Fontane, ebenfalls mit
der Abfassung einer relazione. Sie
betraf den Bau von Kloster und Kirche auf dem Quirinal und hob auch andere Leistungen
Borrominis lobend hervor.[12]
Der Text, der in einem von Hispanizismen durchsetzten Italienisch geschrieben
ist, eignete sich nicht ohne weiteres für den Druck, doch enthielt er
zahlreiche Hinweise Borrominis und konnte vielleicht als Grundlage für eine
spätere Publikation dienen. Einzelne Zeichnungen, die aber nicht von Borromini
stammen, illustrieren das vorhandene Manuskript.[13]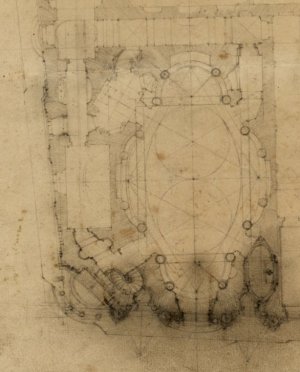 Daneben existieren weitere detaillierte Beschreibungen von
Bauten Borrominis. Sie sind in ihrer Zielsetzung und in ihrem jeweiligen den
bereits genannten Texten so ähnlich, daß man den Eindruck gewinnt, alle
vorhandenen relazioni seien Teile
eines übergreifenden Vorhabens gewesen. Man wird wohl nicht völlig fehlgehen,
wenn man annimmt, daß anfangs weniger der Architekt, als vielmehr der uomo letterato Virgilio Spada die
treibende Kraft gewesen ist.
Daneben existieren weitere detaillierte Beschreibungen von
Bauten Borrominis. Sie sind in ihrer Zielsetzung und in ihrem jeweiligen den
bereits genannten Texten so ähnlich, daß man den Eindruck gewinnt, alle
vorhandenen relazioni seien Teile
eines übergreifenden Vorhabens gewesen. Man wird wohl nicht völlig fehlgehen,
wenn man annimmt, daß anfangs weniger der Architekt, als vielmehr der uomo letterato Virgilio Spada die
treibende Kraft gewesen ist.
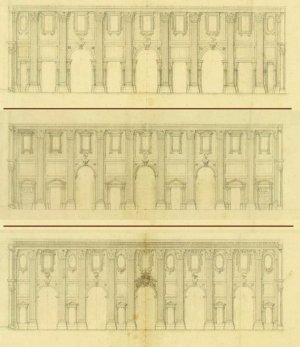 Die delikaten Zeichnungen sitzen mittig auf großen
Blättern. Sie sind vollkommen spiegelsymmetrisch angelegt (das wird besonders
deutlich durch die Wiederholung der mittelalterlichen Triumphbogensäule an der
Eingangswand) und enthalten neben der Skala keine weiteren Maßangaben oder
sonstige Notizen. Sie stellen in erster Linie „Variationen“ (im musikalischen
Sinne) über das Thema der rhythmisierten kolossalen Pilasterordnung dar. Was
den Papst besonders interessiert hätte, zeigen sie nicht – nämlich, mit welchen
Methoden die technischen Schwierigkeiten zu lösen wären; die Aufgabe wird auf
ein reines Gliederungsproblem reduziert. Ob Innozenz X. in der Lage war, die
unterschiedlichen Wirkungen und Konsequenzen der drei Entwürfe abzuschätzen,
sei dahingestellt. Dazu gehörten ein ausgeprägter architektonischer Geschmack
und analytische Fähigkeiten; beides besaß Virgilio Spada in hohem Maße. Mit
gutem Grund war er vom Papst autorisiert worden, alle Entscheidungen „intorno al modo, e forma delli sudetti
riparamento, ornamento, e fabrica“ zu treffen,
Die delikaten Zeichnungen sitzen mittig auf großen
Blättern. Sie sind vollkommen spiegelsymmetrisch angelegt (das wird besonders
deutlich durch die Wiederholung der mittelalterlichen Triumphbogensäule an der
Eingangswand) und enthalten neben der Skala keine weiteren Maßangaben oder
sonstige Notizen. Sie stellen in erster Linie „Variationen“ (im musikalischen
Sinne) über das Thema der rhythmisierten kolossalen Pilasterordnung dar. Was
den Papst besonders interessiert hätte, zeigen sie nicht – nämlich, mit welchen
Methoden die technischen Schwierigkeiten zu lösen wären; die Aufgabe wird auf
ein reines Gliederungsproblem reduziert. Ob Innozenz X. in der Lage war, die
unterschiedlichen Wirkungen und Konsequenzen der drei Entwürfe abzuschätzen,
sei dahingestellt. Dazu gehörten ein ausgeprägter architektonischer Geschmack
und analytische Fähigkeiten; beides besaß Virgilio Spada in hohem Maße. Mit
gutem Grund war er vom Papst autorisiert worden, alle Entscheidungen „intorno al modo, e forma delli sudetti
riparamento, ornamento, e fabrica“ zu treffen,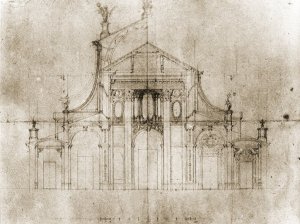 Die gleichen Argumente lassen sich, mit noch größerer
Berechtigung, bei dem berühmten Querschnitt mit dem monumentalen Tonnengewölbe
anführen (Abb.).
Die gleichen Argumente lassen sich, mit noch größerer
Berechtigung, bei dem berühmten Querschnitt mit dem monumentalen Tonnengewölbe
anführen (Abb.).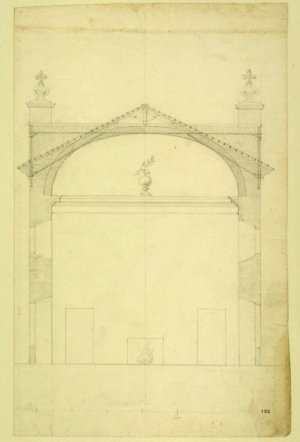 In denselben Jahren um 1650 schrieb Virgilio Spada einen
weiteren Bautraktat, und zwar über den Palazzo Pamphili.
In denselben Jahren um 1650 schrieb Virgilio Spada einen
weiteren Bautraktat, und zwar über den Palazzo Pamphili.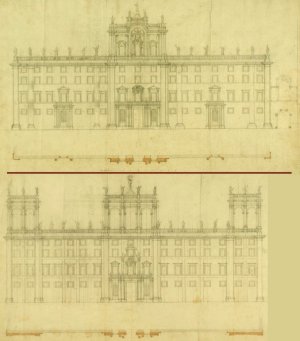 Es scheint also so, als habe Borromini zu mehreren Bauten
detailliert ausgeführte, idealisierende und auf graphische Eleganz zielende
Planserien geschaffen, die sich zwar auf reale Bauprojekte bezogen, aber keinen
Beitrag zur jeweiligen Planungsgeschichte darstellen und keine Aussicht auf
Verwirklichung hatten. Die Merkmale der Zeichnungen und ihre Parallelität zu
vorhandenen Texten legen vielmehr die Vermutung nahe, es handle sich um
Idealentwürfe, die Bestandteile einer Publikation werden sollten.
Es scheint also so, als habe Borromini zu mehreren Bauten
detailliert ausgeführte, idealisierende und auf graphische Eleganz zielende
Planserien geschaffen, die sich zwar auf reale Bauprojekte bezogen, aber keinen
Beitrag zur jeweiligen Planungsgeschichte darstellen und keine Aussicht auf
Verwirklichung hatten. Die Merkmale der Zeichnungen und ihre Parallelität zu
vorhandenen Texten legen vielmehr die Vermutung nahe, es handle sich um
Idealentwürfe, die Bestandteile einer Publikation werden sollten.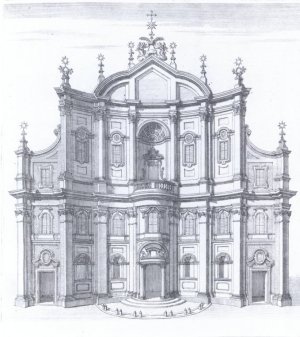
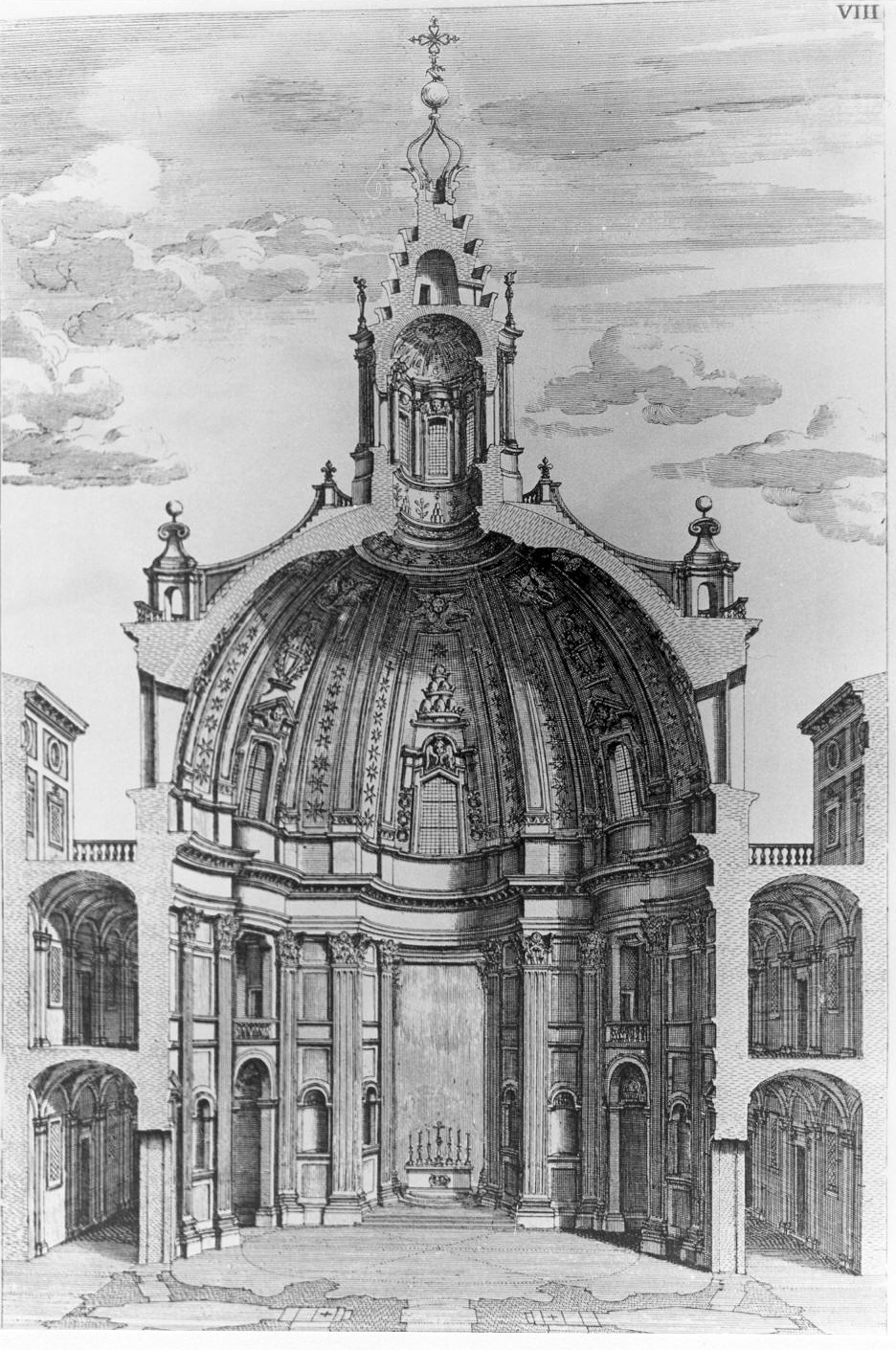
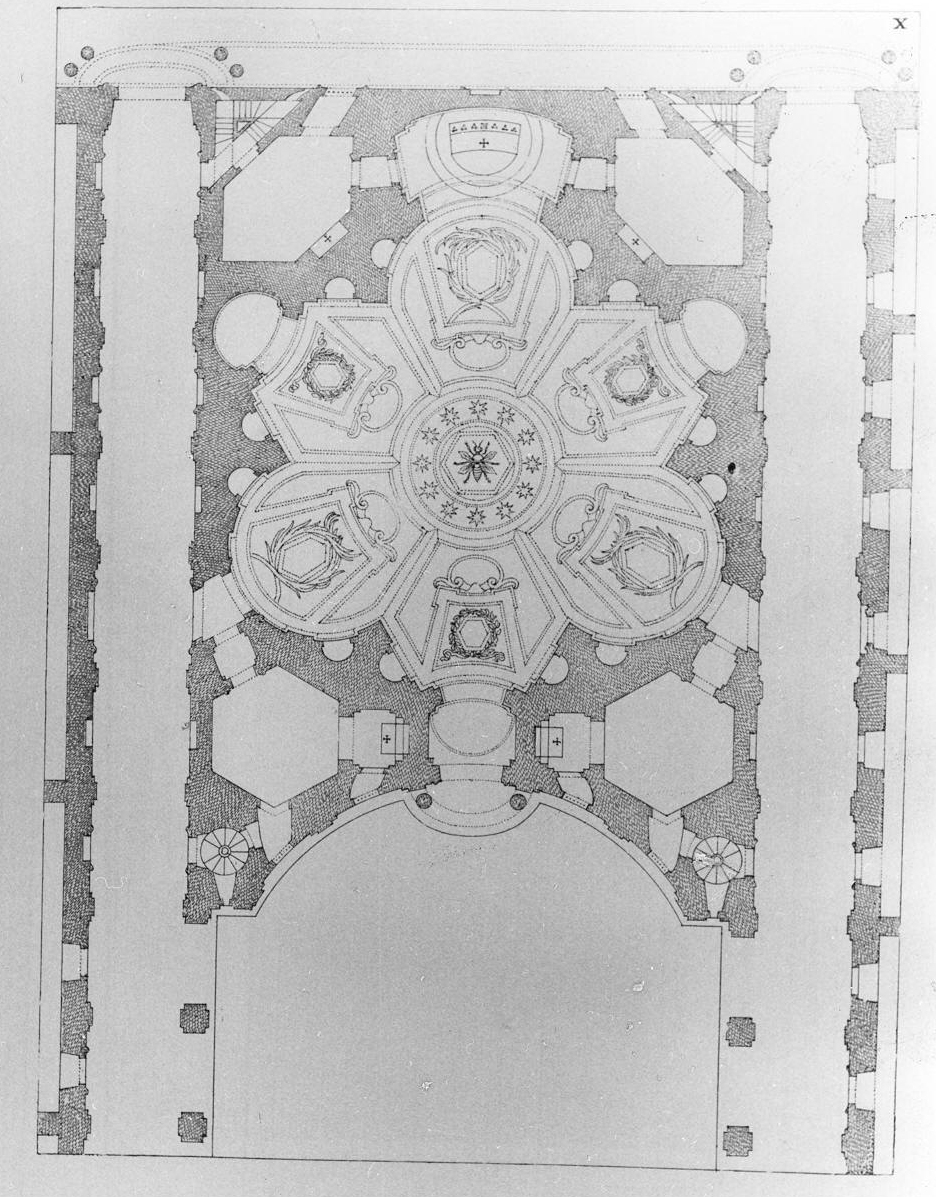
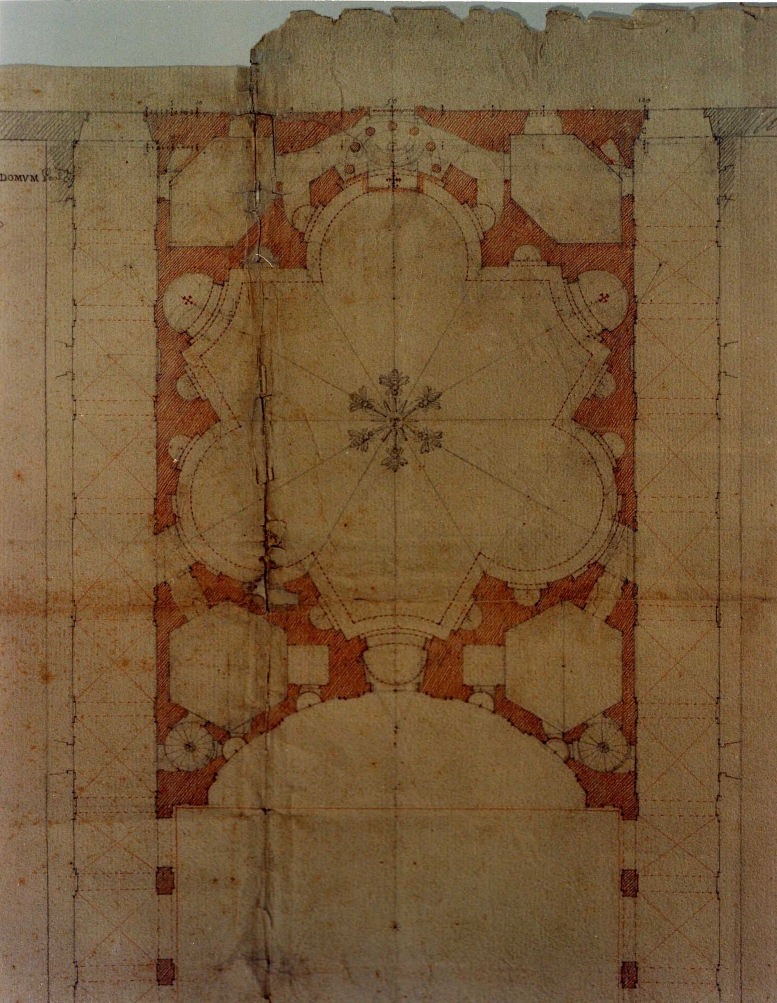
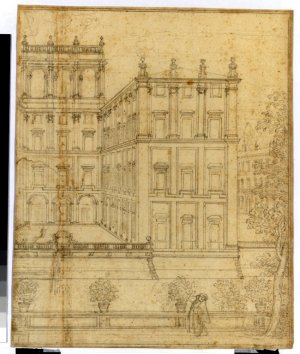 Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des
Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als
eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben
werden.
Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des
Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als
eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben
werden.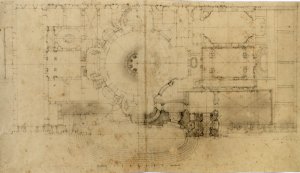 Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,
denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu
schaffen.
Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,
denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu
schaffen.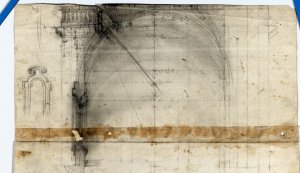 Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß
er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.
Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene
Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat
Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung
seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer
Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute
Tambouraufsatz abgeschnitten.
Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß
er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.
Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene
Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat
Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung
seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer
Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute
Tambouraufsatz abgeschnitten.