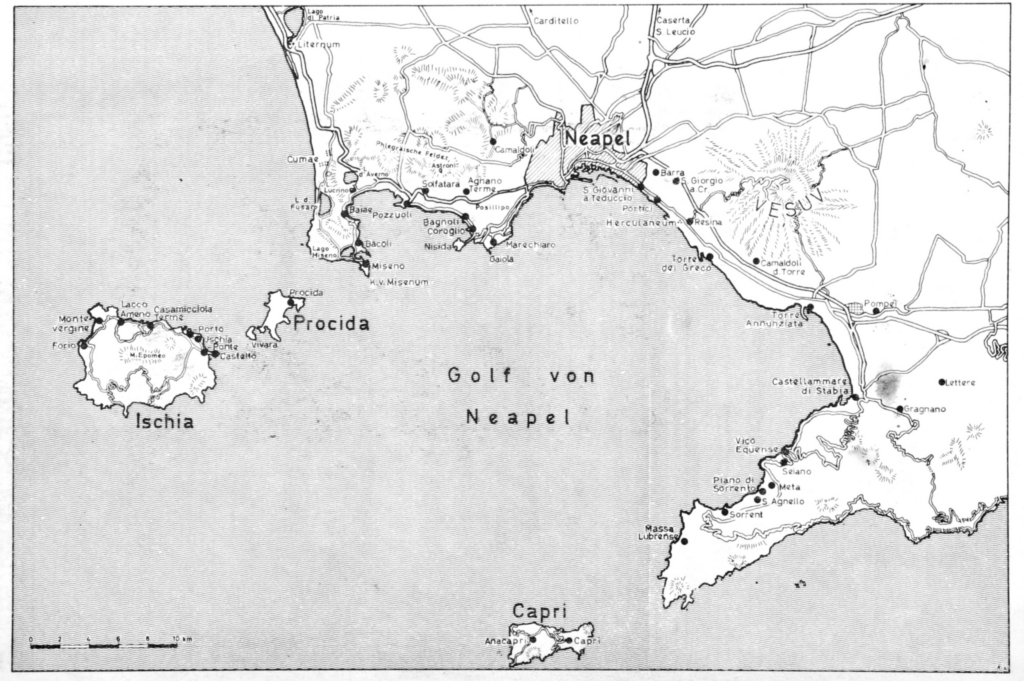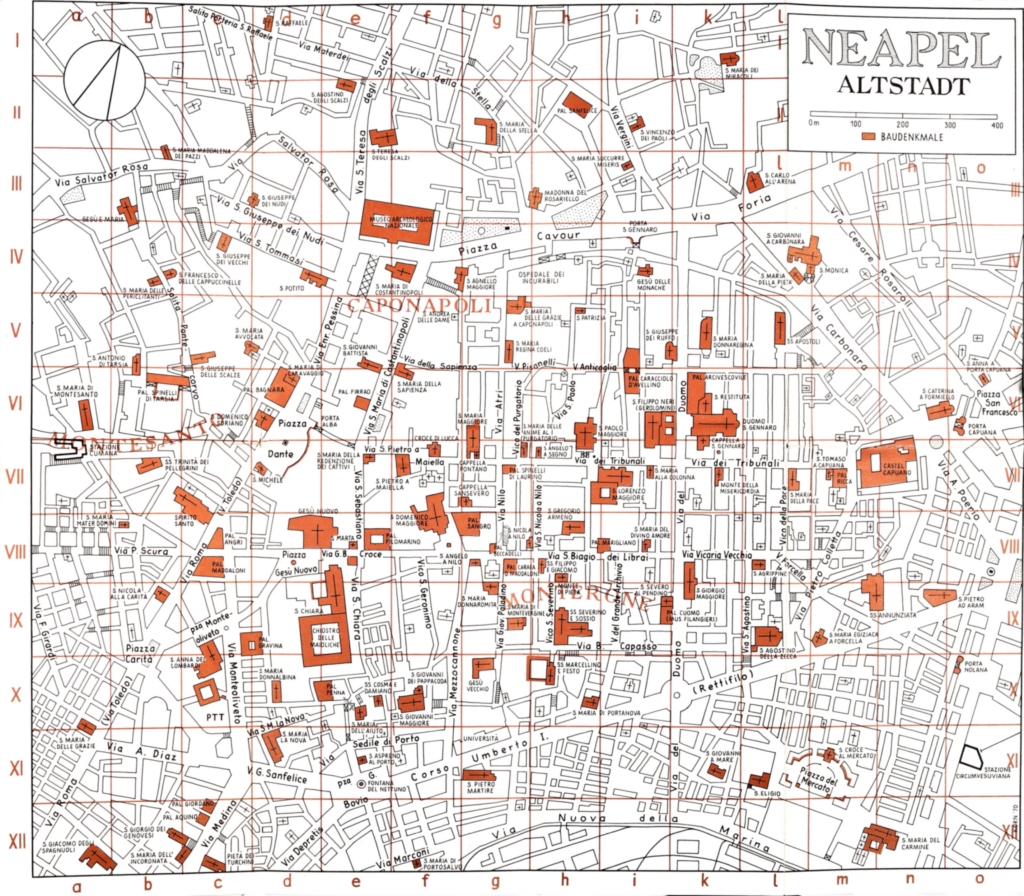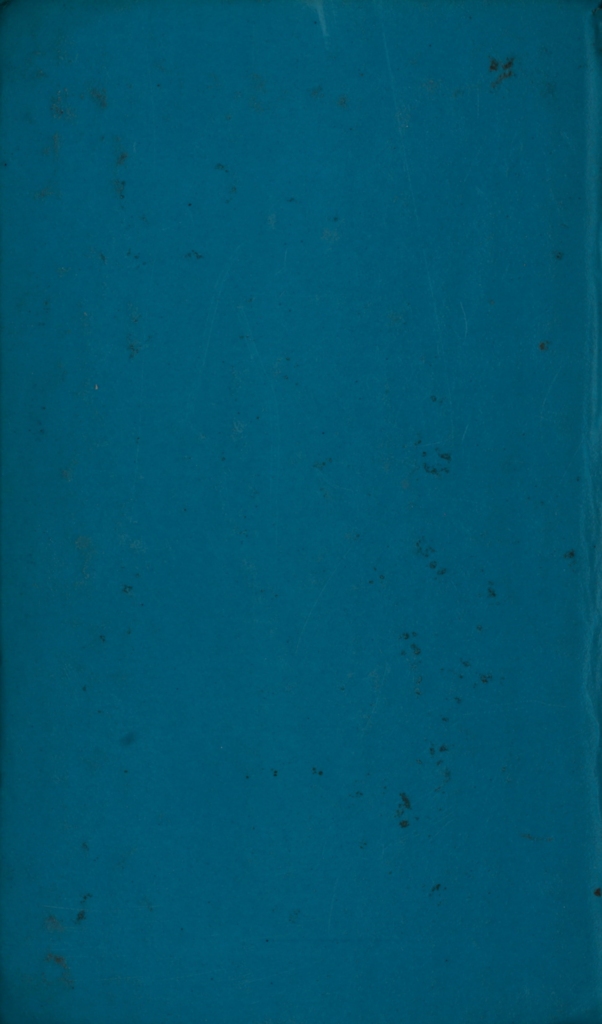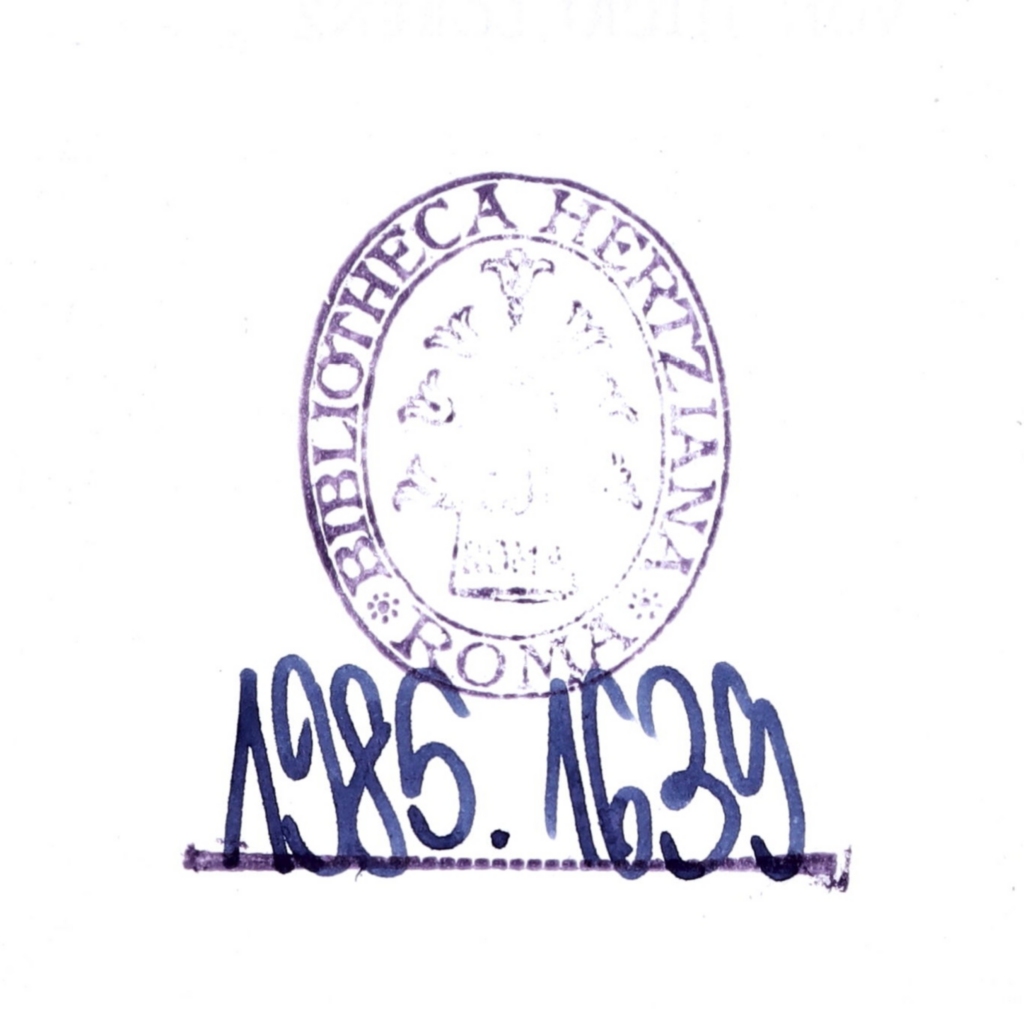

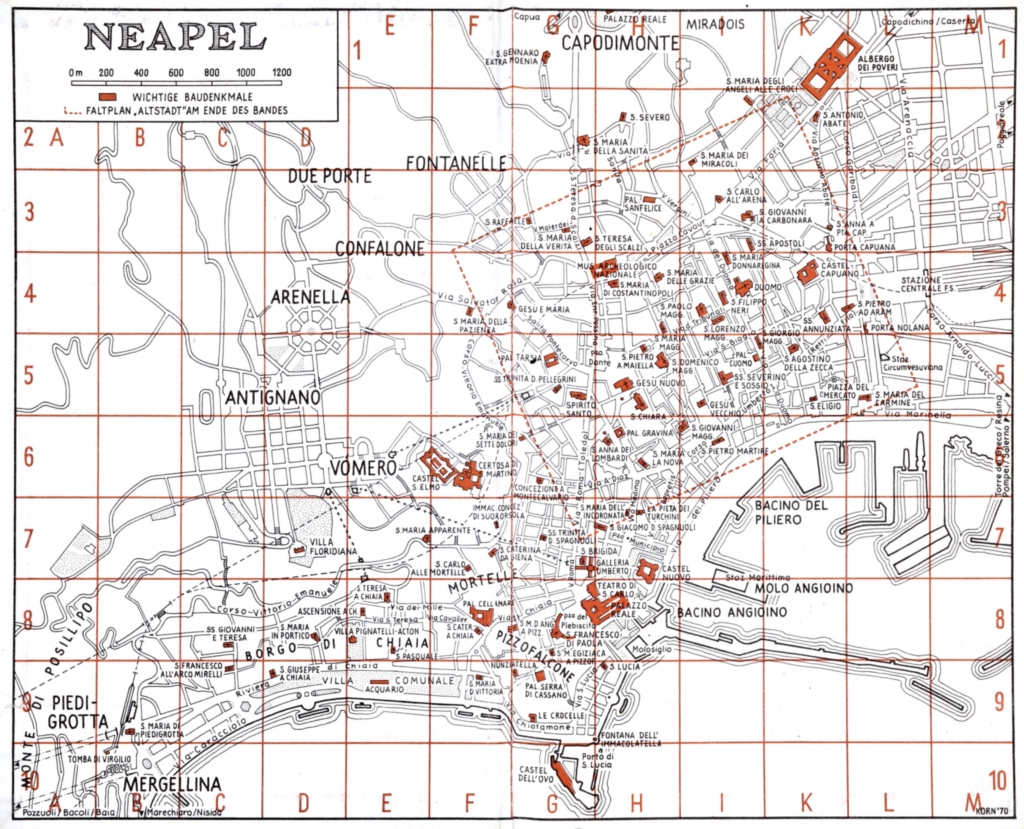
RECLAMS
KUNSTFÜHRER
ITALIEN
HERAUSGEGEBEN VON
MANFRED WUNDRAM
BAND VI
PHILIPP RECLAM JUN. STUTTGART
Neapel
und Umgebung
MIT 80 ABBILDUNGEN IM TEXT
UND 44 BILDTAFELN
SOWIE 3 ÜBERSICHTSPLÄNEN
ZWEITE AUFLAGE
PHILIPP RECLAM JUN. STUTTGART
Reclam Universal-Bibliothek Nr. 10177
Alle Rechte vorbehalten. © 1971, 1983 Philipp Reclam jun., Stuttgart. Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen. Printed in Germany 1983. Zeichnungen: Dr. Ulf-Dietrich Korn, Münster; Prof. Dr. Peter Anselm Riedl, Heidelberg; Brigitte Tiedemann, Münster; Anneliese Kiehne, Stuttgart
Digitale Edition © 2018 Bibliotheca Hertziana, Rom, unter Mitwirkung von Christoph Glorius, Philine Helas, Martin Raspe, Julia Speerschneider, Klaus Werner.
Diese digitale Bearbeitung der 2. Auflage von 1983 ist dem Andenken an Christof Thoenes und Thuri Lorenz gewidmet. Sie wird unter der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die dem Text im Druck beigegebenen illustrierenden Fototafeln mit Schwarzweiß-Abbildungen wurden weggelassen bzw. durch digitale Aufnahmen aus dem Bestand der Fotothek der Bibliotheca Hertziana ersetzt. Diese stehen nicht unter einer freien Lizenz; die Nutzungsbedingungen können bei der Fotothek erfragt werden. Die Seitenzahlen im Text stimmen mit der Vorlage überein und sind dadurch zitierfähig.
ISBN 3-15-010177-8
Ich danke Gott für Neapel! Vom drückenden Rom befreit, fühle ich mich wie einen ganz anderen Menschen... Himmel und Hölle, Elysium und der Tartarus ist hier erfunden; Homer und Vergil haben das einzige Ewige ihrer Gedichte aus Einer Gegend genommen, die vor meinen Augen ist, rechter Hand vor meinem Fenster.
Johann Gottfried Herder, 1789
Die Stadt machte mir wiederum mit ihrem Geschrei und unendlichen Schmutze, mit dem Lumpengesindel, welches sich in den Straßen herumtreibt, einen widerwärtigen Eindruck, und so war ich ganz zufrieden, als uns gegen zwei Uhr der Zug nach Rom hinwegführte.
Graf Paul Yorck von Wartenburg, 1891
Der vorliegende Band des Reclam-Kunstführers behandelt Neapel und seine unmittelbare Umgebung: die Küstenorte des Golfes, die Phlegräischen Felder zwischen Pozzuoli und Cumae, die vorgelagerten Inseln Ischia, Procida und Capri und das Bourbonenschloß von Caserta. Die Bearbeitung des Archäologischen Nationalmuseums und der antiken Vesuv-Städte Pompei, Herculaneum und Stabiae (Antiquarium Stabiano) übernahm dankenswerterweise Herr Dr. Thuri Lorenz.
Mit voller Absicht legt unser Text das Hauptgewicht auf die Stadt Neapel. Sind die Schönheiten der Umgebung seit jeher berühmt, literarisch gewürdigt und touristisch erschlossen, so zählt das Innere von Neapel zu den unbekannten Kunstlandschaften Italiens. Dies erweist sich nicht zuletzt am Stand der kunsthistorischen Forschung, die hier vielfach erst in den Anfängen steckt. Wir haben ihre Ergebnisse dankbar benutzt, wo immer das möglich war; in zahlreichen anderen Fällen mußten Zuschreibungen und Datierungen, deren kritische Überprüfung noch aussteht, aus der Guidenliteratur übernommen werden. Unentbehrliche Hilfen boten die Arbeiten von H. Achelis, H. Belting, E. Berteaux, F. Bologna, G. und P. Buchner, R. Causa, G. Ceci, G. Chierici, B. Croce, F. De Filippis, A. De Rinaldis, R. Di Stefano, 0. Ferrari, F. Fichera, R. und A. Filangieri, F. Goldkuhle, G. L. Hersey, H. Hibbard, C. M. Kaufmann, Th. Klauser, R. Krautheimer, W. Krönig, G. Ladner, M. Lisner, R. Longhi, J.-L. Maier, A. Maiuri, B. Molaioli, O. Morisani, R. Mormone, F. Nicolini, R. Pane, J. Pope-Hennessy, F. Rakob, W. Rolfs, A. Rusconi, M. Salmi, F. P. Salvati, L. Serra, J. Sievers, G. Sobotka, F. Strazullo, G. Tescione, P. Toesca, R. Valentiner, A. Venditti, W. F. Volbach, R. Wagner-Rieger, R. Wittkower und vielen anderen. Unser Manuskript wurde 1968 abgeschlossen; die seither erschienene Literatur konnte leider nicht mehr benutzt werden. Jedem Kapitel des Textes geht eine Aufzählung der Hauptsehenswürdigkeiten voran. Sie ist nur als erste Hilfe für den Schnellreisenden gedacht, und niemand soll sich durch sie den Spaß an Neapels zahlreichen »Nebensachen« verderben lassen. In dieser Stadt hat Beschränkung niemals für weise ge-
golten; so trägt auch ihre Kunstproduktion zu Zeiten den Anstrich des Massenhaften, und manche der großen Ideen, die uns anderswo in geschlossenen Einzelwerken entgegentreten, muß man sich hier aus vielfach verstreuten Splittern zusammenlesen. Wer nur Gipfelleistungen sehen will, wird zwar sein Pensum rasch erledigt haben, am Ende sich aber im Fall jenes reiseunlustigen Kunstwissenschaftlers befinden, an dem die Weissagung Jacob Burckhardts in Erfüllung ging: »Wenn Sie wieder in Basel sind und die Messe einläutet und Regen und die ersten Schneeflocken fallen, dann wird bittere Sehnsucht nach den verschmähten Eindrücken über Sie kommen. Dann wird es heißen: könnte ich doch nur das und das Altarbild dritten Ranges einen Augenblick wiedersehen! Oder das Marmorgrab eines vermutlichen Schülers eines Solchen, welcher einst Donatello gekannt haben könnte! Denn auch das Geringe und Mittelbare in Italien stammt doch aus einem großen Model.«
Ein Grundsatz des Verfassers war, über nichts zu schreiben, als was er selber gesehen hat. Die im Text gegebenen Hinweise auf Zustand und Zugänglichkeit der Denkmäler entsprechen im allgemeinen dem Stand der Jahre 1965-67. Wo Bauten uns verschlossen geblieben sind, haben wir auch dies verzeichnet, in der Annahme, daß kaum ein nichtspezialisierter Reisender noch mehr Zeit, Geduld und Überredungskunst wird aufwenden wollen, um zu den betreffenden Werken vorzudringen. Es sei hier bemerkt, daß die rein praktischen Schwierigkeiten, mit denen der Kunstinteressierte in Neapel zu kämpfen hat, sehr groß sind, wahrscheinlich größer als in irgendeiner anderen, nördlicher gelegenen Stadt Italiens. Unser Text hat seinen Zweck erfüllt, wenn er den Leser dazu ermuntert, solche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen; zuversichtlich läßt sich voraussagen, daß er dabei manches entdecken wird, was nicht in diesem Führer steht.
Es ist das Prinzip des Kunstführers, einen ohne weiteres lesbaren Text zu bieten. Einige immer wiederkehrende Wörter und Begriffe wurden zum Teil abgekürzt. Obwohl diese Abkürzungen auch sonst gebräuchlich und wohl jedermann verständlich sind, werden sie im folgenden erklärt:
Die im Text des Kunstführers verwendeten italienischen Ausdrücke Dugento (= 200, abgekürzt für 1200 = 13.Jh.)‚ Trecento (14. Jh.), Quattrocento (15. Jh.), Cinquecento (16. Jh.), Secento (17. Jh.) usw. bezeichnen sowohl das Jahrhundert als auch seinen Stil.
Neapel
Geographisch gesehen gehört das Stadtgebiet von Neapel dem Kratersystem der Phlegräischen Felder an, das vom Strande von Cumae bis zur Sebeto-Niederung am Fuß des Vesuv die nördliche Flanke des Golfes bildet. Unverkennbar ist die Gestalt seiner Höhen, Senken und Hafenbuchten vom Vulkanismus geprägt. Der Boden besteht aus Tuff, verhärtetem, von Trachyt und Bimsstein durchsetztem Ascheauswurf, dessen erdig-fahles »Neapelgelb« in jeder Golfansicht wiederkehrt. Seit jeher dient er Neapel als Baumaterial; ein labyrinthisch verzweigtes System alter unterirdischer Brüche und Stollen (Katakomben) durchzieht die Hügelregionen der Stadt. Leicht zu bearbeiten, aber auch schnell verwitternd, sind die »tufelli« vor allem an salziger Meeresluft rasch fortschreitender Auszehrung preisgegeben; nur der steinharte Puzzolanmörtel, mit dem die Fugen ausgestrichen werden, hält jeder Zerstörung stand und tritt im Laufe der Zeit als ein wabenartiges Netzwerk hervor, das Mauern und Häuserwänden ihr eigentümlich »poröses« Aussehen mitteilt. Vulkanischen Ursprungs sind auch die »lapilli«, aus denen der wasserdichte Belag der Terrassen bereitet wird. Der Verzicht auf das schützende Ziegeldach nimmt auch der Fassade ihren Schlußakzent; die Hauswand bricht oben ab, eine Putzkante oder ein rahmender Farbstreifen ersetzt das Traufgesims; Wäscheleinen, Fenstertüren und eiserne Gitterbalkons signalisieren die Bewohnbarkeit des Kubus.
Der eigenste Modus dieser Bauweise ist das Provisorium; er bestimmt die Physiognomie des Stadtbildes überhaupt. Den Ankommenden, von welcher Seite immer er sich der Stadt nähert, empfängt ein diffuses Gemisch aus Vorstadt und Zentrum, alten und neuen, nie fertig gewordenen und halb schon verfallenen Häusern und Straßenzügen, die nach allen Richtungen auseinanderstreben. Keiner der großen Rundblicke, die Neapel so reichlich gewährt, wird diesen Eindruck wesentlich modifizieren: Ein anarchisch verschlungenes Dickicht menschlicher Wohnstätten, undurchdringlich in seinem Kern, an den Rändern uferlos auseinanderfließend, scheint Hügel und Ebenen zu bedecken; vereinzelte monumentale Akzente, Fassaden, Türme und bunt glasierte Kuppeln, die aus dem Geschiebe der Dachterrassen empor-
steigen, wirken wie zufällig ausgestreut; nur der vielfach gegliederte Küstensaum mit dem Vorgebirge von Castel dell’Ovo bietet dem Auge einigen Halt. Erst geduldig eindringendes Studium vermag aus der dichten und feinen Textur dieses Stadtgrundrisses das Lebensgesetz einer mehr als 2000jährigen Großstadtgesellschaft herauszulesen. So möge zur ersten Orientierung des Lesers eine topographische Übersicht dienen, die das natürliche Relief des Stadtbilds beschreibt, die Masse der Häuserviertel in ihre Bestandteile gliedert und die wichtigsten alten Ortsbezeichnungen referiert, die noch heute in vielen Straßen- und Gebäudenamen fortleben. Im Anschluß daran soll versucht werden, einige historische Entwicklungslinien des Stadtplans nachzuzeichnen.
Als Zentrum der Stadt gilt heute der Palazzo Reale mit dem Teatro S. Carlo, der Galleria Umberto und den Plätzen Trieste e Trento (S. Ferdinando) und del Plebiscito (S. Francesco da Paola). Das umgebende Quartiere di S. Ferdinando umfaßt auch den südlich vorgelagerten Felsen Pizzofalcone (Monte Ecchia, auch Monte di Dio) mit S. Maria degli Angeli, S. Maria Egiziaca, Nunziatella und Immacolatella; an seinem steil abfallenden Südhang die Viertel S. Lucia und Chiatamone, dazwischen das ins Meer hinausgebaute Castel dell’Ovo mit seinem Bootshafen (Porto S. Lucia) und den Resten des alten Borgo Marinaio.
Von hier aus nach Westen erstreckt sich in flachem Bogen der vornehme Borgo di Chiaia (»Strandvorstadt«), amphitheatralisch von der gleichnamigen Riviera (Villa Comunale, Aquarium) gegen die ehemals grüne, in den, letzten Jahren vollständig überbaute Collina di Chiaia aufsteigend (Palazzo Cellamare, S. Teresa, Ascensione, Villa Pignatelli, auf der Höhe Villa Floridiana). Der Verlauf der alten Via Puteolana, die sich am Fuß des Hügels entlangzog, läßt sich im heutigen Stadtplan noch gut verfolgen (Via Chiaia — Cavallerizza — S. Teresa — S. Maria in Portico — Croce Rossa). Die Strandstraße (Riviera di Chiaia) teilt sich an der Torretta im Westen der Bucht in 2 Arme — der nördliche steigt zum Piedigrotta-Viertel hinauf (S. Maria di Piedigrotta, Tomba di Virgilio), der südliche führt zur Mergellina mit S. Maria del Parto und dem Fischerhafen Porto Sannazzaro. Die Hügel bilden hier, nach Süden umbiegend,
das Vorgebirge Posillipo, welches das Weichbild des älteren Stadtgebiets im Westen abschließt; seine Abhänge sind mit Villen vornehmlich des 19. Jh. bedeckt; die Höhen tragen auch hier dichtgedrängte moderne Wohnviertel. Am Meer unweit Mergellina der Palazzo Donn’Anna, an der Südspitze Marechiaro mit den Überresten der Villa Pausilypon, im Westen, schon dem Golf von Pozzuoli zugewandt, die Insel Nisida und der Strand von Coroglio. — Von Piedigrotta führt ein System von Tunneln (»Grotten«) westlich durch den Berg nach Fuorigrotta und den anschließenden Neubauvierteln Mostra dell’Oltremare (Ausstellungsgélände, Sportfeld) und Terme di Agnano, dann weiter nach Bagnoli, Pozzuoli, Baiae und Bacoli.
Zum Palazzo Reale zurückgekehrt, folgen wir der großen Nord-Süd-Achse des heutigen Stadtinneren, der Via Roma, vormals Toledo. Im Rione Carità mit seinen rechter Hand zum Hafen hinabführenden Straßenzügen (S. Giacomo degli Spagnuoli, Via Diaz, Piazza Carità) hat sich ein modernes Hochhausviertel entwickelt. Zur Linken thront auf dem Gipfel des Vomero, der höchsten Erhebung der Stadt, das Castel S. Elmo mit der Certosa di S. Martino; dahinter die Neubauquartiere Antignano, Arenella, Confalone, Due Porte, Fontanella und endlich die Höhe von Camalaloli. — An den Abhängen unterhalb der Certosa zwischen Via Toledo und dem auf halber Höhe sich hinziehenden Corso Vittorio Emanuele drängen sich die Häuser des alten Quartiere di Monte Calvario mit SS. Trinità degli Spagnuoli und Chiesa della Concezione. Westlich davon, im Rücken des Pizzofalcone, die Collina delle Mortelle (S. Carlo alle Mortelle, S. Anna di Palazzo, Pal. Cellamare), nördlich anschließend das Quartiere dell’Avvocata oder di Montesanto mit S. Maria di Montesanto, Trinità dei Pellegrini, Spirito Santo und die nach Nordwesten ansteigende Contrada Pontecorvo (S. Giuseppe, Gesù e Maria). — Die Fortsetzung des Toledo (Piazza Dante, Via Enrico Pessina, Via S. Teresa) führt weiter aufwärts durch das Quartiere della Stella mit dem Museo Nazionale, S. Teresa degli Scalzi, S. Maria della Stella — zur Linken die schräg emporsteigende Infrascata (Via Salvator Rosa) und die Anhöhe von Materdei —, überquert das Valle della Sanità (Ponte Sanità, S. Maria della Sanità, S. Gennaro dei Poveri) und erreicht schließlich in Serpentinen ansteigend die Kuppe von Miradois mit dem
Palazzo Reale Capodimonte. — Ein in Höhe des Museo Nazionale vom Toledo ostwärts abzweigender Straßenzug weitet sich zum Largo delle Pigne (Piazza Cavour), durchquert als Via Foria das Quartiere dell’Arena mit der alten Contrada delle Vergini, S. Carlo, S. Maria dei Miracoli, dem Albergo dei Poveri und dem Berge S. Antonio Abate und läuft weiter bis zu den Vorstädten von Capodichino (Flughafen) und Poggioreale (Friedhof) im Nordosten bzw. Osten der Stadt.
Der Kranz von Hügeln, an den die bisher genannten Quartiere sich anlehnen, umschreibt ein nach Osten und Süden, zum Vesuv wie zum Golf hin geöffnetes Becken, dessen leicht gewellter, zum Strand hin abfallender Grund die ältesten und dichtest besiedelten Stadtteile trägt. Die Nordhälfte dieses Gebietes teilt sich in die Viertel S. Lorenzo (mit S. Agnello und S. Maria delle Grazie auf dem Caponapoli — dem höchsten Punkt des Altstadtbezirks —, S. Maria Maggiore, S. Paolo Maggiore, S. Lorenzo Maggiore, Chiesa dei Gerolomini, Dom, S. Maria Donnaregina, SS. Apostoli) und Vicaria (S. Giovanni a Carbonara, S. Caterina a Formiello, Castel Capuano, südlich davon die Forcella, d. h. die Straßengabel am Ostende der Via dei Tribunali, mit SS. Annunziata und S. Pietro ad Aram, ostwärts anschließend das Bahnhofsgelände). Südlich von S. Lorenzo liegt das Quartiere di S. Giuseppe (S. Pietro a Maiella, S. Domenico Maggiore, Gesù Nuovo, S. Chiara, S. Anna dei Lombardi, S. Maria la Nova); weiter nach Osten das zum Hafen hin abfallende Quartiere di Pendino oder Portanova (SS. Severino e Sossio, S. Giorgio Maggiore und SS. Marcellino e Festo auf dem Hügel Monterone). — Der zu den »quartieri bassi« gehörige Uferstreifen wird zunächst durch die alten und neuen Hafenanlagen gegliedert: am Palazzo Reale der Bootshafen Molosiglio und die Darsena Acton (Arsenal), dann die Bacini Angioino (Calata Beverello) und del Piliero (Immacolatella Vecchia und Nuova), dazwischen der Mala Angioino, der heute die Stazione Marittima, vordem aber als Wahrzeichen des Hafens den großen Leuchtturm (la lanterna oder il faro) trug; anschließend der moderne Osthafen. Das Zentrum des heutigen Hafenviertels bildet die Piazza del Municipio mit dem Castel Nuovo; daran schließen sich das alte Quartiere di Porto (S. Giovanni Maggiore, Gesù Vecchio, S. Pietro Martire), das Quartiere del Mercato mit der
gleichnamigen Piazza, S. Eligio und S. Maria del Carmine und noch weiter östl. der Borgo Loreto. — Die alte Uferstraße (la Marinella) führt weiter durch das Cavallerizza-Viertel, überquert mit dem Ponte della Maddalena das Flüßchen Sebeto und mündet schließlich in die Kette der vesuvianischen Küstenorte S. Giovanni a Teduccio, Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata.
In Neapel ist nichts für die Ewigkeit gebaut, alles in fortwährender Umwälzung begriffen. Ein unsicherer, von Erdstößen leicht zu erschütternder Boden im Verein mit der rastlosen Tätigkeit einer ständig wachsenden Einwohnerschaft haben dafür gesorgt, daß im Stadtgebiet seit der Antike kein Stein auf dem anderen blieb. Von den Bauten der Griechen, Römer, Byzantiner ist so gut wie nichts auf uns gekommen; weniges aus dem Mittelalter, nicht viel mehr aus der Renaissance, am meisten noch aus dem Barock, und auch da wiederum aus der Spätzeit des Stils; bestimmend tritt die Bautätigkeit des 19. Jh. hervor, die nun zunehmend von der des 20. Jh. abgelöst wird. So erscheint die Baugeschichte Neapels als ein unaufhörlicher Zerfalls- und Umwandlungsprozeß, in dem kaum je ein einheitlicher Wille das Gewordene festgehalten, kein historisches Bewußtsein das Vergangene integriert hat. Improvisationsbegabt und ganz dem Reiz des Augenblicks hingegeben, sehen wir den Neapolitaner durch die Jahrhunderte damit beschäftigt, sein Stadtbild umzudekorieren: eine ungeheure Freilichtbühne, auf der das Alte obsolet, das Neue provisorisch wirkt und nur der alles überstrahlenden Natur des Golfes Dauer zukommt.
Am Beginn der Geschichte Neapels steht der Mythos von der Sirene Parthenope, die gleich ihren Schwestern nach der geglückten Durchfahrt des Odysseus den Tod in den Wellen suchte und deren Leichnam dann am nördlichen Ufer des Golfes an Land trieb. Siedler aus Rhodos sollen ihr ein prächtiges, alljährlich durch Stieropfer geehrtes Grabmal errichtet haben, das den Eingang des Hafens bewachte. Diese von Strabo referierte Tradition ist ganz sagenhaft; aber auch die im 7. Jh. v. Chr. von Cumae aus gegründete Palaeopolis hat sich bis heute nicht sicher nachweisen lassen. Die meisten Autoren suchen sie auf dem Pizzofal-
cone, ihre Hafenbucht in der Gegend der heutigen Piazza del Plebiscito; Gräberfunde in der Nähe der Via G. Nicotera ostwärts des Pallazzo Cellamare (1952) machen die Existenz einer frühgriechischen Nekropole im Tal zwischen Pizzofalcone und Vomero wahrscheinlich. Nach dem griechischen Seesieg über die Etrusker (474 v. Chr.) entsteht in der östlich angrenzenden Ebene die Neustadt Neapolis, deren planvolle Anlage die Lehren Hippodamos’ von Milet, des großen Städtebauers der griechischen Klassik, widerspiegelt.
Der Bauplatz erfüllte alle Forderungen der Theorie: ein leicht erhöhtes Plateau, an den Rändern gut zu befestigen; die Oberfläche so weit geneigt, daß das Regenwasser durch die Gassen zu Tal fließt und den Unrat der Stadt mit sich fortschwemmt. Ihr Umfang zu Ende des 5. Jh. v. Chr. läßt sich auf dem heutigen Stadtplan etwa folgendermaßen beschreiben: im Westen Via Mezzocannone (im 4. Jh. v. Chr. wurde der Hügel von S. Giovanni Maggiore einbezogen) — S. Domenico Maggiore — S. Agnello a Caponapoli (im 4. Jh. vorgerückt bis Piazza Bellini — Via S. Maria di Costantinopoli); im Norden die Hügelkante, die von S. Agnello — Via Longo — Via Settembrini — SS. Apostoli gegen die Piazza Cavour abfällt (deren Niveau damals ca. 10 m tiefer lag als heute); im Osten Via Oronzio Costa — Castel Capuano — Via Annunziata — Piazza Calenda — S. Agostino della Zecca; im Süden der obere Rand des Pendino von S. Agostino über SS. Severino e Sossio und Gesù Vecchio zur Via Mezzocannone. An mehreren Stellen haben sich Reste der griechischen Stadtbefestigung erhalten: in der Via Mezzocannone (Nr. 19, im Vestibül des Cinema Astra); auf der Piazza S. Domenico; auf der Piazza Bellini (es handelt sich um die Stadterweiterung des 4. Jh. v. Chr.); im Gebäude des Ospedale degli Incurabili (S. Maria del Popolo) südlich der Piazza Cavour; schließlich an der Piazza Calenda (vormals Piazza delle Mura Greche — man erkennt die starken Befestigungen der Porta Herculanensis oder Furcillensis).
Außerhalb der Mauern lagen im Nordwesten (Valle della Sanitär) die Neleropole, im Süden, etwa in der Linie Via Depretis / Corso Umberto, der Hafen und eine dazugehörige Vorstadt (pagus suburbicus).
Auf dem westlichen Küstenstreifen vom Pizzofalcone bis zum Posillipo entsteht in römischer Zeit eine Kette von
Lustvillen, deren berühmteste, die des Lukullus, sich mit ihren Gärten und Fischteichen von der Megaris (Castel dell’Ovo) über Chiatamone und S. Lucia bis zum Palazzo Reale hinüberzog. I. ü. scheint sich das Stadtbild unter der Herrschaft Roms (seit 326 v. Chr.) nur wenig verändert zu haben; war es doch gerade das Fortdauern griechischer Lebensart, Kunst und Wissenschaft, dem die Neapolis ihre Anziehungskraft auf gebildete Römer verdankte. So läßt das Forum der Römerstadt sich ohne weiteres mit der griechischen Agom identifizieren. Es lag an der Via dei Tribunali, etwas westlich der Via del Duomo, und umfaßte das Areal von S. Lorenzo Maggiore mit dem Gebäude der Curia (s. S. 174), die Piazza S. Gaetano, die westl. angrenzenden Häuserblocks und S. Paolo Maggiore, den einstigen Dioskurentempel. Unmittelbar dahinter, zwischen S. Paolo und der Via dell’Anticaglia, erhob sich das 11000 Zuschauer fassende Theater, in dem Nero als Schauspieler auftrat und von den Neapolitanern lautstark gefeiert wurde (s. S. 290). Westlich davon lag das Odeon, nördlich die großen Thermen; weitere Tempel vermutet man an den Stellen des Domes (Jupiter oder Apoll) und der Kirchen S. Giovanni Maggiore (Antinous), SS. Apostoli (Merkur), S. Gregorio Armeno (Ceres) und S. Maria Maggiore (Diana).
Wie ein Blick auf den heutigen Stadtplan zeigt, ist das alte Straßennetz praktisch intakt geblieben. Seine leicht von der Nordrichtung abweichende Orientierung entsprach der antiken Vorstellung, daß die Straßen sich nicht nach einer Haupthimmelsgegend öffnen sollten, in denen man den Ursprung der heftigsten Winde lokalisierte. Die Zahl der östlich-westlich laufenden Decumani war auf 3 beschränkt, um die schlechte Luft (»Malaria«) der im Osten liegenden sumpfigen Sebeto-Niederung soweit als möglich von der Stadt fernzuhalten. Die Hauptstraße — Decumanus Maior — heißt heute Via dei Tribunali; dem nördlich davon verlaufenden Decumanus Superior entspricht der Straßenzug Via della Sapienza — Pisanelli — Anticaglia — Donnaregina — SS. Apostoli, dem südlichen Decumanus Inferior die Via S. Biagio dei Librai — Vicaria Vecchia; die hier nach Osten abknickende Via Forcella bezeichnet den Anfang der Landstraße nach Herculaneum (Porta Herculanensis, s. o.). Sie werden rechtwinklig geschnitten von etwa 20 nicht weiter unterschiedenen, der frischen Seebrise Zutritt gewährenden Cardines.
Die heute so stark hervortretende Achse der Via del Duomo ist durch eine Verbreiterung des späten 19. Jh. entstanden; die ursprüngliche Breite der Straßen betrug, einer weiteren weisen Regel antiker Stadtbaukunst zufolge, nicht mehr als etwa. 6 m für die Decumani, 4 m für die Cardines — genügend zur Lüftung, doch zugleich Schutz gegen Sonne und Zugwind bietend; die Höhe der Häuser dürfte 10-12 m kaum je überschritten haben. Die derart ausgeschnittenen Häusergevierte, die Insulae, bilden bis heute die festen Zellen des Altstadtgefüges; in ihrem Innern sind alte und neue Paläste, Höfe und Gärten, Kirchen, Kreuzgänge und Konvente unauflöslich ineinandergewachsen, oft nur durch ein Seitenportal, einen niedrigen Hofdurchgang mit der Außenwelt kommunizierend.
Vergleicht man den historischen Bau des nachantiken Neapel mit demjenigen mittel-oder oberitalienischer Städte, so fällt zuallererst das Fehlen eines mittelalterlichen Zentrums ins Auge. Kein Stadtpalast, kein kommunaler Platz sind im Gewirr der Gassen auszumachen. Der Grund liegt in dem eigenartigen Verlauf der mittelalterlichen Stadtgeschichte: Gerade in der Mitte des 12. Jh., als im übrigen Italien allenthalben das Bürgertum sich zu emanzipieren und die Physiognomie seiner Städte zu formen beginnt, fällt Neapel unter die Herrschaft der Normannen — der ersten jener Kette fremdländischer Dynastien, die von nun an bis zur Einigung Italiens die Geschicke der Stadt in ihrer Hand behalten sollte. Die vorangehende Zeit aber, die eigentlich heroische Epoche des selbständigen Herzogtums Neapel (763 bis 1139), hat im Stadtbild überhaupt keine Spuren hinterlassen. Wir wissen nur, daß der antike Mauerring, durch Kaiser Valentinian III. (450-455) erneuert, nach Südwesten erweitert (Via Sedile del Porto — S. Maria la Nova — Donnalbina — Calata Trinità Maggiore — Gesù Nuovo — S. Pietro a Maiella) und von den byzantin. Statthaltern weiter befestigt, alle Stürme der Völkerwanderung überdauert hatte; in seinem Schutz bot Neapel noch immer das Bild einer »quasi graeca urbs«, deren soziale wie bauliche Strukturen sich nur allmählich mit christlich-mittelalterlicher Substanz zu durchsetzen begannen. Den Hauptplatz bildete wohl noch lange Zeit das alte Forum mit seinen in Kirchen umgewandel-
ten Tempeln und der Curia als dem Versammlungsort der Stadtoberhäupter. Der Palast der Herzöge lag auf dem Monterone, in der Gegend von SS. Marcellino e Pietro; zu seinen Füßen das Arsenal, die Basis der mächtigen Kriegsflotte, der die Aufgabe zufiel, Italiens tyrrhenische Küsten vor dem Zugriff der Sarazenen zu schützen (Seesieg bei Ostia, 839). Im Jahre 902 hören wir von einer neuen Stadterweiterung nach Südwesten, die das Gebiet zwischen S. Maria la Nova, Rua Catalana und S. Pietro Martire einschloß. Einzelne Kirchen und Klöster, auch Wohnhäuser, waren außerhalb der Mauern entstanden; die zwischen Südmauer und Hafen gelegene Junctum Civitatis wurde durch eine Vormauer (Muricinus) gesichert, in deren Schutz sich ein lebhaftes Geschäfts- und Handwerkerviertel (Borgo moricino) entwickelte.
Als eigentliche Zentren des städtischen Lebens erscheinen seit dem Ausgang der Antike die Seggi oder Sedili, auch Tocchi genannt (vom griechischen thokos = Sitz), offene Portiken oder Loggien, in denen die angesehensten Bürger eines Bezirks sich zur Beratung versammelten. Ursprünglich rein demokratische Selbstverwaltungsorgane, die sich aus den Bruderschaften (Phratrien) der griechischen Polis entwickelt hatten, nahmen die Seggi mit dem Aufstieg des Feudalismus immer stärker den Charakter aristokratischer Standesvertretungen an; die Familien der »Nobilità di Sedile« repräsentierten die oberste Schicht des städtischen Patriziats. Beim Regierungsantritt Karls I. von Anjou bestanden 6 große und 23 kleine Seggi; unter Robert d. Weisen war ihre Zahl auf 5 zurückgegangen. Der vornehmste war der Seggio di Nido oder Nilo (auch tocco maggiore, toccum capitis plateae) bei S. Angelo a Nilo, der um 1500 einen von Sigismondo di Giovanni entworfenen Neubau erhielt (s. S. 37 u. 568). Unterhalb von SS. Severino e Sossio, zwischen der Via Salvatore de Renzi und dem »Rettifilo«, befand sich der Sitz von Portanova, an der Via dei Tribunali der Seggio Capuano (2 Bögen der alten Loggia sind heute in der Front des Settecento-Palastes Via dei Tribunali 169 zu sehen); am Westabschnitt der gleichen Straße, zwischen S. Paolo Maggiore und S. Angelo a Segno, der Seggio della Montagmz, der zu Beginn des 14. Jh. den von Forcella in sich aufnahm; der Sedile di Porto lag ursprünglich in der gleichnamigen Straße unterhalb von S. Giovanni Maggiore, seit 1472 am Largo Medina.
Als gleichberechtigte Vertretung der unteren Schichten des Bürgertums (Zünfte, Gewerkschaften) wurde, nach langen Kämpfen, im 15. Jh. der Seggio del Popolo (»la Piazza«) anerkannt, zusammengesetzt aus den »Ottine« (achtköpfigen Räten) von 29 Stadtbezirken; sein Amtssitz befand sich an der alten Strada della Selleria bei S. Agostino della Zecca, später im dortigen Augustinerkonvent. Ein aus Bevollmächtigten der Seggi gebildeter Stadtrat, das Tribunale di S. Lorenzo, tagte seit altersher am Forum, im Konvent von S. Lorenzo Maggiore. Seggi und Tribunale bestanden und funktionierten bis in die Napoleonische Zeit; erst nach der Revolution von 1799 verfügte Ferdinand IV. die Auflösung dieser vielleicht ältesten gemeindepolitischen Institutionen des Abendlandes.
Der erste Herrscher, der nachhaltig in Neapels Verhältnisse eingreift, ist der Staufer-Kaiser Friedrich II.: Er befiehlt eine umfassende Erneuerung des (von Heinrich VI. geschleiften) Stadtmauerrings und macht die Stadt 1224 zum Sitz seiner Reichsuniversität, die alte Tradition der »docta Parthenope« zu neuem Leben erweckend.
Bedeutende Veränderungen vollziehen sich unter der Regierung der Anjou, die im Jahre 1266 Neapel in Besitz nehmen und zur Hauptstadt des Königreichs beider Sizilien erheben. Ihre großen gotischen Kirchenbauten (S. Eligio, S. Lorenzo, S. Maria la Nova, S. Domenico, Dom, S. Pietro Martire, S. Chiara, SS. Annunziata, S. Agostino) verleihen der Stadt einen neuen monumentalen Aspekt; seit 1279 entsteht am Hafen das Castel Nuovo, nach den Normannenburgen Castel dell’Ovo und Castel Capuano der dritte feste Punkt der Stadt; unmittelbar nördlich ein elegantes Adelsquartier, das gegen die Mitte des 15. Jh., im Konflikt zwischen Alfons V. von Aragon und Johanna II., kriegerischer Verwüstung zum Opfer fiel. Karl II. erweitert die Mauern nach Westen bis zur Port’Alba (Piazza Dante); Robert d. Weise läßt 1329 auf der Höhe des Vomero das Belforte (Castel S. Elmo) errichten. Der Hafen wird weiter ausgebaut, die Junctura Civitatis, die sich mit ihren Handelsniederlassungen aus allen Städten des Mittelmeers bis in die Gegend von S. Maria del Carmine erstreckt, endgültig in das Stadtgebiet einbezogen.
Das Wachstum der Stadt nach Osten setzt sich unter den Aragonesen fort, die 1484 den mit 22 Rundtürmen
bewehrten, z. T. noch erhaltenen Mauerzug S. Maria del Carmine (Forte dello Sperone) — Corso Garibaldi (Porta Nolana) — Piazza Umberto — Via Rosaroll — Porta Capuana — S. Giovanni a Carbonara — Porta S. Gennaro anlegen lassen. Ein anderer neuer Mauerabschnitt wird 1499-1501 am Westrand der Stadt gebaut, von der heutigen Piazza Dante entlang der Via Roma nach Süden laufend, um bei S. Brigida zum Castel Nuovo zurückzubiegen. Seit 1487 entfaltet Herzog Alfonso, der älteste Sohn Ferrantes I., eine glänzende Bautätigkeit: Jenseits des Castel Capuano, zwischen S. Caterina a Formiello und S. Pietro ad Aram, entsteht eine La Duchesca genannte prachtvolle Garten- und Villenanlage; auf dem östlich vorgelagerten Hügel von Poggio Reale errichtet der aus Florenz herbeigerufene Giuliano da Maiano ein in aller Welt berühmtes Lustschloß, das mit seinen bis zum Meer hinabreichenden Gärten den Höhepunkt quattrocentesker Villenbaukunst bezeichnet. Beide Anlagen sind spurlos verschwunden: die erstere wurde noch im Laufe des 16. Jh. zerstört und mit Wohnvierteln überbaut; die andere fiel als spanisches Kroneigentum im Laufe der Zeit fortschreitender Verwüstung anheim und wurde zu Beginn des 19. Jh. durch den städtischen Friedhof ersetzt, der sich heute noch dort befindet. Nicht viel besser erging es 2 kleineren Landvillen des Herzogs am Abhang von S. Potito (s. S. 349) und an der Chiaia (Spuren von dieser in dem Wohnhaus Largo Ferrandino 48, zwischen Via dei Mille und Riviera di Chiaia). Unausgeführt blieb das große Sanierungsprogramm, durch das Alfonso, auf das Muster der griechischen Straßenführung zurückgehend, seine künftige Residenz zur Idealstadt ummodeln wollte; die kurze Schilderung des Projektes durch Pietro Summonte (1524) bildet ein selten gewürdigtes Dokument zur Geschichte der Urbanistik im Zeitalter des Humanismus. Einen durchgreifenden Wandel des Stadtbildes bringt erst die Herrschaft der spanischen Vizekönige (seit 1504), welche die Macht des ländlichen Feudaladels brechen, die Aristokratie an den Hof ziehen und so die Entwicklung Neapels zur modernen Hauptstadt einleiten. Die anhaltende Prosperität läßt die Bevölkerung eruptionsartig anschwellen; im Laufe weniger Jahrzehnte bedecken sich die ehemals grünen Anhöhen im Westen der Stadt mit Häuservierteln. Seit 1533 sind neue Stadtmauern im Bau, die den
Pizzofalcone, die Höhen von Chiaia bis S. Maria Apparente und die Abhänge des Vomero (Monte Calvario, Montesanto) umschließen; außerhalb der Mauern bildet sich, allen Verboten zum Trotz, ein Kranz von Sobborghi (Vorstädten): im Westen Chiaia, im Nordwesten Avvocata und Pontecorvo, im Norden Vergini, im Nordosten S. Antonio Abate, im Osten Loreto. Der große Stadtplaner unter den Vizekönigen ist Don Pedro Alvarez de Toledo (1532-53), der mit dem seinen Namen tragenden Straßenzug (heute offiziell Via Roma genannt) dem neuen Neapel sein Rückgrat gibt. Durch einschneidende neue Steuergesetze verschafft er sich die Mittel, die verwahrlosten Straßen der Altstadtquartiere — »di poco decoro di si nobile città« — zu reinigen, zu begradigen und zu nivellieren, z. T. auch zu pflastern; in den neu entstehenden Vierteln werden breite Verkehrsadern angelegt (Via S. Lucia, Via Chiaia). Wo möglich sucht man Anschluß an das antike Straßennetz: So wird der Decumanus Inferior schnurgerade nach Westen fortgesetzt (Piazza Gesù Nuovo — Via D. Capitelli — Via P. Scura) und bildet nun jene erstaunliche, nahezu 2 km messende Straßenschlucht, die der Volksmund mit dem plastischen Namen Spaccanapoli (spaccare = spalten) belegt hat. Die anderen beiden Decumani freilich sind bereits durch Konvente und Kirchenbesitzungen blockiert, jene »isole sacrali«, deren ständige Vermehrung und Ausweitung bis heute eines der ernstesten Hindernisse jeder urbanistischen Initiative im Innern Neapels dargestellt hat. Die eigenen Bauunternehmungen der Vizekönige beschränken sich auf die Errichtung des (später wesentlich erweiterten) Palazzo Reale und eines neuen Universitätsgebäudes (Palazzo degli Studi, heute Museo Archeologico Nazionale).
Eine Kette sozialer und natürlicher Katastrophen, die Neapel im 17. Jh. heimsucht (1624 Hungersnot, 1631 Vesuv-Ausbruch, 1647 Masaniello-Revolte, 1656 Pest, 1688 Erdbeben), kann das Wachstum der Stadt nicht aufhalten. Westlich des Toledo wachsen über engmaschigem Schachbrettgrundriß die ursprünglich zur Ansiedelung von Soldaten bestimmten Quartieri auf. Ihre rationalistisch-großstädtische Wohnblockarchitektur wird bald auch in anderen Massenquartieren des Zentrums nachgeahmt. Ungepflasterte, konglomeratartig umbaute Hinterhöfe — die sog. fondaci, neapolitanisch »fúnneci« — dienen vielköpfigen Handwerker-
familien als Schlaf- und Arbeitsstätten; die Straßenfronten enthalten zu ebener Erde die charakteristischen bassi, fensterlose Einzimmerwohnungen, durch deren stets geöffnete Türen Bewohner wie Einrichtungsgegenstände unaufhaltsam ins Freie dringen. Gleichzeitig aber entfaltet sich, mit wachsendem Wohlstand des Bürgertums, jener spezifisch neapolitanische Sinn fürs Dekorative, dem das Straßenbild der Innenstadt seinen heute nur noch in verkommenen Überresten zu ahnenden farbigen Reiz verdankt. Stuck, Marmor und glasierte Majolika verleihen auch älteren Bauten außen wie innen ein neues Gesicht; »wie die tropische Vegetation indische Tempel überwuchert hat«, schreibt Carl Justi, »so bedeckt nun der Barockstil alles«. Eine Schule glänzend begabter Maler, die sich mit unbegreiflicher Leichtigkeit die Errungenschaften der Römer, Lombarden und Emilianer aneignen, erfüllen Kirchen und Paläste mit ihren Bildern und verbreiten den Ruhm Neapels als Kunststadt in Europa.
Adels-und Bürgerhäuser nehmen jetzt repräsentative Formen und Ausmaße an; das aufkommende Rokoko bereichert die Stadt um die skurrile Kulissenwelt ihrer Treppenhäuser. Es ist die erste eigene, nicht vom Hof importierte Kunst, die Neapel hervorgebracht hat — und zugleich die vollkommenste Absage an die zeitgenössische Ideologie von Fürstenmacht und Staatsräson. Ihr Gehalt ist ganz sinnlich-konkret, ihre tiefsten Interessen sind der Genuß der Welt und des eigenen Daseins: Lebenskunst eines Volkes, das nie (wie Florenz und Venedig) politisch mündig war, nie auch (wie Rom) ein historisches Erbe zu tragen hatte.
Erst unter der Herrschaft der Bourbonen (seit 1734) erhält das inzwischen mehrere Hunderttausend Einwohner zählende Neapel moderne öffentliche Bauten, die seinen Hauptstadtrang zum Ausdruck bringen. So entstehen das Teatro S. Carlo nahe dem königlichen Palast, der Albergo dei Poveri an der neu angelegten Via Foria, die riesigen Granili (Kornspeicher) am Osthafen (heute abgebrochen) und das Schloß von Capodimonte; die Via Toledo wird zwischen 2 monumentale Platzanlagen, das Foro Carolino (Piazza Dante) und das Foro Ferdinandeo (Piazza del Plebiscito), eingespannt; der Marktplatz des Hafenviertels (Piazza del Mercato) wird neu gestaltet; am Chiaia-Ufer entsteht der von Goethe bewunderte »unermeßliche Spaziergang« der Villa Reale (Villa Comunale). Ein französischer
Reisender aus der Mitte des 18. Jh., der Kammerpräsident Charles de Brosses, findet die Stadt zwar »zum Bersten übervölkert und fühlt sich vom Anblick des Pöbels »zum Brechen abgestoßen«, genießt aber auch »den Verkehr, das Zuströmen des Volkes, das nicht aufhörende Rollen der Equipagen, eine wirkliche Hofhaltung, die Lebensart und Prachtliebe der großen Herren: alles zusammen gibt Neapel das Schillernde und Lebendige, wie London und Paris es haben, Rom es durchaus entbehrt«.
Unter Joseph Bonaparte und Joachim Murat (1806-15) wird die das Valle della Sanità überbrükkende Verbindungsstraße nach Capodimonte gebaut (Corso Napoleone, heute Amadeo di Savoia), die Via Foria verbreitert und der Botanische Garten eingerichtet; in die Zeit der Bourbonischen Restauration fällt die Anlage der ersten modernen Höhen-und Aussichtsstraße, des kurvenreichen Corso Maria Teresa (heute Vittorio Emanuele), dessen Eröffnung Gregorovius miterlebt und mit unvergleichlicher Anschaulichkeit geschildert hat. Seine Worte mögen dem heutigen Reisenden einen Begriff davon geben, wie sich die Stadtlandschaft von Neapel vor dem Aufkommen des motorisierten Straßenverkehrs dem Spaziergänger darbot: »Seit dem 18. Mai 1853 ist landeinwärts noch eine Straße für die Bewegung des Volkes eröffnet worden, die Strada Teresa, von dem jetzigen Könige angelegt und zu Ehren seiner Gemahlin so genannt. Sie führt in einer Parabole um das Castel Sant Elmo durch Hügel und Täler über den Vomero und mündet dann auf die Chiaia. Reiter, zu Pferd, auf Eseln und Maultieren, sprengen darauf einher, und Scharen von Fußgängern durchziehen die Anlage, zumal an den Sonn-und Festtagen. Es scheint, als habe das Leben dieser ungeheuren Stadt sich durch die Berge ein neues Bett gewühlt, um sich dann vom Vomero wieder auf die Chiaia zu ergießen... Hier wechseln die Ansichten der Stadt, des Golfs, der Berge und Inseln mit jeder Wendung des Weges, mit jedem Hügel und Tal; man weiß nicht wohin schauen, in diese blauen Meeresfernen, auf dieses lichtumflossene Amphitheater der Stadt, oder in jene üppigen Gärten mit heitern Villen und auf jene malerischen Gruppen von Pinien, Palmen und Zypressen ... Das ungefähr würde unser Auge nacheinander festhalten: Castel Sant Elmo mit seinen weißen Mauern auf gelbbraunen Felsen, von Kakteen
und Aloe umwuchert, von grünen Ranken umschlungen; Gärten in der Tiefe, nun an einer Schenke vorüber, welche ganz in Weingewinden begraben liegt; wieder braune wüste Tuffelsen; ein Tal von Zitronen-, Tulpenbäumen, Granaten, ein narkotisch süßer Duft überall; wieder eine Vorstadt mit städtischem Getriebe; wieder freie, lachende Hügel, Blicke auf Landhäuser; eine Schlucht mit Kaktus und Palmen; ein plötzlicher Blick auf die Stadt zur Linken, auf den Golf, auf Capri; ein Hain von Pinien, über welchem der Vesuv in dem zartesten Violett schwebt. Wieder eine wilde Felsenpartie; darauf Gärten mit bizarren Landhäusern mit offenen Hallen. Eine ländliche Szene, Hirten, welche Ziegen treiben ... ach, wer kann alle jene schönen Bilder nennen!« Seit 1860, dem Jahre der Vereinigung mit dem italienischen Königreich, zeigt die städtebauliche Entwicklung Neapels ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite eine stetig anschwellende Expansionsbewegung, die zur Bildung immer neuer Vororte führt, während moderne Verkehrsmittel (Seilbahnen, Untergrundbahnen) die einzelnen Teile des Stadtgebietes enger aneinanderbinden; die Hügel (Pizzofalcone, Posillipo) werden von Straßentunneln unterminiert; durch die Innenstadt ziehen sich neue Verkehrsadern, so vor allem der das Straßenmuster des alten Zentrums schräg durchschneidende »Rettifilo« (Corso Umberto I.) zwischen Bahnhof (Piazza Garibaldi) und Piazza del Municipio, der Corso Garibaldi vom Bahnhofsplatz zum Hafen und die verbreiterte Via del Duomo; der Corso Vittorio Emanuele wird durch die Via Salvator Rosa an den Toledo angeschlossen, mit der Via Tasso auf den Posillip hinaufgeführt; Via Parteriope und Via Caracciolo bilden die neue Uferlinie der westlichen Viertel. Die Kehrseite dieses imponierenden Wachstums liegt im Verfall jener in Jahrhunderten gewachsenen vorindustriellen Großstadtstruktur, deren auf Handwerk und Kleinhandel, Fischfang und Gartenkultur gegründetes Wirtschaftssystem unter den Bedingungen der modernen Welt zum Absterben verurteilt ist. Unaufhaltsam sinken weite Zonen der Altstadt zu Elendsquartieren herab, das lebensvolle Durcheinander geht in einen Zustand allgemeiner Verwahrlosung über, die nichts Malerisches mehr an sich hat. So liegt über dem Bild des moder-
nen Neapel als einer äußerlich prosperierenden Hafen- und Industriestadt doch auch ein Zug von Resignation; die Spontaneität des südlichen Daseins scheint gebrochen, das berühmte »Straßenleben« ist tot, der Glanz der Volksfeste ist erloschen oder wird nur künstlich am Leben erhalten. In den letzten Jahren des 2. Weltkriegs wurde Neapel von schweren Luftangriffen heimgesucht und wie keine andere Großstadt Italiens in seiner monumentalen Substanz dezimiert; der Wiederaufbau der Nachkriegsjahre hat erstaunliche Energien freigesetzt, zugleich aber wahre Exzesse der Bauspekulation entfesselt, die das Panorama des Golfes für immer beschädigt haben. Um so mehr wird der Kunstfreund die Leistungen der Denkmalpflege- und Museumsbehörden bewundern, denen Neapel die Rettung und Sicherung großer Teile seines unermeßlichen Kunstbesitzes zu danken hat.
Normannen
1130 ROGER 1097-1154
1154 WILHELM I. 1120?-1166
1166 WILHELM II. 1152-1189
1189 TANKRED ?-1194
Staufer
Friedrich I. Barbarossa
1194 HEINRICH VI. 1165-1197 oo Konstanze
1198 FRIEDRICH II. 1194-1250
1250 KONRAD IV. 1228-1254
1254 MANFRED 1231-1266
Konradin 1252-1268
Anjou
1265 KARL I. 1226?-1285
1285 KARL II. 1248-1309
1309 ROBERT d. Weise 1275-1343
Johann v. Durazzo
Karl v. Kalabrien 1298-1328
1343 JOHANNA I. 1326-1382
Ludwig v. Gravina
Aniou-Durazzo
1381 KARL III. 1345-1386
1386 LADISLAUS 1376-1414
141 JOHANNA II. 1371-1435
René v. Lothringen
Aragon
Ferdinand I. v. Aragon
1442 ALFONS I. 1385-1458 (von Johanna II. adoptiert; als König v. Aragon Alfons V.)
Johann II. v. Aragon
1458 FERDINAND I. (Ferrante) 1423-1494 oo Johanna
1494 ALFONS II. 1448-1495
1495 FERDINAND II. (Ferrandino) 1469-1496
1496 FEDERICO 1452-1504
Spanien (Haus Aragon)
(Johann II. v. Aragon)
1503 FERDINAND III. d. Kath. 1452-1516 (als König v. Spanien ab 1512 Ferd. II./V.)
Maximilian I. (Dt. Kaiser)
Johanna v. Kastilien oo Philipp I. d. Schöne
(Haus Habsburg)
1516 KARL V. 1500-1558 (Dt. Kaiser, als König v. Spanien Karl I.)
1556 PHILIPP II. 1527-1598
1598 PHILIPP III. 1578-1621
1621 PHILIPP IV. 1605-1665
1665 KARL II. 1661-1700
Maria Theresia oo Ludwig XIV v. Frankreich
Ludwig Dauphin v. Frankreich
(Haus Bourbon)
1700 PHILIPP V. oo Elisabeth Farnese 1683-1746
Österreich
(Haus Habsburg)
1713 KARL III./VI. 1685-1740 (Dt. Kaiser, letzter männlicher Habsburger)
Bourbon von Neapel
1734 KARL I. 1716-1788 (als König v. Spanien ab 1759 Karl III.)
1759 FERDINAND IV. 1751-1825 (ab 1815 FERDINAND I.)
1799 Repubblica Partenopea (Januar-Juni)
1806 JOSEPH BONAPARTE 1768-1844
1808 JOACHIM MURAT 1771-1815
Rückkehr der Bourbonen
1825 FRANZ I. 1777-1830
1830 FERDINAND II. 1810-1859
1859 FRANZ II. 1836-1894
Königreich Italien
Kirchen, Klöster, Oratorien und einzeln stehende Kapellen werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach ihren gebräuchlichsten Namen (im allgemeinen dem Namen des Titelheiligen) aufgeführt. Wer sie besichtigen will, muß sich mit der Tatsache vertraut machen, daß die Öffnung der kleineren Pfarr- und Klosterkirchen meist auf die Zeit der Frühmesse, zwischen 6.30 und 8.30 Uhr, beschränkt ist; nur die Hauptkirchen bleiben tagsüber zugänglich (Mittagsschließung von 12 bis 16 oder 17 Uhr). Von den zahlreichen Oratorien und Privatkapellen der alten Stadtviertel werden einige von Laienbruderschaften (Congreghe) betreut, die sich am Sonntagmorgen, oft auch nur an bestimmten Festtagen, dort versammeln; viele andere sind wegen Baufälligkeit oder allgemeiner Verwahrlosung dauernd verschlossen.
Die interessantesten Leistungen des Kirchenbaus in Neapel gehören 3 weit auseinanderliegenden Epochen an: der frühchristl.-byzantinischen, der gotischen und der des Barock. In den Zwischenzeiten ist wenig Bemerkenswertes entstanden.
Eine roman. Architektur scheint es kaum gegeben zu haben; die Bauten der Renaissance, soweit noch sichtbar, zeigen nur selten eigenständige Züge; die Hauptleistungen des Klassizismus liegen auf dem Gebiet des Wohnbaus. Als eine spezifisch neapolitan. Schöpfung der frühchristl. Zeit gilt die von Arkaden durchbrochene Apsis (S. Gennaro extra moenia, S. Giorgio Maggiore, S. Giovanni Maggiore). Für den Kuppelbau über quadratischem Grundriß bietet das Dombaptisterium ein frühes Beispiel; der Typus der byzantin.
Kreuzkuppelkirche hat sich nur in seiner mittelalterl. Version erhalten (Capri, S. Costanzo). Die Gotik hat ihre charakteristischen Formen einmal in der Basilika mit holzgedecktem Mittelschiff und kreuzrippengewölbten Seitenschiffen entwickelt (S. Eligio, S. Lorenzo I, S. Domenico, Dom), zum anderen im flachgedeckten 1schiffigen Saalbau (S. Lorenzo II, S. Maria del Carmine, S. Pietro Martire, S. Chiara).
Im Barock hebt sich aus der Vielzahl der Typen und Gattungen eine besondere Neigung zum zentralen (»griechi-
schen«) Kreuzbau heraus: gegen 1600 »wiederentdeckt«, wird er von da an mit wunderlicher Zähigkeit festgehalten und durch alle möglichen Kombinationen mit dem Längsbau hindurchgerettet. Die klassischen Muster schuf Francesco Grimaldi in der Tesoro-Kapelle des Domes (Zentralkuppel über 4 kurzen Tonnenarmen) und in der 1622 begonnenen, heute verschwundenen Kirche 8. Francesco di Paola a Porta Capuana (Hauptkuppel auf 4 Pfeilern, tonnengewölbte Kreuzarme und Nebenkuppeln in den Eckräumen — zur Vorgeschichte vgl. Gesù Nuovo und S. Maria della Sanità).
Dem ersten Typus folgen, mehr oder minder frei, im 17. Jh. S. Giuseppe dei Vecchi, Trinità delle Monache, Ascensione a Chiaia, S. Maria della Vittoria und S. Maria dell’Aiuto; im 18. Jh. S. Maria del Divino Amore, S. Maria della Colonna, Madonna del Rosariello, S. Francesco all’Arco Mirelli, S. Giuseppe dei Nudi, S. Tomaso a Capuana, S. Raffaele und S. Croce al Mercato. Zur zweiten Gruppe gehören im 17. Jh. S. Giorgio Maggiore und S. Maria Maggiore, im 18. Jh. S. Maria Apparente und S. Pasquale, im 19. Jh. noch die Immacolata Concezione a Pizzofalcone. Als Abwandlung dieses Typus ist der 4-Pfeiler-Bau mit horizontal unterteilten Eckräumen (Coretti) anzusehen: S. Teresa a Chiaia und S. Maria dei Monti, Concezione a Montecalvario und SS. Giovanni e Teresa. Die Tendenz zur Mischung von Längsund Zentralform zeigt sich weiterhin in zahlreichen Ovalbauten: S. Sebastiano, S. Carlo all’Arena, S. Maria della Sanità (Kreuzgang), S. Maria Egiziaca a Forcella, S. Maria di Caravaggio, S. Vincenzo dei Paoli, S. Pietro in Ischia Porto. Aufmerksamkeit verdient ferner das häufige Auftreten 2geschossiger Vorhallenfassaden (Hauptbeispiele: S. Gregorio Armeno, S. Sebastiano, S. Potito, Ascensione a Chiaia, S. Giovanni Battista); eine sehr reizvolle lokale Variante stellt schließlich die Treppenvorhalle dar (S. Maria della Stella, S. Maria della Sapienza, Gesù delle Monache, S. Giuseppe del Ruffo und Madonna del Rosariello).
Hauptsehenswürdigkeiten: S. Angelo a Nilo, Brancaccio-Grab (Michelozzo/Donatello), S. 38 — S. Anna dei Lombardi, Renaissance-Skulpturen (Santacroce, Giov. da Nola, Kossellino, B. da Maiano, Mazzoni), S. 44 ff. — SS. Annunziata (Vanvitelli), S. 52 — Ascensione a Chiaia, Altarbilder S. Angelo a Nilo, Grabmal des Rinaldo Brancaccio: Mariä Himmelfahrt (Donatello) S. Anna dei Lombardi, Beweinung Christi: Kopf des Joseph von Arimathia (G. Mazzoni)
(Giordano), S. 64 — S. Chiara (14. Jh.), S. 71; Anjou-Gräber (Tino di Camaino u. a.), S. 77 ff.; Chiostro delle Maioliche (D. A. Vaccaro), S. 83 — Concezione a Montecalvario (D. A. Vaccaro), S. 87 — S. Domenico Maggiore, Osterleuchter (Tino di Camaino), S. 97; Altarbilder (Tizian, Caravaggio), S. 96 f. — S. Filippo Neri (Dosio), S. 104; Fresko (Giordano), S. 106 — S. Francesco di Paola (Bianchi), S. 110 — Dom, S. Restituta: Madonnenmosaik (14. Jh.), Reliefplatten (12./13. Jh.), S. 118; Baptisterium: Mosaiken (5. Jh.), S. 120; Succorpo (Malvito), S. 122; Schatzkapelle: Fresken und Altarbilder (Domenichino, Lanfranco, Ribera), S. 127 f. — Gesù Nuovo (Valeriani), S. 137; Fresko (Solimena), S. 141 — S. Giacomo degli Spagnuoli, Grabmal Don Pedro di Toledo (Giov. da Nola), S. 145 — S. Giovanni a Carbonara, Freitreppe (Sanfelice), S. 153; Kapellen und Grabmäler des 15. und 16. Jh., S. 155 ff. — S. Gregorio Armeno (17. Jh.), S. 169 — S. Lorenzo Maggiore (13./14. Jh.), S. 173; Grabmal Katharina von Österreich (Tino di Camaino), S. 178 — S. Maria di Donnaregina (14. Jh.), S. 192; Grabmal Maria von Ungarn (Tino di Camaino), S. 195; Fresken (Cavallini u. a.), S. 197 — S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone (Fanzago), S. 200 — S. Maria del Parto, Grabmal Sannazzaro (Montorsoli, Ammannati), S. 215 — S. Maria della Stella, Altarbild (Caracciolo), S. 226 — S. Martino (Certosa), Histor. Museum: Tavola Strozzi, Weihnachtskrippen, S. 231, 234; Belvedere, S. 231; Kreuzgang (Dosio/Fanzago), S. 234; Gemäldegalerie (Rosa, Ribera, Giordano), S. 235; Skulpturensammlung (Tino di Camaino, P. Bernini), S. 237; Kirche: Fresken, Altarbilder (Lanfranco, Ribera, Stanzione, Caracciolo, Reni), S. 238; Schatzkapelle: Fresko (Giordano), Altarbild (Ribera), S. 242 — Monte della Misericordia, Altarbilder (Caravaggio, Caracciolo, Giordano), S. 246 f. — Nunziatella (Sanfelice/Mura), S. 251 — S. Paolo Maggiore (Grimaldi), S. 254; Fresko (Solimena), S. 255 — S. Pietro a Maiella, Deckenbilder (Preti), S. 260 — Capp. Sansevero, Skulpturen (Corradini, Queirolo, Sammartino), S. 267 f.
S. Agnello Maggiore (auf dem Hügel von »Caponapoli«‚ südostwärts des Nationalmuseums) heißt nach einem neapolitan. Heiligen des 6. Jh. Die Gründungsgeschichte des im Mittelalter bedeutenden Klosters reicht ins 9. Jh. zurück; der Bau der Kirche wurde zu Anfang des 16. Jh. erneuert, im 18. Jh. innen umgestaltet. Schon seit Jahrzehnten wegen Baufälligkeit geschlossen, wurde die Kirche im 2. Weltkrieg von Bomben schwer getroffen und bildet heute eine unzugängliche Ruine.
S. Agostino degli Scalzi (S. Maria della Verità; am Vico lungo di S. Agostino, schräg gegenüber von S. Teresa degli Scalzi, auf einem der südl. Ausläufer des Hügels von Capodimonte)
Im 16. Jh. war der Grund noch unbebaut; inmitten eines Olivenhains hauste ein Einsiedler, der eine kleine Marienkapelle betreute. Gegen Ende des Jahrhunderts erhielt er Zuzug durch einige Mönche von S. Agostino della Zecca, welche die aus Spanien eingeführte Barfüßerregel angenommen hatten. Man errichtete einen kleinen Konvent und anschließend, in der 1. Hälfte des 17. Jh., die heute bestehende Kirche.
Architekt war Giacomo Conforto, der kurz zuvor die benachbarte Theresianerinnenkirche (S. 276) begonnen hatte. Der Bautypus ist der gleiche wie dort; die Zahl der Seitenkapellen hat sich auf 3 vermindert; dafür sind in die trennenden Wandpfeiler kleine Zwischenkapellen eingelassen, die mit den großen kommunizieren und so eine rhythmisch bewegte Folge von Nebenräumen bilden, wie Confortos Lehrer oder Vorbild Francesco Grimaldi sie etwa in S. Maria della Sapienza entwickelt hatte. Erfreulich gut hat sich die urspr. Stuckdekoration erhalten, die immer noch die von Dosio (S. Filippo Neri) eingeführten Hochrenaissancemotive ausbeutet; in der Kuppel die leichteren, eleganteren Formen des Settecento; Zwickel und Tonnenarme des O-Teils klassizistisch (jetzt alles weiß übertüncht).
Die Kirche enthält 2 bedeutende Werke des »Cavaliere Calabrese« Mattia Preti: in der 1. Kapelle links eine figurenreiche Madonna von Konstantinopel (1656), gegenüber, in der 1. Kapelle rechts, die dramatisch großartige Rettung des hl. Franz von Paola aus Seenot, mit der himmlischen Erscheinung der Hl. Dreifaltigkeit.
Die seitlichen Bilder ebendort (die hll. Hieronymus und Nikolaus von Tolentino) sind von Agostino Beltrano (1649). — In der 2. Kapelle rechts eine Huldigung Luca Giordanos an Veronese: Der hl. Thomas von Villanova verteilt Almosen an eine schwungvoll aufgebaute Gruppe von Armen und Siechen; in Lichtwolken schwebende Engelchen halten derweilen seinen Bischofsstab. — Von demselben eine herrliche, aus rauchiger Atmosphäre sich konkretisierende Engelsvision des hl. Nikolaus von Tolentino am rechten Querschiffaltar (1658). — In der Kapelle rechts vom Chor eine durch dicke Staubschichten unkenntlich gewordene Goldgrundmadonna des 15. Jh.; links daneben ein schönes kleines Madonnenbild Stanziones, das stark von Tizian, viell. auch Lorenzo Lotto inspiriert erscheint. — An der Rückwand der Apsis Verkündigung und Heimsuchung von Giacomo del Pò (1693); an den Seitenwänden Anbetung der Hirten und Könige von dem Solimena-Schüler
und -Nachahmer Andrea d’Aste (1710). — Schöne Marmoraltäre und Grabmäler. — In einem Nebenraum der Sakristei Lünettenfresken mit Bildern aus der Geschichte der Barfüßeraugustiner (um 1600).
S. Agostino della Zecca oder Maggiore (an der gleichnamigen Straße, die vom »Rettifilo« zur Via Vicaria Vecchia aufsteigt)
Gegenüber (Nr. 58) der Palast der königlichen Münze (Zecca), 1681 errichtet und im 18. und 19. Jh. restaur.
Seit normannischer Zeit befand sich an dieser Stelle ein Nonnenkloster‚ das 1259 an die Augustiner überging. Nachdem Karl I. von Anjou den Mönchen weiteren Baugrund für die Vergrößerung ihres Konvents gestiftet hatte, wurde 1301 unter aktiver Förderung Karls II. eine neue, zunächst der Maria Magdalena geweihte Kirche begonnen; die Klosterhauten waren schon 1300 so weit gediehen, daß das Generalkapitel des Ordens sich hier versammeln konnte. Das heute stehende Kirchengebäude, in dem die Grundmaße des Trecento-Baues fortzuleben scheinen, entstand 1641-97 nach einem Entwurf Bartolomeo Picchiattis; erst 1761 fügten Giuseppe di Vita und Giuseppe Astarita Querschiff und Chor hinzu; 1780 endlich erhielt die Eingangsfassade ihre Dekoration.
Unter dem terrassenartig aufgehöhten Vorplatz zieht sich eine Ladenfront mit Rustika-Gliederung und hübscher Rokoko-Balustrade in der Art F. Sanfelices entlang. Der rechts vor der Eingangsfront stehende kompakte Glockenturm stammt noch von Picchiatti: ein gebautes Architektur-Musterbuch, in dem die 4 klassischen Ordnungen — toskanisch, dorisch, ionisch, korinthisch — in ihren Rustika-Versionen vorgeführt werden. Das Innere ist eine Pfeilerbasilika von wahrhaft imposanter Wirkung. Das saalartig abgeschlossene Mittelschiff ist durch pilasterbegleitete korinthische Vollsäulen mit verkröpftem Gebälk gegliedert; die Fenster schneiden als Stichkappen in das Tonnengewölbe ein. Über den Seitenschiffsjochen liegen längsovale Kuppeln von sonderbarer Bildung: In den vom Fußring aufsteigenden Zylinder ist eine Art Kreuzgewölbe eingesetzt, dessen Scheitel von einer kleinen ovalen Laterne durchbrochen wird. — Erst wenn man sich dem Presbyterium nähert, bemerkt man, daß ein wenigstens rudimentäres Querschiff existiert: Das Chorjoch ist von hochgezogenen Abseiten mit laternengeschmückten Hängekuppeln flankiert. Im Mittelschiff sind Chorjoch und Apsis zu einer räumlichen Einheit zusammengezogen, indem eine
einzige parabolisch ansteigende Kuppelschale, die unmittelbar an die Tonne des Langhauses anschließt, beide Teile überwölbt. Sie öffnet sich im Scheitel wieder zu einer großen (im Außenbau beherrschend hervortretenden) Ovallaterne, durch deren 6 Bogenfenster mächtige Ströme von Oberlicht ins Innere dringen. Durch das eigentümliche Ineinanderschwingen der Räume wie auch die fein bewegte Wandbehandlung setzt die O-Partie der Kirche, von den kurvig geführten Stufen des Presbyteriums an, sich deutlich gegen das streng rechtwinklig gegliederte Langhaus ab und gibt sich als Werk des 18. Jh. zu erkennen.
Ausstattung. Im Chor und in der Sakristei hat Giacinto Diana aus Pozzuoli, Schüler Fr. de Muras und einer der letzten Pinselgewaltigen des neapolitan. Settecento (1730-1803), seine inspiriertesten Werke geschaffen. Die beiden gobelinhaft zartfarbigen Chorlailder (1768) behandeln das Leben des hl. Augustinus. Links die Taufe des 33jährigen durch St. Ambrosius, Bischof von Mailand, unter lebhafter Teilnahme eines zahlreichen himmlischen und irdischen Personals. Rechts der Traum des Heiligen vor seiner Bekehrung: Als vornehm gekleideter Jüngling, in der Pose eines ruhenden Hermes, sitzt der künftige Kirchenvater inmitten einer von empfindsamer Stimmung erfüllten Ruinenlandschaft. Während über ihm die Vision des Gottesstaates sich auftut, sinkt ringsum die Welt des Heidentums in den Staub: elegische Meditation über »Decline and Fall of the Roman Empire« hält der christl. Thematik die Waage. Eine verhüllte Frauengestalt, die anbetend zu der himmlischen Erscheinung aufschaut, ist wohl Augustins Mutter Monika, die in der Biographie des Heiligen eine so rührende Rolle spielt. Im Scheitel der Chorapsis, vor einer fensterdurchbrochenen Nische, 3 kolossale Marmorfiguren des 18. Jh.: der hl. Augustinus als Sieger über die Häresie, flankiert von den Allegorien des Glaubens und der Wohltätigkeit. — In der vom rechten Querschiff aus zugänglichen Sakristei zeigt Diana sich als souveräner Dekorateur. Die Eingangswand trägt ein vielfiguriges Historienbild von delikatester Farbigkeit (1776): König David zeigt dem jungen Salomon die für seinen Tempel bestimmten Schätze, ein üppiges Stilleben von Prunkgerät und kostbaren Stoffen; gegenüber am Altar eine Grablegung Christi (1773). — Ein weiteres Bild von Diana, Kalvarienberg (1763), findet sich in der 2. Seitenkapelle des Langhauses links.
Am 3. Langhauspfeiler links eine Holzskulptur, St. Joseph mit dem Jesuskind, von Giuseppe Picano (1771). Am gegenüberliegenden Pfeiler eine vorzügliche Marmormadonna, dem Francesco Laurana zugeschr., über und über mit Exvoto-Gaben behängt. Daneben eine schöne marmorne Kanzel von Vincenzo d’Agnolo (1570).
Die erhaltenen Überreste der alten Konventsgebäude an der S-Flanke der Kirche — ein barocker Kreuzgang und der große Kapitelsaal von 1300, mit 23 Kreuzrippengewölben auf 2 antiken Marmorsäulen mit prächtigen Blattkapitellen des 13. Jh. — gehören heute zu einer schwer zugänglichen Privatwohnung (Corso Umberto 174).
S. Agrippino (Via S. Agostino della Zecca, Ecke Via Vicaria Vecchia). Der Titel der Kirche wird mit einem neapolitan. Bischof des 2. Jh. in Verbindung gebracht. Die frühesten Baunachrichten stammen aus dem 13. Jh., doch scheint sich der alte Bestand im Verlaufe zahlreicher Restaurierungen (zuletzt 1870) vollständig verloren zu haben. Geblieben ist nur ein Paar geschnitzter Türflügel von einem toskanischen Meister (Antonello di Chellino?) aus der 2. Hälfte des Quattrocento. — Das Innere ist stets verschlossen; es enthält ein bedeutendes hölzernes Kruzifix (um 1530, kürzlich restaur.) und eine große Orgel von Tommaso de Martino (17. Jh.).
S. Andrea delle Dame (Piazzetta S. Andrea delle Dame bei S. Maria delle Grazie) gehört heute zur Universitäts-Augenklinik und wird von. dieser leider unter strengstem Verschluß gehalten.
Der einschiffige Rechtecksaal mit zwei Pilasterordnungen und flacher Decke, zwischen 1585 und 1590 entstanden, gilt als erstes neapolitan. Werk des Theatinerarchitekten Francesco Grimaldi (s. S. 254), der sich in jenen Jahren allerdings in Rom aufhielt; die Bauausführung scheint in den Händen seines Ordensbruders Innocenzo Parascandolo gelegen zu haben. Holzdecke von 1761 mit Leinwandbild von Giacinto Diana (1792); Marmordekoration und Statuen (hll. Augustinus und Thomas von Villanova) von Bartolomeo Ghetti (1694); Majolikafußboden von Ignazio Giustiniani (1729); Wandfresken von Corenzio (1591/92); Altarbild (Andreas-Marter) von Filippo Criscuolo.
Sant'Agostino alla Zecca, Innen, Langhaus Richtung Presbyterium, Neapel.
S. Angelo a Nilo (Cappella Brancaccio; im S0 der Piazza S. Domenico Maggiore, an der Ecke Via Mezzocannone/Via S. Biagio dei Librai)
Der Name leitet sich von der Nil-Statue auf dem Largo Corpo di Napoli her (s. u.) und bezog sich ehemals auf das ganze Quartier. Die Stiftung des Kirchleins geht auf Rinaldo Brancaccio zurück, der als Angehöriger einer der ältesten Adelsfamilien der Stadt und Nobile del Seggio di Nido i. J. 1384 zum Kardinal erhoben wurde. 1428 war das Gebäude vollendet, aber noch nicht fertig ausgestattet. Heute sind vom Urbau nur noch die beiden Portale sichtbar: Der Haupteingang an der Via Mezzocannone zeigt noch die Formen der ausgehenden katalanischen Gotik; die nördl. Seitenpforte, mit der Statue des hl. Michael im Bogenfeld, scheint erst nach der Mitte des Quattrocento entstanden zu sein. Neuerdings hat man vermutet, der Bau des 14. Jh. habe nur das heutige Langhaus umfaßt; in der quadratischen überkuppelten Chorapsis steckt möglicherweise die im 12. Jh. erbaute Loggia des Seggio di Nido (vgl. S. 20), die gegen Ende des Quattrocento aufgegeben und danach der Kirche zugeschlagen wurde. 1709 unternahm Arcangelo Guglielmelli eine durchgreifende Restaurierung, die in den oberen Partien (Lichtgaden und Gewölbe, Chorkuppel) einem Neubau gleichkam; auch das Glockentürmchen zur Rechten der Eingangs-
fassade wurde aufgestockt. Eine weitere Restaurierung von 1845 scheint den Charakter des Außenbaus noch einmal in vielen Einzelheiten verändert zu haben.
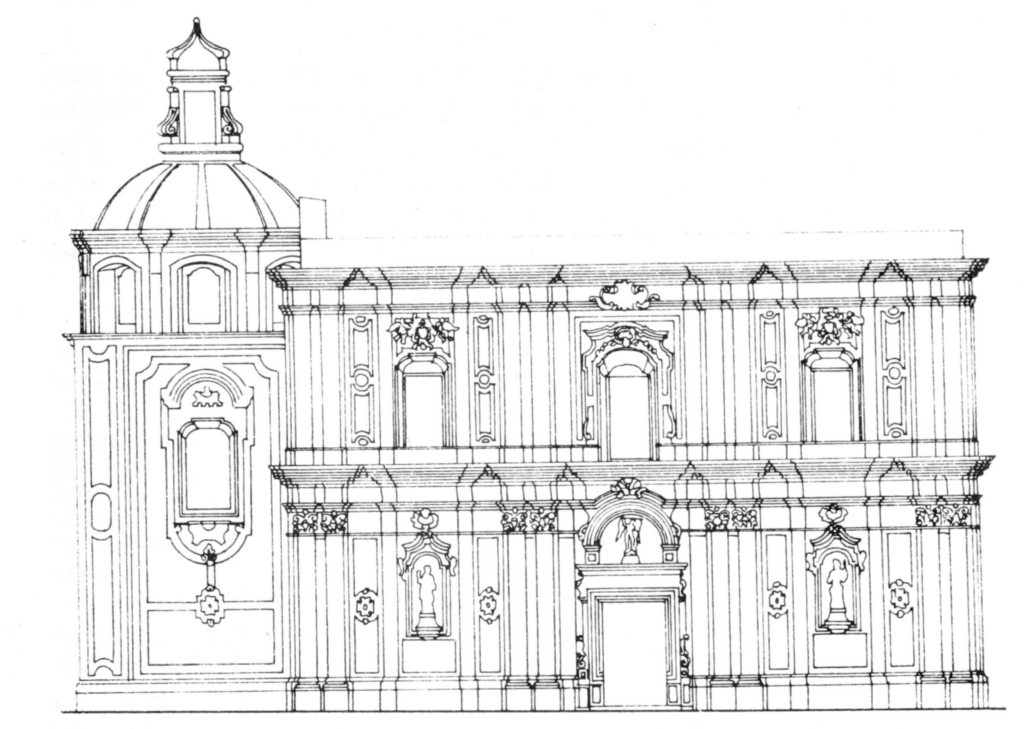 S. Angelo a Nilo. Seitenansicht
S. Angelo a Nilo. Seitenansicht
Gleichwohl blieb der Gesamteindruck einer charakteristischen Architektur des neapolitan. Spätbarock erhalten, die mit ihrem kunstvoll abgestuften Felder- und Schichtensystem wie eine nach außen gewendete Innendekoration wirkt — während andererseits der Innenraum hier mit Säulen, Halbsäulen und Sprenggiebeln streng tektonische Formen zeigt.
Das Innere ist seit einigen Jahren eingerüstet und nicht öffentlich zugänglich; ein Seitenweg durch den Hof des Grundstücks Vico Donnaromita 15 (hinter der Apsis der Kirche) läßt sich vermittels eines Trinkgelds an den dortigen Portier erschließen.
In der Kapelle zur Rechten des Hochaltars findet man das Grabmonument des Kardinals Rinaldo Brancaccio (Tafel S. 32), das schönste Ouattrocento-Grab von Neapel. Es entstand in der von Donatello und Michelozzo gemeinsam betriebenen Bildhauerwerkstatt in Pisa. 1427, im Todesjahr des Kardinals, war es bereits in Arbeit; 1428 wurde es fertiggestellt und nach Neapel verschifft.
Der Typus des Baldachingrabes mit dem von Tugendkaryatiden getragenen Sarkophag, auf dem in vorhanggeschmückter Kammer der Tote liegt, ist immer noch der des Trecento (Tino di Camaino — vgl. S. Maria Donnaregina, S. Chiara); und doch hat die Sprache der Formen sich wie mit einem Schlage verwandelt. Die Front des Baldachins ruht auf 2 zierlichen Kompositsäulen, die Rückseite aber auf flachen, nur optisch noch, »tragenden« Wandpilastern, die den scheinhaft-idealen Charakter des klassischen Stützapparates anschaulich machen. Zur »Ordnung« gehört das zarte und schmale, doch regelrecht aus 3 Teilen gebildete Horizontalgebälk; erst über ihm darf sich der Bogen erheben, ein vollkommener Halbkreis, eingespannt zwischen Doppelpilaster wie in der (später ausgeführten) Fassade der Florentiner Pazzi-Kapelle. Die sonderbar steile Proportionierung des Ganzen, die auf den ersten Blick wie nachlebende Gotik anmutet, gehört in Wahrheit zu den entscheidenden Stilmerkmalen der Frührenaissance; sie entspricht dem Entflechten der Richtungsimpulse — keine horizontalen Unterbrechungen im Bereich der Stützen, aber auch kein Vertikalauftrieb mehr in der Bogenzone —‚ das der Einzelform erst ihre volle Eigenbedeutung zurückgibt. Stracks aufgerichtet, zugleich aber völlig unabhängig von übergreifenden Linienbezügen stehen die Säulen da und gewähren so auch der Plastik des Grabmals neuen Atemraum.
Dies zeigt sich sogleich in Gestik und Haltung wie auch im differenziert realistischen Faltenstil der Figuren. Die 3 Tugenden — nicht mehr durch einzelne Attribute spezifiziert, um so deutlicher aber als lebendige Individuen voneinander abgesetzt — haben sich von ihren Pfeilern emanzipiert und halten den Sarg mit über die Schultern gelegten Tragstangen. In den beiden äußeren Figuren scheint das got. Standmotiv (S-Schwingung, vorgetriebene Leibesmitte) nachzuwirken. Die mittlere dagegen regt sich frei und selbständig; ihre Kopfhaltung ist von antiker Würde (die Finger der rechten Hand sind ergänzt). Aus den vorhanghaltenden Engeln der Totenkammer sind flügellose, klassisch gewandete jünglingsgestalten geworden; zwischen ihnen die Inschrifttafel in klarer und edler Antiqua. Das im Halbdunkel liegende Bogenfeld zeigt eine Muttergottes mit stehendem Christuskind zwischen St. Peter und Michael. Im Tympanon erst wird das traditionelle Weltgerichtsthema angedeutet: Christus mit dem aufgeschlagenen Buch, flankiert von 2 Posaunenengeln.
Schwierigkeiten bereitet noch immer die Zuschreibungsfrage. Während die Architektur wohl ohne Einschränkung auf Michelozzo zurückgeführt werden kann, müssen die Skulpturen zwischen Michelozzo, Donatello und dem Werkstattgehilfen Pagno di Lapo Portigiani aufgeteilt werden. Eine Mitwirkung Donatellos ist bei der mittleren Karyatide, dem rechten Vorhanghalter, v. a. aber bei dem außerordentlich schönen, viell. einer Totenmaske nachgebildeten Porträtkopf des Kardinals vermutet worden; als sicheres Werk des großen Florentiners kann das Assunta-Relief an der
Vorderseite des Sarkophags gelten, ein klassisches Beispiel jener Technik des »relievo schiacciato« (»zusammengedrücktes« oder abgeplattetes Flachrelief), mit der Donatello revolutionierend in die Geschichte der Gattung eingriff. Durch feinste Abstufung aller Valeurs bis hinab zur flüchtigen Ritzzeichnung (etwa bei dem rechts unten in den Wolken herumpaddelnden Engelchen) entsteht ein zusammenhängendes Flächenbild von unvergleichlicher atmosphärischer Durchsichtigkeit; der Eindruck der Tiefe wird, statt durch reales Volumen, durch rein zeichnerisch aufgefaßte Verkürzungen von oftmals schockierender Drastik wiedergegeben. Aber auch inhaltlich zeigt das Werk ungewöhnliche Züge. Im Bilde der in den Himmel aufgenommenen Maria (an der Stelle des leidenden, toten oder auferstehenden Christus) scheint ein neues und heiteres, der himmlischen Gnade gewisses Selbstvertrauen sich auszusprechen. Ergreifend die von Masaccios Naturalismus inspirierte Darstellung der Gottesmutter als einer alten Frau, die, auf einem gewöhnlichen, irdischen Stuhle sitzend, in stummem Glück die Hände zusammenlegt; ringsum strudelt ein Reigen athletisch gebildeter Engelsfiguren, in deren ausgelassene Freudenbekundungen sich Züge von mänadischer Wildheit mischen.
Donatello und Michelozzo, Grabmal des Kardinals Rinaldo Brancaccio, 1423-1428, Neapel, S. Angelo a Nilo.
Weitere Ausstattung: An der Kapellenrüdswand zu seiten des Rinaldo-Grabes 2 Goldgrundtafeln vom Anfang des 16. Jh., St. Michael und St. Andreas; an der einen Schmalwand das Grabmal des 1483 verstorbenen Kriegsmannes Pietro Brancaccio von Jacopo della Pila. — Am Hochaltar nochmals der Erzengel Michael von Marco Pino; links daneben das Grabmonument der Kardinäle Stefano und Francesco Brancaccio von Bartolomeo und Pietro Ghetti.
Ein Wahrzeichen des alten Neapel ist der legendenumwobene Corpo di Napoli, eine auf dem angrenzenden Plätzchen aufgestellte Figur des Nils in Form eines Flußgottes mit Sphinx und Füllhorn. Sie gilt als Kultbild der alexandrinischen Gemeinde der antiken Neapolis, die hier ihren Sitz gehabt haben soll, geriet später unter die Erde, wurde im Mittelalter beim Ausheben der Fundamente des »Seggio« wiederaufgefunden und in eine Ecke der Loggia eingemauert. 1657 erhielt sie ihren heutigen Sockel und einen neuen Kopf anstelle des verlorengegangenen alten. Ihr Gegenstück war die Capa di Napoli, vulgo »Donna Marianna«‚ ein antiker weiblicher Kolossalkopf, der vom Ende des 16. Jh. bis zum 2. Weltkrieg vor S. Eligio stand und als angeblicher Überrest einer Statue der Sirene Parthenope abergläubische Verehrung genoß (s. S. 298).
S. Angelo a Segno (Via dei Tribunali 46), angebl. nach einer wunderbaren Erscheinung des Erzengels Michael genannt, ist eine Gründung des
1. Jahrtausends, doch haben unaufhörliche Restaurierungen (zuletzt 1825) den alten Bestand vollständig aufgezehrt; heute präsentiert sich das Innere als einfacher tonnengewölbter Saalraum mit hübscher klassizist. Stuckdekoration und farbig glasiertem Majolikafußboden. Dafür enthält die 1. Seitenkapelle rechts ein bedeutendes Werk von Simon Vouet, Darstellung Christi im Tempel (1623). Am Hochaltar ein hl. Michael, Goldgrundtafel aus dem 15. Jh.
Gegenüber ein pittoresker Markt unter einer Serie von Portiken, deren Ursprung sich bis ins 14. Jh. zurückverfolgen läßt. Der älteste Teil (Nr. 339) gehört zum Palazzo dell’Imperatore di Costantinopoli, erb. von Philipp von Anjou, einem Bruder Roberts d. Weisen, der den Titel eines Kaisers von Konstantinopel führte (+ 1347); auch das spitzbogige Eingangsportal hat sich erhalten.
S. Anna dei Lombardi (Chiesa di Montoliveto; an der Piazza Montoliveto zwischen Carità und Trinità Maggiore)
Die Kirche zählt zu den Hauptmonumenten der Stadt und kann dank ihrer wohlerhaltenen Familienkapellen als ein wahres Museum der neapolitan. wie auch der toskanischen und oberitalien. Renaissance-Skulptur und -Dekoration betrachtet werden.
1408 beschloß Gurello Origlia‚ der treueste Gefolgsmann König Ladislaus’ von Anjou-Durazzo, dem im Kloster von Montoliveto bei Siena beheimateten Olivetanerorden eine neapolitan. Niederlassung zu stiften. Nachdem ein geeigneter Baugrund gefunden war, erfolgte 1411 die feierliche Grundsteinlegung. Das Gebäude lag damals noch vor den Mauern der Stadt; erst 1499 zog Federico von Aragon einen neuen Mauerring, dem ein Teil des Klostergartens zum Opfer fiel. 1805 ging das Gebäude in den Besitz der Bruderschaft der Lombarden über, deren in der Nähe gelegene eigene Kirche S. Anna kurz zuvor durch ein Erdbeben zerstört werden war. — Die Kirche des 15. Jh., ein einfacher Saalbau mit Seitenkapellen und Rechteckchor, wurde im Lauf der Jahrhunderte durch zahlreiche Um- und Anbauten erweitert und verändert; schwere Bombenschäden während des 2. Weltkrieges, die u. a. die Vorhalle und ihre Seitenkapellen betrafen, gaben Anlaß zu einer durchgreifenden Wiederherstellung.
Die schmucklose Quaderwand der Fassade faßt eine dem Mittelschiff vorgelagerte Eingangshalle und 2 seitlich vortretende Nebenkapellen zusammen. Der weitgespannte Flachbogen des Mittelteils zeigt noch die urspr. katalanisch got. Profilierung; die Seitenkapellen sind durch Risalite mit reiner Frührenaissance-Dekoration (Giebel, Augen- und Rundbogenfenster) markiert. Die der Via Montoliveto zugekehrte Längswand enthält weitere Überreste der got. Architektur des Gründungsbaus (Spitzbogenfenster).
 S. Anna dei Lombardi, Grundriß
S. Anna dei Lombardi, Grundriß
Der Innenraum der Quattrocento-Kirche ist nur noch in seinen Umrissen wahrzunehmen; das architektonische Detail entstammt durchweg späteren Veränderungen. Originale Frührenaissance-Architektur findet sich in den wohl in den 70er Jahren des 15. Jh. erbauten Kapellen Piccolomini (links) und Mastrogiudice (rechts) zu seiten der Vorhalle (erreichbar durch die jeweils 1. Langhauskapelle links und rechts). Es sind quadratische Kuppelräurne von brunelleschianischem Typus, in allen Einzelheiten der Grabkapelle des Kardinals von Portugal in S. Miniato al Monte in Florenz (wahrscheinl. von Antonio Rossellino, 1460-66) nachgebildet. Freilich ist die Qualität der Steinmetzarbeit geringer, die Profilierung dünner und schwächlicher, überdies z. T. durch spätere Restaurierungen entstellt. Ein prinzipielles Mißverständnis tritt in der Behandlung der Ecken zutage: Der hälftig geknickte Pilaster des Vorbildbaus (abgeleitet von Brunelleschis Sagrestia Vecchia) ist in der Cappella Mastrogiudice so weit in die Breite gezogen, daß der Eindruck zweier miteinander verwachsener Vollpilaster entsteht; in der Cappella Piccolomini sind daraus 2 Einzelpilaster von nunmehr ganz unklassisch hoher und schmaler Proportionierung geworden. Eine verbesserte und bereicherte Lösung — korrekt halbierte Eckpilaster, von Vollpilastern begleitet —, bringt die Cappella Tolosa (hinter der letzten
Langhauskapelle links), angebl. von dem seit 1487 in Neapel tätigen Giuliano da Maiano, dessen beglaubigte Werke allerdings eine ganz andere Handschrift zeigen. Die Proportionen der Ordnung auch hier überschlank, obwohl untergeschobene Piedestale das Schlimmste verhüten; bemerkenswert die Behandlung der Kuppel: Über etwas gedrückten (segmentförm-igen) Lünettenbögen mit Rundfenstern schwebt eine in 8 Sektoren geteilte Kalotte, die deutlich an den Effekt Brunelleschischer Rippentechnik (Melonen- oder Schirmkuppel) erinnert; die tonnengewölbte quadratische Apsis bringt einen weiteren Nachklang Brunelleschis (Sagrestia Vecchia). Auf die Freskodekoration kommen wir unten zurück (S. 46).
Gennaro Sacco, Capella Piccolomini. Innenansicht, 1470/1475, Neapel, S. Anna dei Lombardi.
Gennaro Sacco, Capella Piccolomini. Innenansicht, 1470/1475, Neapel, S. Anna dei Lombardi.
Ausstattung
Vorhalle: Rechts vom Eingang das im Kriege beschädigte und aus Fragmenten neu zusammengesetzte Grabmal des Architekten Domenico Fontana, geboren in Melide bei Lugano 1543, verstorben zu Neapel 1607, nachdem er Rom beim Tode seines päpstlichen Gönners Sixtus V. (1590) fluchtartig hatte verlassen müssen.
Vergeblich versuchte er später an der Stätte seines großen Ruhmes wieder Fuß zu fassen. Das Bildnis zeigt den Toten in der Tracht eines Edelmannes, anspielend auf die ihm von Papst Sixtus verliehene Ritterwürde; die 1627 von seinen Söhnen verfaßte Grabinschrift nennt zuerst jene ingeniöse Tat, die Fontana in den Augen seiner Zeitgenossen unsterblich machte: die Wiederaufstellung der röm. Obelisken; viell. nicht zufällig ähneln die Löwen unter dem Sarkophag den bronzenen Trägern des Obelisken auf dem Petersplatz. — Das modern gerahmte Eingangsportal hat noch seine alten hölzernen Türflügel mit prächtigen Schnitzereien von Fra Giovanni da Verona (1510), dem Meister des weiter unten zu besprechenden Schrankwerks der Sakristei. Wer für den Reiz dieses Stils überhaupt empfänglich ist, wird solche Hochrenaissance-Dekorationen zu den reinsten Genüssen zählen, die Neapel zu bieten hat; »das von massenhaften Barockbauten ermüdete Auge«, schrieb Jacob Burckhardt, »sucht sie mit einer wahren Begier auf«.
Langhaus, Mittelschiff: Die alte, im 19. Jh. übermalte Kassettendecke wird derzeit restauriert. Zwischen den Hochschiffenstern wurden 1720 zehn Leinwandbilder von Gabriele de Sabato angebracht (Ereignisse aus dem Leben des hl. Bernardo Tolomei, des Gründers des Olivetanerordens); über der Vorhalle ein gewaltiger Orgelprospekt von Cesare Caterinozzi da Subiaco (1697) mit Dekorationen von Alessandro Fabro (18. Jh.).
Darunter, an der inneren Eingangswand, 2 Marienaltäre, benannt nach den Stifterfarnilien del Pezzo und Liguoro (Ligorio), charakteristische Exemplare der in Neapel besonders beliebten Gattung
des rein plastisch behandelten Wandaltars. Der erstere, zur Linken des Eintretenden, wurde 1524 bei Girolamo Santacroce in Auftrag gegeben, einem neapolitan. Bildhauer, dessen kurzes Leben (ca. 1502-37) genügte, ihm bei seinen Zeitgenossen höchsten Ruhm zu sichern. Sein Werdegang liegt im Dunkel; wir wissen nur, daß er 1520 zusammen mit Raffaele da Montelupo in Carrara gearbeitet hat; für die Bildung seines Stils scheint der Einfluß Tommaso Malvitos und v. a. Benedettos da Maiano von Wichtigkeit. Der architektonische Aufbau unseres Altars zeigt eine Art von Triumphbogenschema, wie es zu Beginn des Jahrhunderts von Andrea Sansovino für Grabmäler entwickelt worden war (Rom, S. Maria del Popolo). In der Mittelnische die Statue der Madonna, eine der besten Figuren dieses hochbegabten Bildhauers, im Typus wie in den Einzelheiten (Gesicht) stark von florentinischen Vorbildern geprägt. Das entzückend lebendige Kind steht mit einem Bein auf einem Postament, mit dem anderen tritt es hinüber auf den vorgestellten linken Oberschenkel der Mutter, dessen auffallend wuchtige Drapierung den sanften Linienfluß des Ganzen jäh unterbricht. Das gleiche Kontrastmotiv kehrt wieder in den flankierenden Halbrelieffiguren Johannes’ d. T. und des hl. Petrus. Das Paliotto-Relief mit Petri wunderbarem Fischzug zeigt Santacroce nicht nur als Anhänger einer souverän beherrschten »schiacciato«-Technik (s. S. 40), sondern erweist ihn zugleich als Meister dramatisch zugespitzter Erzählkunst; die Konzentration der Handlung auf 3 groß aufgefaßte Figuren zeugt von tiefem Verständnis der Ideen der röm. Hochrenaissance (Raffaels Teppichkartons). Das dekorative Beiwerk ist zart und fein in der Ausführung, dabei durchweg von großer Erfindung; besonders schön die unverkennbar weiblichen Engel in den Zwickeln über der Mittelnische sowie die nur handspannengroßen, doch überaus monumentalen Evangelistenreliefs der Säulensockel.
Der 1532 datierte Liguoro-Altar, rechts vom Eingang, stammt von Giovanni da Nola, der 1488 in Mirigliano (oder Merliano) bei Nola zur Welt kam, bei dem Holzschnitzer Pietro Belverte in die Lehre ging und bis zu seinem Tode (1558) in Neapel tätig war. Er bildet in jeder Beziehung das genaue Gegenstück zu dem Werk Santacroces; wie weit er hinter seinem Vorbild (urspr. viell. Konkurrenzstück) zurückbleibt — auch wo er dieses direkt kopiert —, wird jeder aufmerksame Betrachter sich klarmachen können. Johannes d. T. erscheint hier als Knabe zu Füßen der Madonna; in den Seitenfeldern stehen Andreas und Hieronymus, im Paliotto wird eine Wundertat des hl. Franz von Paola geschildert, der von einem Erdrutsch verschüttete Pilger befreit.
Langhauskapellen, linke Seite: 1., Cappella Piccolomini oder del Presepe. Im Vorraum eine auf der Grenze zwischen Relief und Freiplastik stehende Kreuzigungsdarstellung (Maria Magdalena als Rückenfigur, jedoch mit vollkommen ausgearbeitetem Gesicht) von Giulio Mazzoni aus Piacenza, dem
Meister der berühmten Stuckdekorationen im Palazzo Spada zu Rom. An der rechten Wand ein interessantes Triptychon mit der Himmelfahrt Christi und den hll. Sebastian und Nikolaus von Bari, von dem aus Palermo gebürtigen, katalanisch-niederländisch beeinflußten Riccardo Quartararo (um 1490).
Der marmorne Altar der Hauptkapelle, um 1470 entstanden, zählt zu den besten Werken des Florentiner Bildhauers Antonio Rossellino (1427-79). Eine reich ornamentierte korinthisierende Pilasterordnung teilt das Retabel in 3 Felder. Obenauf stehen 4 fidele Engelchen mit einer Fruchtgirlande, wohl von Gehilfenhand ausgeführt; in den Seitenfeldern fein bewegte Büsten und Statuen der Evangelisten, deren Tiersymbole im Sockelstreifen erscheinen. Das eigentliche Glanzstück bildet das »Presepe«, die reliefierte Darstellung der Geburt Christi. Nie zuvor war die Skulptur in so engen Wettbewerb mit der Malerei getreten: Alle Mittel einer raffinierten Marmortechnik stehen hier im Dienste der Vortäuschung räumlicher Tiefe, von dem fast vollplastisch gearbeiteten schlafenden joseph links vom bis zu den fernen Kappeln und Türmen der Stadt im Hintergrund links. Dabei ist es dem Künstler nicht um ein zentralperspektivisch geordnetes Ganzes zu tun; vielmehr läßt das scheinbar naive Zusammendrängen zeitlich wie räumlich getrennt zu denkender Szenen eine Art »Aggregat-Raum« entstehen, wie er etwa auch für gewisse Bilder des späten Filippo Lippi charakteristisch ist. Eine Unzahl akribisch geschilderter gegenständlicher Einzelheiten — die Maisstreu des Stalles, die Konstruktion seines Strohdachs, die zierliche Fächerpalme am linken Rand — füllt die Bildfläche aus; noch der Himmel ist mit Streifenund Haufenwölkchen besetzt, aus denen rechts der Verkündigungsengel herabstößt; gleich daneben, auf kreisförmig vortretender Wolkenbank, führen 9 Engel (die Zahl der Musen!) einen höfischgezierten Rundtanz vor, zu dem die beiden Hirten im Vordergrund rechts in verständlichem Erstaunen aufblicken. Spuren alter Vergoldung erlauben den Schluß, daß der polychrome Effekt der rahmenden Flächen auch im Mittelbild seine Fortsetzung finden sollte.
An der linken Wand das Grabmal der Maria von Aragon, der natürlichen Tochter Ferrantes I. und Gemahlin des Herzogs von Amalfi, Antonio Piccolomini. Es ist wie der Altar in der Florentiner Werkstatt des Antonio Rossellino entstanden; Benedetto da Maiano führte das beim Tode des Meisters (1497) noch unfertige Werk zu Ende. In der Geschichte des neapolitan. Fürstengrabes bezeichnet es einen bedeutsamen Wendepunkt: Tugenden, Sarkophagreliefs, Totenkammer und hoheitsvoll distanzierende Baldachinarchitektur sind durch das bürgerlich-humanistische, unmittelbar auf den Beschauer bezogene Wandnischengrab abgelöst worden.
Der rahmende Marmorvorhang ist weit geöffnet, nicht mehr nur momentan beiseite gezogen; der architektonische Aufbau umfaßt allein den auf niedrigem Sockel stehenden, streng all’antica ge-
bildeten Sarkophag (nach dem Vorbild des großen antiken Porphyrsarges vom Pantheon) mit der Prunkbahre der Verstorbenen; die Figuren der Oberzone (Engel, Madonnen-Tondo) knien oder schweben malerisch frei vor dem Wandhintergrund. Mythologische Anspielungen haben die Rolle des Tugendprogramms übernommen: Die Reliefs der Sockelschmalseiten zeigen rechts Herkules’ Kampf mit der Hydra, links ein Zweigespann mit geflügeltem Lenker, das bekannte Gleichnis der vom platonischen Amor gebändigten Seelenkräfte. So weit ist alles eine nahezu wörtliche Wiederholung von Rossellinos schönem Portugal-Grab in der schon erwähnten Seitenkapelle von S. Miniato al Monte zu Florenz, und man darf annehmen, daß der Auftraggeber es so und nicht anders hat haben wollen; nur der Tondo mit der Auferstehung Christi stellt eine wohl eher aus ikonographischen als aus formalen Gründen erwünschte Ergänzung des Vorbilds dar (dieses trägt an dessen Stelle einen großen Onyxstein).
In der Lünette der rechten Seitenwand ein Verkündigungsfresko von einem Nachahmer des Piero della Francesca. Von der sonstigen Freskoausstattung sind, nach Beseitigung späterer Übermalungen, nur spärliche Reste übriggeblieben; sie geben immerhin einen Eindruck von der harmonisch gedämpften Polychromie des urspr. Dekorationssystems. Der wohlerhaltene Opus-sectile-Fußboden folgt wiederum dem Muster der Portugal-Kapelle. — 2. Kapelle: Verdorbene Wand- und Deckenfresken von Giov. Antonio Arditi und Antonio Sarnelli (1771); gutes Altarbild (Madonna mit Engeln und den hll. Benedikt und Thomas von Aquin) von Fabrizio Santafede. — 3. Kapelle: An der linken Wand ein 1576 datiertes Hochrelief mit der Geißelung Christi; rechts gegenüber das Grabmal des Garzia Cabanilla von Jacopo della Pila (um 1470); am Altar Gnadenmadonna mit den hll. Maurus und Placidus von Paolo de Matteis. — 4. Kapelle: 2 Bilder von Andrea Malinconico, darstellend die Pest in Siena. — 5. Kapelle: Ein marmorner Wandaltar mit großer Nischenfigur Johannes’ d. T. und dem von Maria und Johannes flankierten Sehmerzensmann im Paliotto, aus dem Umkreis Girolamo Santacroces; v. a. in der straff aufgerichteten, das Pathetische der Gestalt großartig zur Geltung bringenden Statue glaubt man einen Nachklang der Kunst dieses frühverstorbenen Meisters zu verspüren (für die ganz andere Auffassung der Figur im Umkreis des Giovanni da Nola vgl. S. Domenico Maggiore, S. 95).
Von hier aus Durchgang zur letzten, 6. Langhauskapelle links: Sie dient als Vorraum der außen angebauten Cappella Tolosa. Die schon oben erwähnte Architektur wird ergänzt durch einen leider stark beschädigten, derzeit in Restaurierung befindlichen Freskenzyklus, der auf einen norditalien. geschulten Künstler (Cristoforo Scaeco?) zurückzugehen scheint; auch die feine Arabeskendekoration trägt oberitalien. Züge. Die Fresken der Seitenwände zeigen illusionistische Architekturen (je eine Wiederholung des Innen-
raums der Kapelle) mit »sotto-in-sù« gesehenen Heiligenfiguren; über der Eingangswand die Bekehrung Pauli, eine großartig bewegte Szene in weiter Landschaft; in den Lünetten herrliche musizierende Engel. Die Kuppelzwickel tragen Evangelisten-Tondi aus glasierter Terrakotta, nach Art der Florentiner Robbia-Werkstatt.
An den Vorraum der Kapelle schließt sich noch eine kleine Nebenchor-Kapelle an; sie enthält eine jüngst freigelegte Flachnische mit einem Fresko des frühen Quattrocento, Madonna auf spätgot. Prunkthron mit 2 Heiligen und kniendem Stifter, darunter der Schmerzensmann; an den Wänden 2 stark verschmutzte Bilder von Carlo Sellitto: Schlüsselübergabe und Jesus mit Petrus auf dem Wasser wandelnd.
Langhauskapellen, rechte Seite: 1. Cappella Mastrogiudice, vormals Terranova-Correale. Der Vorraum enthält große Wandgräber der Familie Mastrogiudice (17. Jh.). Im Hauptraum rechts das Grab des Stifters der Kapelle, Marino Curiale, Conte di Terranova und Majordomus Ferrantes I. (1490).
Der große Verkündigungsaltar von Benedetto da Maiano, im Auftrag des Grafen von Terranova 1489 vollendet und nach Neapel geschickt, bildet ein genaues Gegenstück zu Rossellinos »Presepe« in der gegenüberliegenden Piccolomini-Kapelle. Das Mittelfeld ist wieder ganz bildmäßig isoliert, die in ihm dargestellte Architektur ausdrücklich von der des Ädikula-Rahmens abgesetzt.
Wie ein gemalter Prospekt wirkt der Hintergrund mit der perspektivisch tadellos konstruierten Bogenhalle, die sich in ein von Brunnen, Blumen und Fruchtbäumen allegorisch belebtes Paradiesgärtlein öffnet (denn die Verkündigung der Geburt Christi durch die »neue Eva« Maria, den jungfräulich reinen Quell, eröffnet den erbsündigen Menschen den Rückweg ins Paradies). Die eigentliche Handlung jedoch — Maria stehend, Engel von links, Gottvater mit Gefolge von oben hereinschauend — spielt sich auf einem schmalen Proszenium ab, dessen Figuren und Architekturkulissen so kunstvoll hinterarbeitet sind, daß ihre auf den Hintergrund fallenden Schlagschatten den ganzen Illusionseffekt wieder zunichte machen.
Von der inneren Spannung der Szene, wie sie etwa Donatello in seinem S.-Croce-Tabernakel beschweren hatte, ist nichts übriggeblieben. In den Seitenfeldern Sibyllenbüsten und die Nischenfiguren des Täufers und der Evangelisten, breit und gelassen dastehende, in bauschige Faltenwürfe gehüllte Gestalten, im Ausdruck bieder und leer; auch die Predella-Szenen — Geburt, Anbetung der Könige, Auferstehung, Beweinung, Himmelfahrt, Pfingstwunder, Marientod — verraten mehr handwerkliches Können als Inspiration. Von den beiden girlandenhaltenden Putten des Oberteils scheint der rechte in Bewegung und anatomischer Durchbildung von hervorstechender Qualität; neuerdings ist mit guten Gründen vermutet worden, man habe es hier mit dem ersten erhaltenen Werk des jungen Michelangelo zu tun, der gegen 1489 möglicherweise in Maianos Werkstatt gearbeitet hat.
2. Kapelle: Fresken von Gius. Simonelli; am Altar S. Francesca Romana von Baldassare Aloisi (1611). — 3. Kapelle: Der Marmoraltar ist dem hl. Antonius von Padua gewidmet (im Paliotto die Predigt an die Fische), eine Arbeit aus der Nachfolge des Giovanni da Nola, viell. von Giov. Dom. d’Auria; Deckenfresken von Malinconico. — 5. Kapelle: Fresken von Simonetti; am Altar ein famoser Solimena (hl. Christophorus). — Man gelangt von hier aus durch einen Vorraum (Korridor) in die rechte Nebenchorkapelle, mit Grabmälern der Familie Orefice (1590 und 1597), dem Girolamo d’Auria zugeschr., und polychromen Marmorintarsien von 1596-98; Hängekuppel mit hoher lichtspendender Laterne, stark beschädigte Fresken von Luigi Rodriguez aus Messina (Anfang 17. Jh.).
Hauptchorkapelle: Der barocke Hochaltar enthält Fragmente eines Marmoraltars von Giovanni da Nola; vorn ein Relief mit der Fußwaschung, an der Rückseite das Tabernakel und Architekturfragmente. — Das reich intarsierte, mehrfach ausgebesserte Chorgestühl stammt von Giov. Francesco d’Arezzo und seinem Schüler Fra Prospero (vor 1524); es zählt zu den schönsten seiner Art in Neapel. An der darüberliegenden Wand wurden Ende des 16. Jh. ältere Grabmäler angebracht: Links Giovanni Artaldo (von Tommaso Malvito, 1516) und Fabbio Baratuccio (von Antonio de Marco und Antonino de Palma); in der Mitte die Denkmäler des Gurello Origlia und König Alfons’ II., der wichtigsten Stifter der Quattrocento-Kirche, wahrscheinl. von Giovanni da Nola; rechts der Bischof Giov. Paolo Vassalli (1500) und Nic. Asciomo von Malvito.
Nebenräume rechts vom Chor: Durch den Korridor vor der Cappella Orefice erreicht man zunächst eine weitere Grabkapelle; rechts das einfache Wandgrab des Antonio Fiodo von Francesco da Sangallo und Bernardino del Moro aus Siena (1540), links der Sarkophag des Antonio d’Alessandro und seiner Frau Maddalena Riccio, Überreste eines großen Baldachingrabes von Tommaso Malvito (1491). — Es folgt die Kapelle der Fürsten von Sulmona, ein etwas größerer Raum mit 2 Wandfresken des Spaniers Pietro Ruviale (um 1550); links: Esau verkauft seine Erstgeburt, rechts: Jonas-Geschichte.
Die 8 lebensgroßen Tonfiguren der Beweinung Christi (Tafel S. 33) in der anschließenden Cappella della Pietà bilden eines der Hauptwerke des Guido Mazzoni aus Modena. Das Geburtsdatum dieses merkwürdigen Künstlers ist nicht überliefert; er war seit 1473 in Oberitalien tätig, von 1489 an in Neapel, wo 1492 im Auftrag des späteren Königs Alfons II. unsere Gruppe entstand. 1495 ging er im Gefolge Karls VIII., der ihn zum Ritter geschlagen hatte, nach Frankreich, schuf dessen 1793 zerstörtes Grabmal in St-Denis, arbeitete dann für Ludwig XII. und kehrte erst nach dessen Tode (1515) nach Modena heim, wo er 1518 starb. Die äußeren Daten dieses Lebenslaufs machen hinreichend klar, daß
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
SS. Annunziata. Inneres (L. Vanvitelli)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
SS. Apostoli. Filomarino-Altar (F. Borromini)
wir es hier nicht etwa mit Volkskunst, noch auch mit einer nur auf den Geschmack des gemeinen Mannes berechneten Gattung zu tun haben. Naturwahrheit bedeutete für das Quattrocento einen unbedingten ästhetischen Wert; so haben Mazzonis Zeitgenossen seine Leistung grenzenlos bewundert, der Kunsttheoretiker Pomponius Gauricus ihn nach einer damals geläufigen Lobformel über Phidias, Polyklet und Praxiteles gestellt. Daß die klassizistisch orientierte Kritik späterer Jahrhunderte von dieser Wertschätzung nichts übrigließ, ist begreiflich; allein der moderne Betrachter, auch wenn das formal Primitive des Stils ihn abstoßen mag, wird doch für das eigentümlich nüchterne Pathos dieser scharfen und genauen, von expressiver Verzerrung wie schönheitlicher Verklärung gleichermaßen sich freihaltenden Charakteristik des Schmerzes um den toten Heiland beeindruckt sein. Selbstverständlich sind die Figuren bemalt zu denken. Das 19. Jh. versah sie mit einem einheitlich bronzefarbenen Ölanstrich, der später wieder entfernt wurde, wobei wohl auch Reste der originalen Fassung verlorengingen; der Leichnam Christi — eine gnadenlos realistische Darstellung des zu Tode geschundenen Körpers, der aber durchaus nichts Unästhetisches anhaftet — erscheint auf älteren Fotografien noch mit grellfarbig ausgemalten Wunden geschmückt. Weiterhin muß man, um sich die urspr. Wirkung der (bereits im 17. Jh. auseinandergerissenen) Gruppe vor Augen zu führen, von der gegenwärtigen Aufstellung abstrahieren, welche die Einzelfiguren viel zu stark isoliert und einem falschen, weil gänzlich undramatischen Symmetriegesetz unterwirft. V. a. müßte, wie Mazzonis Pietà-Gruppe in Modena zeigt, Christus vorn quer zum Beschauer liegen; die in sich zusammengesunkene Maria (jetzt hinten links) würde dann vor dem zu ergänzenden Kreuzesstamm im Zentrum der Gruppe sitzen, Johannes (der 2. von rechts) ihr zur Hilfe eilen; das Ganze im Halbdunkel einer Nische oder Kapelle, die den zusammenfassenden Bühnenrahmen abgäbe.
Hinter der Orefice-Kapelle liegt die durch einen schmalen Korridor erreichbare Cappella dell’Assunta, mit Stuckdekorationen von Michelangelo Naccherino; links über der Tür schaut ein Olivetaner zum Fenster herein: ein hübsches »trompe-l’oeil« von Giorgio Vasari. — Der Korridor führt weiter zu den Sakristeien: links die neue, mit einem Altarbild des 18. Jh. (Kruzifix mit Heiligen von Gius. Mastroleo).
Guido Mazzoni, Beweinung Christi, Sant'Anna dei Lombardi, 1492, Neapel.
Guido Mazzoni, Beweinung Christi - Maria Salome und Maria, Sant'Anna dei Lombardi, 1492, Neapel.
Rechts gegenüber die Sagrestia Vecchia mit Gewölbefresken von Vasari; an den Wänden, in barocker Umrahmung, eine umfangreiche Serie intarsierter Sakristeischränke von Fra Giovanni da Verona. Dieser in seiner Zeit hochberühmte, nach Vasaris Bericht in allen dekorativen Künsten wie auch in der Architektur bewanderte Olivetanermönch wurde um d. J. 1447 in Verona geboren und starb ebendort 1525. Seine Hauptwerke befinden oder befanden sich, außer in seinem Heimatort (S. Maria in Organo), im Kloster von Montoliveto Maggiore, ferner in
Siena, Rom (die nicht erhaltene hölzerne Ausstattung der Camera della Segnatura Julius’ II.) und schließlich hier in Neapel, wo er zwischen 1506 und 1510 nachweisbar ist. Die Technik der Holzintarsia wurde durch ihn zu staunenswerter Vollkommenheit entwickelt; Fra Giovanni soll als erster mit farbig gebeizten Hölzern gearbeitet haben. Doch liegt seine eigentliche Bedeutung, jenseits des Handwerklichen, im Sinn für die große Form auch des unscheinbarsten Motivs, in der Klarheit der Zeichnung und im Reichtum der Gegenstände, die er mit den Mitteln des Holzmosaiks zu bewältigen sich getraute. So sieht man neben den üblichen Architekturphantasien auch ganz realistisch aufgefaßte Landschafts- und Städtebilder (topographisch wichtige Ansichten von Neapel, außerdem eine der frühesten Abbildungen von Bramantes Tempietto), allerlei Tiere, Früchte, Stilleben, aber auch ein veritables Porträt (der Olivetanerprior Alois von Salerno), ferner geöffnete Schränke mit sakralem und profanem Gerät (interessante Musikinstrumente) u. a. mehr.
Die alten Konventsgebäude, die vordem die ganze Häuserinsel zwischen Piazza Montoliveto und Piazza Matteotti einnahmen und deren prächtige Ausstattung vielfach gerühmt wird, sind nach der Säkularisation des Klosters (1799) teils völlig beseitigt, teils bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Nur 2 der 4 großen Kreuzgänge sind noch sichtbar. Der eine, mit 2 Arkaden- und einem Fenstergeschoß (fein profilierte Bögen auf Säulen, jetzt vermauert), bildet den Innenhof der »Caserma Pastrengo« rechts neben der Kirche (Eingang Via Mario Morgantini). Ein gleichfalls 3geschossiger Pfeilerhof von gewaltigen Dimensionen (79 Achsen) liegt an der Rückseite des modernen Hauptpostgebäudes und dient mit seinen geöffneten Mittelarkaden als Durchgang zwischen Via Montoliveto und Via Cesare Battisti. Am Eingang der Via del Chiostro links der Rest eines 3. Kreuzgangs, eine hübsche Pfeilerloggia von 4 Achsen und 3 Geschossen, mit feinen Balustraden, vom Anfang des 16. Jh.
S. Anna di Palazzo (ehem. Madonna del Rosario oder Rosariello; in der gleichnamigen Straße oberhalb der Talstation der Funicolare Centrale) wurde 1573 von den Dominikanern zu Ehren des damals von Gregor XIII. gestifteten Rosenkranzfestes gegründet; der heutige Titel wurde Anfang des 19. Jh. von einer nahegelegenen, jetzt verschwundenen Kirche S. Anna di Palazzo oder 8. Anna vecchia übertragen. Pfeilerbasilika mit üppigster Marmorauskleidung, im 19. Jh. stark restaur. An der Eingangswand und am letzten Pfeilerpaar Porträtmedaillons der 4 Dominikanerpäpste Innozenz V., Benedikt XI., Pius V. und Benedikt XIII.; Altarbilder von Sabatini, Curia u. a.
S. Anna a Porta Capuana (außerhalb der Porta Capuana, an der gleichnamigen Piazza)
1745-51 von Giuseppe Astarita erbaut. Die kräftig stuckierte Fassade, in 2 Ordnungen über leicht schwingender Grundlinie aufgebaut, im Mittelfeld durch 2 Paar in die Wand eingestellte Vollsäulen bereichert, erinnert an Fassaden der röm. Borromini-Nachfolge der 1. Jahrhun-
 S. Anna a Porta Capuana. Längsschnitt und Grundriß
S. Anna a Porta Capuana. Längsschnitt und Grundriß
derthälfte (SS. Celso e Giuliano von de Dominicis, 1733); die Freitreppe entstand erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, anläßlich der Tieferlegung des Platzniveaus.
Der höchst geistreich komponierte Innenraum besteht aus 3 aneinandergereihten Kompartimenten. Das
Schiff bildet im Grundriß ein in die Breite gezogenes Sechseck, mit Kapellen in den 4 Schmalseiten, überwölbt von einer flachen Stichkappenkalotte. Daran schließt sich eine quadratische, durch Eckabschrägung erweiterte Vierung mit hoher Tambourkuppel: Die Wandführung in den Querarmen — flach ausgehöhlter Mittelteil, schräg zurückspringende Flanken — gibt eine Umkehrung des Borromini-Altars von SS. Apostoli. Das Presbyterium besteht aus einem querrechteckigen Kreuzgewölbejoch mit Halbrundapsis. Hier entwickelt sich das große szenographische Motiv des Innenraums: 2 kurvig geschwungene Treppenläufe (nach dem Vorbild des Chores der S. Maria della Sanitär) steigen vom Niveau des Schiffes zu dem hochliegenden Altarraum auf, unter welchem auf diese kapriziöse Art Platz für die Sakristei geschaffen wurde. Eine durchlaufende Kompositordnung mit zahlreichen Bündelungen und Kröpfungen hält die einzelnen Teile des Raumes zusammen. Daneben reich bewegte Stuckdekoration; im Chorraum 2 schöne hölzerne Orgelprospekte.
Giuseppe Astarita, Treppenanlage, 1745, Sant'Andrea a Capuana in Neapel.
SS. Annunziata (in der gleichnamigen Straße zwischen Bahnhofsplatz und Via del Duomo)
Der got. Vorgängerbau wurde 1304 gegründet und stand unter königlichem Patronat; eine Urkunde von 1336 bezeichnet die Königin Sancha, Gemahlin Roberts d. Weisen, sogar als Stifterin des Gebäudes. 1540 ff. von Ferdinando Manlio umgebaut und von Curia, Santafede, Imparato u. a. ausgemalt, brannte die Kirche 1757 vollständig nieder.
Die Erneuerungspläne, zu deren Ausarbeitung auch Gioffredo, Astarita, Fuga u. a. herangezogen wurden, beschränkten sich zunächst auf schrittweise Wiederherstellung des alten Zustandes; erst nach zähem Kampf gelang es L. Vanvitelli, die Stiftsoberen für sein Projekt, das den völligen Neubau der Kirche vorsah, zu gewinnen. Den Ausschlag gab schließlich eine Entscheidung des Königs, der für die Ausführung desjenigen Entwurfs, der »den besten antiken Geschmack zeige«‚ eine bedeutende Geldsumme zur Verfügung stellte. Seit seinem Beginn, 1760, stand der Bau unter persönlicher Leitung Vanvitellis. Streitigkeiten um sein Kuppelprojekt, das als zu kostspielig getadelt wurde, veranlaßten ihn 1769, von seinem Amt zurückzutreten; ein neuer Ruf, der ihm freie Hand ließ, erging 1771, ein Jahr vor seinem Tode. 1774-81 führte Carlo Vanvitelli nach den Plänen seines Vaters die Kuppel aus. Im 2. Weltkrieg von mehreren Bomben getroffen, wurde der Bau in den letzten Jahren vollständig wiederhergestellt.
Die Kirche ist Vanvitellis größter und schönster Sakralbau. Die Fassade folgt dem basilikalen Typ, ionisch-korinthisch dekoriert, die Flanken um eine Stufe zurückgesetzt, ohne Überschneidungen und malerische Zweideutigkeiten; die Verkröpfung des oberen Gebälks, einziger Zuwachs an Bewegung im Obergeschoß, wird durch die ungebrochenen Giebelkanten wieder zum Stillstand gebracht. Die gleichmäßig konkave Krümmung der ganzen Front (nach dem Vorbild Carlo Fontanas: Rom, 8. Marcello al Corso) ist weniger dynamisch als optisch zu verstehen: das in der Ebene entworfene Aufrißsystem wird sozusagen auf einen Rundhorizont projiziert. Wer im Zentrum des Grundrißkreisbogens steht (unmittelbar vor dem Schaufenster des gegenüberliegenden Schuhgeschäfts), erblickt die Schauwand in reiner Frontalität, ohne perspektivische »Randverzerrung« — ein Eindruck gesteigerter Klarheit, ganz verschieden vom Effekt »barocker« Krümmungen, etwa bei Borromini, wo alles auf bereichernden Wechsel der Ansichten angelegt ist.
Das Innere (Tafel S. 48) zählt zu den bedeutendsten Raumbildern des italien. Spätbarock. Die außerordentliche Tiefenerstreckung (ca. 75 m bei nur 15 m lichter Schiffbreite) wird skandiert durch den Wechsel von lichterfüllten Haupträumen (Langhaus, Kuppelvierung, Chorarm) und kurzen, schmalen Schattenzonen (Vestibül, Vierungsgurte, Apsis) — wiederum eine szenographisch-optische Kompositionsweise, deren hochbarocke Vorbilder in Rom (8. Maria in Campitelli) und Venedig (8. Maria della Salute) zu suchen sind. Der Aufriß läßt sich als Übersetzung des tonnengewölbten Kapellensaals der Gegenreformation (Il Gesù in Rom) ins klassische Architravsystem verstehen. Alle struktiven und dekorativen Formen sind aus diesem Grundgedanken entwickelt und in feinster Balance von Stütze und Last, Bewegung und Ruhe, tektonischer Strenge und freiem Spiel des Ornaments aufeinander bezogen. Den Grundton geben die 44 kolossalen korinthischen Marmorsäulen, die in wechselnden Gruppierungen und Funktionen den Raum umstehen und seine Wände gleichsam zur Tempelperistase idealisieren. Solche Säulenverwendung kommt von Palladio her, wurde im röm. Hochbarock von Pietro da Cortona und Carlo Rainaldi fortentwickelt und hier noch einmal zu höchster, feierlichster Wirkung emporgeführt. Neu und sympto-
matisch für die Hinwendung zum Klassizismus ist die gänzliche Ausschaltung des Bogenmotivs aus dem Untergeschoß; es bleibt der Tonnenwölbung vorbehalten, deren machtvolles Halbrund die Säulenwände miteinander verbindet und erst eigentlich zum Innenraum zusammenschließt. In der Kuppelzone endlich entfaltet sich spätbarocke Raumphantasie: Der Tambour ist aufgelöst in eine 8fache Bogenstellung auf Doppelsäulen; in den Diagonalen springen durchfensterte Nischen auf und bieten dem von unten aufblickenden Betrachter ein wechselvolles Spiel hin und her schwingender Kurvaturen; der Fußring der Kuppelschale ruht nicht auf dem Gebälk der Tambourordnung, sondern »schwebt« über den Scheiteln der dazwischen aufsteigenden Archivolten. Die Detaillierung von Tür- und Fensterrahmen, Altären und Wandfüllungen zeugt von der nirgends aussetzenden Disziplin des großen Zeichners; in zahlreichen Einzelmotiven läßt sich das Studium der Meister des röm. Hochbarock verfolgen (vgl. etwa die sternförmige Kassettierung an Kuppel und Vierungsgurten mit Pietro da Cortonas SS. Martina e Luca in Rom). Glücklicherweise ist die urspr. Farbstimmung von hellen, kühlen Weiß-und Grautönen, ohne Goldschmuck, unverändert auf uns gekommen; so kann der Reiz der unendlich fein artikulierten Übergänge von Licht und Halbschatten, die, von den Kannelierungen der großen Säulen ausgehend, den Raum durchwalten, überall rein empfunden werden.
In der 2. Langhauskapelle links eine schwungvolle Verkündigung Marine von Giacinto Diana, durch moderne Zutaten (Engel, Krone, Sternenkranz) entstellt. — Am linken Querschiffaltar eine hl. Barbara von Francesco de Mura. Außerdem im Querschiff 8 Stuckfiguren: links »Weisheit« und »Heiligkeit« von Giuseppe Sammartino, »Sparsamkeit« und »Mäßigkeit« von Ang. Viva; rechts »Meditation« und »Gebet« von Sammartino, »Klugheit« und »Standhaftigkeit« von Giuseppe Picano. — Eine Verkündigung zeigt auch, dem Titel der Kirche entsprechend, das Hochaltarbild in der Apsis, eines der Hauptwerke von Fr. de Mura. Aus der Intimität des Innenraums ins Freie verlegt, wird die Begegnung Mariens mit dem Himmelsboten zur öffentlichen Staatsaktion; so erscheint Gabriel nicht allein, sondern wird von einem Gefolge untergeordneter Engel und Putten begleitet, ja förmlich herbeigetragen. Die kultivierte Malerei mildert und veredelt die leicht theatralischen Obertöne des Ganzen. — In der rechten Seitenkapelle des Chores eine gute Pietà-Gruppe (neapolitanisch, 17. Jh.).
Die 3. Langhauskapelle rechts öffnet sich zu einem Vestibül, das
einige Marmorreliefs aus der älteren, durch Feuer zerstörten Kirche enthält; die Geburt Christi links ist eine Kopie des Rossellino-Reliefs aus S. Anna dei Lombardi. — Auch die Carafa-Kapelle links ist ein Überbleibsel des alten Baues (16. Jh.). — Rechts gegenüber der Eingang zur Sakristei, einem hervorragend reich ausgestatteten, vollkommen erhaltenen Ambiente aus der 2. Hälfte des 16. Jh.: alter Majolikafußboden, Schrankwerk aus vergoldetem Eichenholz, mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, Propheten und Heiligen, von Leon. Turbolo, Fel. d’Arvano und Nunzio Ferraro (1577-79). Die Deckenfresken mit alttestamentlichen Szenen von Belisario Corenzio. An den Schmalseiten des Raumes ein Schnitzaltar (Verkündigung, Glaube und Hoffnung) in einem kleinen überkuppelten Sacellum von Girolamo d’Auria und Annibale Caccavello (1577/78). — Am Ende des Vestibüls die Schatz-und Reliquienkapelle mit feiner Stuckdekoration von Dosio und Fresken von Corenzio (1597-1600). An der rechten Schmalseite das Grabmal des Diplomaten Alfonso Sanchez (+ 1564) von Michelangelo Naccherino (1588/89), der Verstorbene in manieristisch geschraubter Haltung mehr schwebend als liegend zu Füßen einer hübschen Sitzmadonna.
An der linken Flanke des Kirchengebäudes erhebt sich der massive Campanile des alten Baues, von 1524-69. Das prächtige Portal, dessen Türflügel mit dem Wappen der Stifter Gaetani und Aragon geschmückt sind (1508), führt in das der Kirche angeschlossene Brefotrofio (Waisenhaus), eine der bedeutendsten karitativen Institutionen der Renaissancestadt. Man gelangt zunächst in einen langgestreckten Hof, an dessen rückwärtiger Schmalseite 2 hübsch geschwungene Treppenrampen zu einem Atrium emporsteigen, das einige interessante Renaissance-Skulpturen enthält: Madonna mit Kind von Dom. Gaggini, Verkündigung von Jac. della Pila, u. a. — Durch einen tunnelartigen Gang unter dem Chor der Kirche erreicht man den 2. Hof, von dort führt eine Treppe zur Rechten in einen Raum mit spärlichen Freskenresten des 14. Jh. (St. Michael und Engel): Überbleibsel der Cappella Mormile, die zum Gründungsbau der Kirche gehörte.
Vom 1. Hof aus gelangt man in die unter der Kuppelvierung der Kirche gelegene, gleichfalls von Vanvitelli erbaute Krypta (Erlaubnis zur Besichtigung erteilt der Direktor des Waisenhauses, im 3. Stock des vorderen Gebäudes). Es handelt sich um die Totenkapelle eines unterirdischen Friedhofs, der sich als schmucklose 3schiffige Pfeilerhalle unter dem Langhaus der Kirche hinzieht. Eine Flachkuppel mit
einem (heute verschlossenen) Gitterfenster im Scheitel (d. h. genau unter der Kuppellaterne der Oberkirche) ruht auf einem Kranz von 16 paarweise angeordneten Granitsäulen. Darum ein ringförmiger Umgang mit Kapellennischen (Statuen von Dom. Gaggini, Gius. Sammartino u. a.); dunkle Bänder vor hellen Putzflächen zeichnen die Hauptlinien der Gliederung nach und bilden einen Raum von eigentümlicher, strenger Schönheit, der die große Tradition italien. Krypten fortsetzt.
Luigi und Carlo Vanvitelli, Innenraum - Seitenansicht des Presbyteriums, 1760-1782, Santissima Annunziata in Neapel.
Luigi und Carlo Vanvitelli, Innenraum - Sicht auf den Hauptaltar, 1760-1782, Santissima Annunziata in Neapel.
Luigi und Carlo Vanvitelli, Krypta - Succorpo, 1760-1782, Santissima Annunziata in Neapel.
Luigi und Carlo Vanvitelli, Krypta - Succorpo, 1760-1782, Santissima Annunziata in Neapel.
Luigi und Carlo Vanvitelli, Krypta - Succorpo: Umgang, 1760-1782, Santissima Annunziata in Neapel.
In den Direktionsräumen der Stiftung eine beachtliche Sammlung von Bildern der neapolitan. Schule des 17. und 18. Jh., darunter 2 prachtvolle Fischstilleben von Giuseppe Recco; außerdem ein Satz von Entwürfen Vanvitellis für die SS. Annunziata: Grundriß, Fassadenaufriß und Schnitt der Krypta sowie ein Längsschnitt durch das sehr viel bescheidenere erste Umbauprojekt mit tambourloser Kuppel und, im Langhaus, Wechsel von Bogen und Architraven zwischen großer Pilasterordnung.
S. Antonio Abate (an der Via Foria, schräg gegenüber dem Albergo dei Poveri) wurde wahrscheinl. von Johanna I. (1343-81) gegründet, im 17., 18. und 19. Jh. durchgreifend restauriert. Hübsche barocke Portikusfassade mit rhythmischem Wechsel von Flach- und Rundbogen (1769-75); das Portal mit Spitzbogentympanon und alter Holztür (um 1400) gehört noch dem Urbau an. Das Innere ist ein flachgedeckter Saalraum. Links vom Eingang eine Madonnenstatue aus dem Umkreis der Brüder Bertini (2. Hälfte 14. Jh.), angebl. Bildnis der Königin Johanna. In der 1. Kapelle rechts weitgehend zerstörte Fresken des 15. Jh. (Grablegung und die hll. Antonio Abate und Caterina d’Alessandria).
S. Antonio di Tarsia (S. Antoniello, S. Maria dello Spirito Santo; an der Salita Tarsia vor dem W-Eingang des Palazzo Spinelli di Tarsia) wurde 1559 gegründet. Die interessante Fassade mit großer Pilasterordnung und über die Attika emporgehobenem Mittelgiebel stammt wohl erst vom Ende des Jahrhunderts; das Innere stets verschlossen.
SS. Apostoli (im NO der Altstadt, an der gleichnamigen Straße zwischen Via del Duomo und Via della Carbonara) Der urspr. den hll. Petrus und Paulus, seit 1587 Philippus und Jakobus geweihte Bau läßt sich bis ins 5. Jh. zurückverfolgen.
Die alte Kirche, eine 3schiffige Basilika von knapp 20 m Länge, mit 7 Säulenarkaden, gelangte 1574 in den Besitz der Theatiner. Diese begannen den Bau zunächst zu vergrößern und umzugestalten; doch war das Resultat so unbefriedigend, daß man sich 1609 bis 1610 zu einem Neubau »a fundamentis« entschloß. Den Entwurf lieferte der Ordensarchitekt Francesco Grimaldi; bei der 1626 in Angriff genommenen Bauausführung wirkten Giov. Giac. Conforto, Bartolomeo Picchiatti u. a. mit. 1632 konnte im Neubau die erste Messe gelesen werden. 1637 begannen die Stuckierungs-
und Vergoldungsarbeiten‚ die sich bis zum Ende des Jahrhunderts hinzogen; 1649 erfolgte die Einweihung des Gebäudes. Die Vierungskuppel wurde erst 1664-80 aufgesetzt. Von größeren Umbauten und Erneuerungen blieb die Kirche seitdem verschont. 1872 wurde der seit der Vertreibung der Theatiner (1806) nur noch notdürftig unterhaltene Bau restauriert; nach dem 2. Weltkrieg mußten verschiedene Bombenschäden, v. a. an der Hauptkuppel, beseitigt werden.
SS. Apostoli ist eine der reichsten Barockkirchen von Neapel. Die Fassade ist undekoriert geblieben. Über eine neuerdings restaurierte Freitreppe von 1685 betritt man das Innere, einen hohen und langen Kapellensaal mit Querschiff, Vierungskuppel und Halbrundapsis, von unbedingt großartiger Wirkung, an der Architektur, dekorative Plastik und Monumentalmalerei gleichen Anteil haben. Der »Gesù-Typ« von Vignolas röm. Jesuitenkirche ist hier in zweifacher Hinsicht ins Barocke abgewandelt. Einmal üben die hohen und weit geöffneten Seitenkapellen wie auch die auffallend großen Stichkappenfenster eine raumerweiternde Wirkung aus; zum anderen erscheint der Gliederapparat verstärkt und von einer dem 16. Jh. ganz fremden Dynamik erfüllt: Die Pilaster sind mit Rücklagen gebündelt, das Hauptgebälk bildet Verkröpfungen, durch welche die »tragenden« Vertikalen bis in die Gewölbezone hinaufwachsen. Deren Aufteilung zumal macht das neue Denken in Gliedern und Kraftlinien deutlich, am stärksten in der Apsiskalotte, die auf den ersten Blick ohne weiteres an got. Rippengewölbe erinnert. — Von höchstem Rang ist die plastische Dekoration, auch sie eine Steigerung und Bereicherung des im späteren 16. Jh. entwickelten Formengutes (Dosio, S. Filippo Neri). Die stärksten Akzente liegen im Vierungsraum: Die Kapitelle der Tragepfeiler sind mit frei erfundenem Rankenwerk ausge-
stattet, aus dem karyatidenähnliche Halbwesen hervorgehen; der Kuppeltambour hat eine Art Phantasieordnung aus Hermenpilastern mit Laub- und Fruchtgehängen von der üppigen Gestalt einer ephesischen Artemis.
Fra Francesco Grimaldi, Santi Apostoli - Innen: Langhausansicht mit Presbyterium, 1610-1649, Neapel.
Fra Francesco Grimaldi, Santi Apostoli - Innen: Querhausansicht, 1610-1649, Neapel.
Giovanni Lanfranco, Deckenfreskenzyklus, 1638-1646, Santi Apostoli in Neapel.
Giovanni Lanfranco, Deckenfreskenzyklus, 1638-1646, Santi Apostoli in Neapel.
Ausstattung. Die Ausmalung der Gewölbezone lag in den Händen Giovanni Lanfrancos, der hier, nach seinen Triumphen im Gesù Nuovo, in S. Martino und in der Gennaro-Kapelle des Domes, den letzten und umfangreichsten seiner neapolitan. Freskenzyklen schuf (1638-46). Das große Muster aller späteren Gewölbemalerei, Michelangelos Sixtinische Decke, bildet den Ausgangspunkt des Systems; allein die spannungsvolle Innerlichkeit der Figurenwelt des Florentiners hat sich in einem Wirbel barocker Bewegungsmotive entladen. Hauptgegenstand der Bilder sind die mit peinlichster Drastik geschilderten Martyrien der Apostel. In der Lünette der Eingangswand Matthias, Simon und Judas; in den Mittelfeldern des Langhausgewölbes Thomas, Bartholomäus und Johannes, im 5., kleineren Feld deren Glorie; in den Kreuzarmen links Petrus und Paulus, rechts Andreas und Jacobus Maior, im Chorarm Philippus und Jacobus Minor (in den Lünetten bzw. den Stichkappen jeweils das Martyrium, im Gewölbe die in konsequenter Untersicht gegebene Glorie). — Die Fresken des Vierungsraumes bleiben thematisch im Rahmen des Herkömmlichen, zeigen aber kühne formale Neuerungen: Durch die Kuppelzwickel blickt man in den freien Himmel, WO auf Wolken die mächtig bewegten Gestalten der Evangelisten thronen, 8 sitzende Atlanten stützen den von unten sichtbar gemachten Fußring des großen Tambours. Die Kuppelkalotte enthält eine allgemeine Himmelsglorie (»Il Paradiso«) von dem Lanfranco-Nachahmer Giov. Battista Beinaschi nach dem Vorbild der S.-Gennaro-Kapelle (1684). — In der Stichkappenzone des Langhausgewölbes sitzen und stehen herkulisch gebaute Patriarchen, Tugenden, Propheten und Apostel. Unterhalb des Hauptgebälks, in den Zwickeln über den Kapellenbögen, befanden sich urspr. Heiligenfiguren von Giacomo del Pò; sie wurden 1693 durch die heute bis zur Unkenntlichkeit verschmutzten Leinwandbilder von Solimena ersetzt. — Die Eingangswand endlich trägt das leider stark zerstörte Fresko der Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda (»la piscina probatica«). Die riesige, streng symmetrisch gebaute Architekturbühne (die 5 Hallen der biblischen Erzählung: Joh. 5, 2-9) stammt von Viviano Codazzi; Lanfranco malte die hin und her wogende Masse der Figuren hinein; rechts vom die eigentliche Wunderszene (»Nimm dein Bett und gehe heim«).
Langhauskapellen. Linke Seite: 1. Schönes hellfarbiges Altarbild von Fr. de Mura: Eine Frau empfiehlt ihr Kind den sel. Giovanni Marioni und Paolo Burali d’Arezzo. — 2. Am Altar Vision des hl. Gregor, von Domenico Fiasella; Wand- und Gewölbefresken von Giacomo del Pò (1711). — 3. Altarbild von
Agostino Beltrano, Madonna mit dem hl. Cajetan (1655/56); Fresken von Giacomo Farelli (1671). — 4. Altarbild mit dem hl. Michael, der eine Seele aus dem Fegefeuer rettet, viell. von Marco Pino; Fresken von Beinaschi.
Rechte Seite: 1. Ein großer Zyklus mit Wundertaten des hl. Nikolaus von Bari (nach der Legenda Aurea), von Nicola Malinconico (1673-1721). Am Altar Aufrichtung des Kreuzes über einem zerstörten Götzenbild. An der linken Seitenwand erweckt der Heilige die versiegte Trinkwasserquelle eines Dorfes zu neuem Leben; rechts stößt er eine Säule eines zerstörten Diana-Tempels ins Meer; in der Kuppel stillt er einen vom Teufel verursachten Sturm und macht 3 Knaben, die ein böser Wirt geschlachtet, eingepökelt und seinen Gästen als Fisch vorgesetzt hatte, wieder lebendig; die anderen Szenen sind leider nicht mehr erkennbar. — 2. Szenen aus dem Leben des hl. Ivo, von Fiasella (Altarbild) und Paolo de Matteis (Seitenbilder); Grabstein des Vincenzo Ippolito von Gius. Sammartino (1776). — 3. Holzkruzifix von Agniello oder Francesco Stellato (1. Hälfte 17. Jh.). — 4. Am Altar S. Andrea Avellino, mit hübscher Ansicht von Neapel (Mitte 17. Jh.); seitlich Geschichten des Heiligen, aus der Werkstatt des Malinconico; schöne Marmorbüsten der Brüder Antinori, von Giuliano Finelli.
Querschiff: Der linke Querschiffarm wurde 1647-53 im Auftrag des Kardinal-Erzbischofs Ascanio Filomarino als Verkündigungskapelle (Cappellone dell’Annunziata) ausgestattet. Einige der größten Künstler des italien. Hochbarock haben hier zusammengearbeitet. In der Ädikula-Architektur der Altarwand (Tafel S. 49) schuf Francesco Borromini eine konzentrierte Version seiner röm. Filippo-Neri-Fassade: ein hermetisch geschlossenes, in jeder Linie von Spannung erfülltes Gebilde, dessen Einzelmotive — konkav-konvexe Gesamtbewegung, Rahmenprofile mit eingerundeten Ecken, kurvig geschweifter Giebelkontur u. a. — von den Meistern des späteren »barocchetto« hemmungslos ausgemünzt wurden. — Die 5 Mosaikbilder — eine herrliche Verkündigung Mariae, begleitet von »Liebe«, »Glaube«, »Standhaftigkeit« und »Hoffnung« — fertigte G. B. Calandra nach Entwürfen Guido Renis; das gleiche scheint für die beiden Porträtmedaillons des Ascanio und Scipio Filomarino zu gelten, die den Altaraufbau flankieren. Als plastischen Beitrag lieferte Francois Duquesnoy den Puttenfries der Predella; die dekorative Skulptur der Sockelzone stammt von Andrea Bolgi. Die Altarmensa zeigt einen dorischen Fries, in dessen Metopen die Evangelistensymbole erscheinen; darunter 2 majestätische Löwen (von Giuliano Finelli) und ein Medaillon mit dem Opfer des Isaak (Giulio Mencaglia). Finelli arbeitete auch, zweifellos nach einem Entwurf Borrominis, die kapriziöse Kapellenbrüstung mit ihrem Wechsel von stehenden und hängenden, im Querschnitt dreieckigen Balustern, deren ausschweifender Grundriß den. genauen Kontrapunkt zur Bewegung der Altarwand bildet. — An den Seitenwänden der Kapelle endlich kommt mit
Luca Giordano doch noch der Neapler Barock zu Worte (links Josephs Traum, rechts die Anbetung der Hirten).
Der rechte Querschiffarm bildet als Cappellone dell’Immacolata (gestiftet von Kardinal-Erzbischof Francesco Pignatelli 1721-23) das Gegenstück des linken. Die Immacolata auf der Mondsichel ist ein Bild des späten 16. Jh.; zu seiten 4 Frauen des Alten Testaments, Gemälde auf Kupfer von Francesco Solimena. Der bronzene Engelreigen der Predella stammt von Matteo Bottiglieri; dem reich mit Marmor verzierten Altar liegt ein Entwurf Solimenas zugrunde.
Der Hochaltar, mit pompösem Tabernakelaufbau, ist ein anonymes Werk des 18. Jh.; an der Chorbalustrade 2 Bronzekandelaber mit den Evangelistensymbolen von Andrea Bolgi. — In der Chorapsis 5 große Leinwandbilder von Lanfranco mit Erscheinungen und Szenen aus dem Leben hll. Theatiner; Chorgestühl des 16. Jh. (aus der alten Kirche), 1640 restaur. und erweitert.
Nebenräume: Vom linken Querarm aus betritt man ein Vestibül mit einem Kenotaph des Bischofs Gennaro Filomarino von Giuliano Finelli (1649). Der anschließende Durchgangsraum führt in die Sakristei, einst eine der prächtigsten von Neapel, heute im Zustand trostloser Verwahrlosung. Die Dekoration entwarf Ferdinando Sanfelice (1725-35); die Fresken-Himmelfahrt Mariae, Opfer des Aaron, Triumph der Judith, Begegnung Jakobs mit Rebekka — gehören zu den besten Werken des N. Malinconico (1706).
Ein charakteristischer Zug des Innenraums von SS. Apostoli ist das Fehlen der Grabmonumente, die sonst überall in neapolitan. Kirchen eine beherrschende Rolle spielen. Es erklärt sich daraus, daß der Neubau in seiner ganzen Ausdehnung auf einer 1636 geweihten, als Grablege bestimmten Unterkirche steht, die durch die beiden Seitenportale der Eingangsfassade zugänglich ist bzw. war. Der Raum wird heute verschlossen gehalten; er diente 1944 den Alliierten als Lebensmitteldepot, später als Notunterkunft für Obdachlose und scheint sich derzeit in einer Verfassung zu befinden, die eine Besichtigung ausschließt. Nach älteren Beschreibungen enthält er eine Reihe von Grabmälern — darunter das des Dichters Giov. Battista Marino, der 1625 im Jahre seines Todes, einige Monate bei den Theatinern von SS. Apostoli zubrachte — und einen wohl zu Unrecht dem Lanfranco zugeschriebenen Zyklus von Wandfresken (Beweinung und Grablegung Christi, Marientod, Auferweckung des Lazarus u. a.).
Ascensione a Chiaia (an der gleichnamigen Piazzetta zwischen Riviera di Chiaia und Corso Vittorio Emanuele, oberhalb der Villa Pignatelli)
An Stelle eines trecentesken Vorgängerbaus (Coelestinerkonvent) errichtete Cosimo Fanzago zwischen 1622 und 1645 die heutige Kirche, einen Zentralbau über griech. Kreuz mit kurzen Armen, Rechteckchor und auffallend hoher, steil profilierter Tambourkuppel. Den Eingang bildet eine 3bogige Pfeilerhalle mit dorischer Pilasterordnung, die auf den charakteristischen Rhythmus der Sapienza-Fassade (s. S. 224) vorausweist.
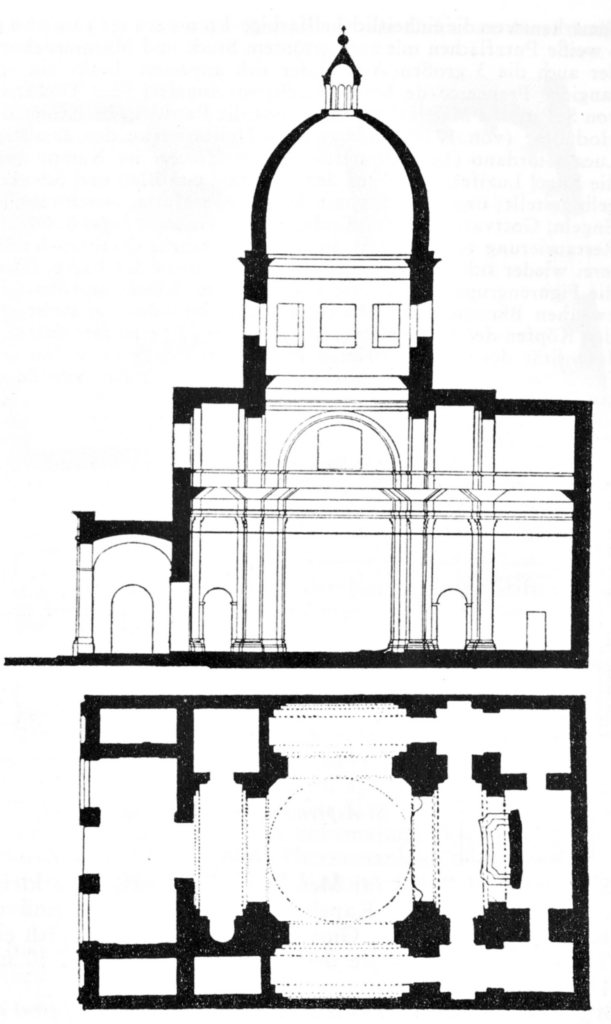 Ascensione a Chiaia. Längsschnitt und Grundriß
Ascensione a Chiaia. Längsschnitt und Grundriß
Bemerkenswert die einheitlich hellfarbige Innenausstattung — weiße Putzflächen mit zart getöntem Stuck und Marmordekor —, der auch die 3 großen Altarbilder sich anpassen. Links ein erstrangiger Francesco de Mura: S. Pietro Angelari (der Titelheilige von S. Pietro a Maiella) verzichtet auf die Papstwürde. Hinter dem Hochaltar (von 1738) und rechts 2 Meisterwerke des 25jährigen Luca Giordano (1657): ein furioser St. Michael im Kampf gegen die Engel Luzifers, ganz auf den Kontrast von Blau und Schwefelgelb gestellt; und St. Anna mit der kleinen Maria, umschwebt von Engeln, Gottvater und der Taube des Hl. Geistes (Tafel S. 96). Die Restaurierung von 1954 hat die außerordentliche Qualität der Malerei wieder sichtbar gemacht: satt und frisch in der Farbe, scheint die Figurengruppe überglänzt vom Licht der Küstenlandschaft, die zwischen Blumen und Gebüsch des Mittelgrundes auftaucht. Aus den Köpfen der Frau und des Mädchens spricht eine fast tizianeske Intensität des Gefühls; Tizian mehr noch als Veronese hat auch für Komposition und architektonische Rahmung das Vorbild geliefert.
 S. Aspreno al Porto. Längsschnitt
S. Aspreno al Porto. Längsschnitt
S. Aspreno al Porto (ai Mercanti, ai Tintori), eine kleine, ehemals freistehende Kapelle, heute im Untergeschoß des Börsenpalastes (Piazza Giov. Bovio), zugänglich durch eine Tür an der linken Seite des Gebäudes, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr
Asprenas, der sagenhafte erste Bischof von Neapel, den Petrus auf seinem Wege von Antiochia nach Rom katechisiert, getauft und in das Hirtenamt eingesetzt haben soll, wurde seit dem 9. Jh. als Hei-
liger verehrt; in die gleiche Zeit scheint sein Kultus an dieser Stelle zurückzugeben.
Die heutige Gestalt verdankt der Raum einem Stifter vom Ende des 17. Jh. Bei seiner Ausstattung fanden Überreste des demolierten Quattrocento-Kreuzgangs von S. Pietro ad Aram Verwendung. Das auf einem gedrehten Säulchen stehende Weihwasserbecken ist eine röm. Aschenurne; zu seiten des Altars finden sich 2 reliefierte marmorne Schrankenplatten (Pflanzen, Tiere und Kelche in rautenförmigem Feldermuster, oben eine griech. Stifterinschrift sowie 2 Pfeiler mit Kapitellen und Konsolen, wohl aus dem 10. Jh.). — Ein Treppchen zur Rechten führt hinab in eine längliche tonnengewölbte Kammer mit Spuren von Freskobemalung (Vorhänge), möglicherweise Teil einer röm. Thermenanlage oder auch eines Mithraeums, die später christl. Kultzwecken gedient zu haben scheint.
S. Brigida (Via S. Brigida, zwischen Castel Nuovo und Via Toledo)
Der Kunstwelt bekannt als Grabkirche Luca Giordanos, dessen Fresken und Leinwandbilder zugleich den Höhepunkt ihrer Ausstattung bilden.
Die Titelheilige, Brigitte von Schweden (* 1303 in Finstad bei Uppsala, + zu Rom 1373, 1392 von Bonifaz IX. heiliggesprochen), eine der imponierendsten Frauengestalten des ausgehenden Mittelalters, ist auf ihren Pilgerfahrten verschiedentlich nach Neapel gekommen, wo sie am Hofe der Königin Johanna I. verkehrt, aber auch mit Umsicht und Tatkraft sich als Armen-und Krankenpflegerin betätigt hat. Beim Volk von Neapel hinterließ ihre Erscheinung einen unauslöschlichen Eindruck, der sich in einem fortdauernden Brigida-Kultus niederschlug. Das ihr geweihte, um 1600 gegründete Filippiner-Oratorium an der Strada di S. Brigida wurde 1637 von den Padri Lucchesi della Madre di Dio übernommen, die 3 Jahre später den Grundstein der heutigen Kirche legten. Den Plan des Neubaus lieferte der sonst nicht weiter bekannte Architekt Natale Lunghi. Der Bau gedieh zunächst nicht über die 1647 geweihte O-Partie (Chor, Querschiff, Vierungskuppel) hinaus; das von F. A. Picchiatti entworfene Langhaus wurde 1675 begonnen, 1721-24 zu Ende geführt. 1726 kam die Fassade hinzu, deren Oberteil jedoch 1825 verändert wurde (ein prächtiger Fassadenentwurf Filippo Juvaras von 1706 war unausgeführt geblieben). Eingreifende Restaurierungen von 1852-57 und 1892-95 betrafen die Stabilität des Mauerwerks, aber auch viele Einzelheiten der Innendekoration. Im März 1918 durchschlug eine österreichische Zeppelinbombe das Schiffsgewölbe und zerstörte die aus dem 19. Jh. stammenden Deckengemälde; sie wurden 1927 erneuert.
Das kurze, aber sehr hohe Langhaus wirkt dank Picchiattis geschickter rhythmischer Unterteilung als in sich zentrierter Saal; das fein abgestufte Relief der Wandgliederung erhält durch die vorschwingenden Coretti-Brüstungen der Mitteljoche einen leicht rokokohaften Akzent.
In der jeweils 1. Kapelle der Langhausseiten befinden sich 2 Meisterwerke Luca Giordanos: links eine von Pietro da Cortona inspirierte Hl. Anna, rechts ein Hl. Philippus in Anbetung der Madonna. — Die 2. Kapelle links enthält eine wundertätige Madonnenfigur, die 2. Kapelle rechts einen Hl. Joseph von dem spanischen Giordano-Schüler Franceschitto. — Für die tambourlose Vierungskuppel war aus militärischen Gründen — sie lag im Schußfeld der Kanonen von Castelnuovo — eine Maximalhöhe von 18 Palmi (etwa 4,75 m) vorgeschrieben; dem. Pinsel Giordanos blieb es vorbehalten, hier den Eindruck luftigster Weite zu erzeugen. Man blickt in ein Wolkenreich, in dem sich im Beisein zahlloser himmlischer Assistenzfiguren die Apotheose der" Titelheiligen vollzieht. In den Zwickeln, statt der üblichen Evangelisten, hier 4 Frauen des Alten Testaments: Judith, Deborah, Ruth und die Witwe von Sarepta (1678).
Im linken Querarm hat der 1705 verstorbene Meister sein Grab gefunden, zu Füßen eines der herrlichsten Bilder seiner Frühzeit (1655). Es stellt ein Mirakel des hl. Nikolaus dar, der als Bischof
von Mira in Kleinasien einen von Korsaren geraubten Knaben rettet und nach wunderbarer Luftreise seinen Eltern zurückerstattet. Der Heilige schwebt von Engeln getragen hernieder; mit seiner Rechten hat er den Knaben am Schopf gepackt; dieser hält noch das Tablett mit den Trinkgefäßen von der Tafel des Seeräuberkönigs, wo er die Dienste eines Mundschenks zu versehen hatte. Das überwältigte Elternpaar kniet im Vordergrund rechts; links die vielköpfige Menge der Armen, an welche die beiden gerade Almosen verteilt hatten. Unfehlbare Zeichnung, zarteste Stufung der Schattentöne, Harmonie und Frische des Kolorits bezeugen das einzigartige Talent des jungen Virtuosen; in der Kunst, ein bewegtes Ganzes aus lauter schönen Einzelmomenten zusammenzubilden, ist nur Veronese ihm gleichgekommen. — Auf ähnlicher Höhe bewegt sich Massimo Stanzione im Hauptbild des rechten Querarms. Es stellt den Hl. Antonius von Padua dar, der das Jesuskind in Empfang nimmt; monumental und pathetisch kniet die Gestalt des Mönches inmitten einer klassischen Ruinenlandschaft, deren lichterfüllte Atmosphäre auf wunderbare Weise in den Wolkenhimmel der Vision hinüberspielt.
S. Carlo all’Arena (Via Foria)
Die Kirche steht an der Stelle eines 1602 errichteten kleinen Karl-Borromäus-Oratoriums. Der von Fra Nuvolo (Giuseppe Donzelli) entworfene Neubau, 1610 beg., war 1623 bis zum Hauptgesims aufgemauert. Nach dem Tode des Architekten scheint niemand sich zugetraut zu haben, die Ovalkuppel einzuwölben. Erst 1680 wurde das schwierige Unternehmen in Angriff genommen; im Jubeljahr 1700 fand der erste Gottesdienst in der neuen Kirche statt. Das große Erdbeben d. J. 1805 brachte die Kuppel fast wieder zum Einsturz; das Gebäude mußte geschlossen, alle seine Öffnungen vermauert werden. 1837 erhielt die Kirche ihre heutige Gestalt nach den Plänen von Francesco de Cesare; eine gründliche Restaurierung erfolgte 1925 ff., nachdem 2 Jahre zuvor ein durch Kurzschluß verursachtes Feuer schwere Verwüstungen angerichtet hatte.
In der Gestaltung des Außenbaus hat De Cesare sich so eng wie möglich an das Vorbild des Pantheons angeschlossen. Die durch eine Pilasterstellung angedeutete Vorhalle hätte nach seinem ersten, vom Bauherrn als zu aufwendig abgelehnten Projekt als regelrechter Säulenportikus ausgeführt werden sollen; auch sah er 2 Glockentürme vor, die Berninis damals noch stehenden Pantheon-»Eselsohren« entsprochen hätten. — Das Innere dürfte in seinen Hauptlinien noch immer den Plan des Fra Nuvolo widerspiegeln: ein Längsoval mit 8 gleich großen Öffnungen (Eingang, Chorkapelle und je 3 Seitenkapellen), 8 ebenfalls gleiche Pilasterpaare, ununterbrochen umlaufendes Haupt-
gebälk und geschlossene Kuppelschale — im ganzen ein sonderbar richtungsloses Gebilde, in dem nur die stetig sich ändernde Krümmung der Wände dem Beschauer ein vages Gefühl von Axialität vermittelt.
In der 2. Kapelle rechts befindet sich ein ausgezeichnetes Marmorkruzifix von Michelangelo Naccherino, das beim Brand von 1923 in zahllose Stücke zersprungen und danach wieder zusammengesetzt worden ist; eine Bronzekopie am Hochaltar. Die übrige alte Ausstattung ist dem Feuer zum Opfer gefallen.
S. Carlo alle Mortelle (Vico S. Carlo alle Mortelle), am Abhang eines ehemals mit Myrten — neapolitanisch »mortelle« — bewachsenen Hügels unterhalb des Corso Vittorio Emanuele, hat eine hübsche Spätbarockfassade von Enrico Pini, 1734, mit ganz leichter, nur durch Verkantung der mittleren Pilaster bewirkter Schwingung und feinem Stuckdekor; in den Nischen Statuen der hll. Karl Borromäus, Augustinus und Thomas von Villanova. — Das Innere, 1616 begonnen und im 19. Jh. stark restauriert, ist ein einfacher Saalraum mit je 3 rhythmisch gruppierten Seitenkapellen, Pilastervorlagen und etwas gedrücktem Tonnengewölbe, einem Querschiffjoch und rechteckigem Presbyterium. — In der 3. Kapelle links ein hl. Liborius von Luca Giordano; in der Sakristei Deckenfresken (Gloria di S. Carlo) und ein Altarbild von Benedetto della Torre (1772).
S. Caterina a Chiaia (auch S. Caterina Martire; in der Via Chiaia, neben dem Palazzo Cellamare), ein Saalbau mit je 3 Seitenkapellen, leicht ausgeweiteter Kuppelvierung und 3 kurzen Kreuzarmen, vom Anfang des 17. Jh.; später mehrfach restaur. Hochaltarbild (Vermählung der hl. Katharina) von Antonio Sarnelli; im Querschiff links S. Anna von Benedetto della Torre.
S. Caterina a Formiello (a Porta Capuana)
Die Kirche ist der unter Maxentius hingerichteten Märtyrerin von Alexandrien geweiht und führt ihren Zunamen nach der antiken Wasserleitung (neapolitanisch »formale« : Aquädukt), die hier ins Stadtgebiet eintrat.
Die erste Erwähnung des Titels und eines mit ihm verbundenen Coelestinereremiten-Konvents datiert von 1457. I. J. 1498 ging das Kloster an die Dominikaner über. Diese errichteten zunächst ein neues Konventsgebäude, das 1514 vollendet war; 5 Jahre später wurde der Bau der heutigen Kirche in Angriff genommen. Als Architekt wird der sonst vorwiegend als Steinmetz und Bildhauer bekannte Romolo Balsimelli aus Settignano hei Florenz genannt; stilistisch hängt der Bau eng mit Francesco di Giorgio Martini zusammen, der sich in den 90er Jahren des Quattrocento mehrfach in Neapel aufgehalten hatte. Über Einzelheiten der auffallend langwierigen Baugeschichte sind wir nicht informiert. Erst in den 1570er Jahren war die Kirche fertiggestellt, und manche Details des Außenhaus (Fassade, Obergeschoß) weisen schon eher auf das Ende dieser Periode. 1593 wurde der Campanile hinzugefügt; das
Eingangsportal mit der Figur der hl. Katharina entwarf Francesco Antonio Picchiatti 1655.
In der Behandlung von Raum und Körper, Fläche und Wandgliederung erscheint S. Caterina als verspätete Realisierung eines Bauideals der toskanischen Frührenaissance; kaum je im 15. Jh. ist die rationale Durchbildung des Grund- und Aufrißsystems der kreuzförmigen Langhauskirche so weit getrieben worden. Aber auch die spezifisch süditalien.
Tradition des monumentalen Kubusbaus ist in die Gestalt des Äußeren eingegangen. Langhaus und Seitenkapellen, Querschiff, Chorapsis und Vierungskuppel treten als stereometrisch reine Gebilde hervor; nur die den Obergaden verstrebenden Schneckenvoluten mit ihren Zierobelisken bringen einige Bewegung in den Kontur. In der Wandgliederung dominieren die Horizontalen: Ein großer mehrstufiger Sockel umzieht das Gebäude; die Geschosse setzen sich klar voneinander ab; das obere wird in seinem vorderen Teil von einer Attika-Balustrade bekrönt. 2 ringsumgeführte Pilasterordnungen markieren das Jochsystem; Haupt- und Querschiffstirnwände sind durch Doppelpilaster ausgezeichnet; große kreisrunde Okuli unterbrechen dort die Folge der Rechteckfenster, deren giebelgeschmückte Ädikula-Rahmen in allen Einzelheiten denen Francesco di Giorgios in Cortona (Madonna del Calcinaio) nachgebildet sind.
Der rigorose quadratische Schematismus, der alle Teile des Innenraums determiniert, macht diesen mit einem Blick überschaubar. Haupt-wie Nebenräume sind tonnengewölbt; daher ist von den 2 Ordnungen des Außenbaus im Innern nur die untere übriggeblieben: Die Oberfenster des Schiffes liegen schon in der Gewölbezone und passen sich in ihrer Innenöffnung den Bögen der Stichkappen an. In feiner Überlegung sind die Formen der auf hohen Piedestalen stehenden Pilastergliederung differenziert: Die in den Raum einspringenden Vierungspfeiler, welche die Last der Kuppel tragen, zeigen einen anderen, reicheren Kapitelltyp als die einfachen Kompositpilaster der Wandordnung. Der urspr. Farbeffekt — dunkle Hausteingliederung vor hell verputztem Wandgrund — ist durch die spätere Stuckdekoration verdorben.
Ausstattung. 1696 freskierte Luigi Garzi aus Pistoia das Schiffsgewölbe (Verlobung der hl. Katharina von Alexandrien und Glorie der hl. Katharina von Siena); von dem gleichen Künstler
stammen das Fresko der Eingangswand (Martyrium der Katharina, 1695) und die 4 die Tugenden der Titelheiligen verherrlichenden Allegorien der Kuppelzwickel (Glaube, Keuschheit, Sanftmut und Bußfertigkeit, 1698). Die stark verdorbenen Kuppelfresken (die beiden Katharinen und andere Heilige in Anbetung der Trinität) stammen von Paolo de Matteis (1712); diejenigen in Querschiff und Chorarm (Leben des hl. Dominikus und Triumph der Judith) von dem Antwerpener Wilhelm Bornemans (1708/09).
In der 1. Seitenkapelle links eine interessante Madonna mit Jacobus Maior und Jacobus Minor, dem Neapolitaner Francesco Curia zugeschr. (Ende 16. Jh.). — 2. Kapelle: Madonna mit Dominikanerheiligen von Antonio del Gamba (1739); schöner Majolikafußboden vom Anfang des 16. Jh. — 3. Kapelle: die Apostel Johannes, Jakobus und Petrus (neapolitanisch, Ende 16. Jh.). — 4. Kapelle: Geburt und Vermählung Mariae, von L. Garzi. — 5. Kapelle: Szenen aus dem Leben der hl. Katharina von Alexandrien (sie disputiert mit Philosophen, weigert sich, den heidnischen Göttern zu opfern, und wird enthauptet), von Giac. del Pò. Die marmorne Kanzel stammt von Francesco Antonio Gandolfi (1750).
2. Seitenkapelle rechts: am Hochaltar eine Epiphanie von Silvestro Buono, an den Seiten 2 schöne Bilder von Paolo de Matteis: Darbringung im Tempel und Flucht nach Ägypten (1720); Majolikafliesen von 1576. — 4. Kapelle: Madonna mit dem hl. Thomas von Aquino und den beiden Katharinen von Wenzeslaus Koberger (1590); zur Rechten das Grab des Luigi Acciapaccia von Annibale Caccavello (1552). Hier und in der folgenden Kapelle nochmals hübsche Majolikaböden, 1. Hälfte 16. Jh. — 5. Kapelle: Fresken (Wundertaten des S. Vincenzo Ferreri) und Altarbild (S. Vincenzo und S. Pio V. beten die Trinität an) von Santolo Cirillo (1730 bis 1733).
An den Kuppelpfeilern Grabmäler der Familie Spinelli: links Traiano, von Giov. Dom. d’Auria (1569), und seine Ehefrau Caterina Orsini, von Silla Longo (1581); rechts Giovanni Vincenzo (+ 1576), wahrscheinl. von Girolamo d’Auria. — Querschiffaltäre: links S. Domenico, von Giac. del Pò; rechts Madonna mit Heiligen, von Paolo Benaglia (1736-38). — In der Apsis Fresken von Nic. M. Rossi (1. Hälfte 18. Jh.) und ein sehr gutes Chorgestühl von Benvenuto Tortelli, Domenico da Firenze und Giov. Lorenzo da Sanseverino (1566).
Das zur Linken der Eingangsfassade gelegene, heute in Wohnungen aufgeteilte Konventsgebäude läßt nur noch schwache Spuren der alten Architektur erkennen. Nach Passieren der Torfahrt Nr. 46 gelangt man in einen weiten Hof mit 2 Arkadengeschossen (beg. 1514), der ehemals sehr schön gewesen sein muß; die Detailbildung der Erdgeschoßarkaden zeigt auffällige Übereinstimmung mit dem Portal des Palazzo Marigliano in der Via S. Biagio dei Librai von Mormando.
S. Caterina da Siena (Salita Cariati, unterhalb des Corso Vittorio Emanuele) wurde um 1760 von Mario Gioffredo errichtet. Die Vorhallenfas-
sade mit vorspringendem Mittelcorps, geschickt auf die doppelte Perspektive der Straßenbiegung berechnet, gehört zu den interessantesten Leistungen Gioffredos. Das Innere — ein querschiffloser, tonnengewölbter Saal mit je 3 flachen Seitenkapellen, Eingangsempore und Apsis in voller Schiffbreite — zeigt die etwas gedrückte Stimmung des beginnenden Klassizismus, wozu das späte Rokoko des dekorativen Beiwerks (Coretti-Gitter, Altarrahmen) einen sonderbaren Kontrast abgibt. Gewölbefresken (Glorie der hl. Katharina, Dominikanerheilige, Evangelisten) von Fedele Fischetti (1766); von dem gleichen Meister die hll. Dominikus und Augustinus in der 3. Seitenkapelle links und der 1. rechts; von Giacinto Diana Kreuzigung (1782) und Beschneidung in der 2. und 3. Kapelle rechts.
S. Chiara (Piazza Trinità Maggiore)
Die Kirche ist eines der größten und eigenartigsten Monumente der angiovinischen Gotik. Sie bildet den monumentalen Mittelpunkt eines Klosterkomplexes, der an Ausdehnung selbst die Certosa von S. Martino übertrifft. Heute auf allen Seiten von dicht bebauten Wohnvierteln umgeben, lag das durch eigene Mauern geschützte Kloster urspr. zwischen Gärten und Obstpflanzungen am westl. Rande der Stadt, noch außerhalb des mittelalterl. Mauerrings, der etwa in der Linie Via S. Sebastiano — Via. S. Chiara verlief.
Die Stiftung des von Petrarca als »Clarae virginis praeclarum domicilium« besungenen, von dem Renaissance-Humanisten Flavio Biondo als erstes Kloster Italiens gepriesenen Bauwerks wird Sancha von Mallorca, der aus dem Hause Aragon gebürtigen Gemahlin Roberts d. Weisen, verdankt. Die fromme Königin, dem Klosterleben von Jugend an zugetan, gedachte sich nach dem Tode ihres Gatten in die Gemeinschaft der von ihr gerufenen Klarissen zurückzuziehen (tatsächlich verbrachte sie ihr letztes Lebensjahr 1344/45 als »Suora Chiara« bei den Nonnen von S. Croce di Palazzo am Chiatamone, die einer noch strengeren Regel unterworfen waren). 1310 legte König Robert den Grundstein zu der dem Corpus Christi geweihten Kirche (der Name der hl. Klara bezeichnet kein eigentliches Patrozinium, sondern ist aus der Übertragung des Ordensnamens auf das Kirchengebäude entstanden). Die Überlieferung nennt 2 Baumeisternamen, den »protomagister operis monasterii Sancti Corpus Christi« Leonardo di Vito, dem die Königin 1318 zum Dank für geleistete Dienste ein Stück Land schenkt, und den auch anderweitig als Architekt bezeugten Gagliardo Primario, der auf einem im 18. Jh. zerstörten Grabstein von 1348 gleichfalls als »Protomagister« des Unternehmens bezeichnet wurde. Schon 1316 war der Bau so weit fortgeschritten, daß man in der neuen Kirche Messe lesen konnte. Ein Jahr später erteilte Papst Johannes XXII. die Genehmigung, dem Klarissenkloster einen Konvent von Franziskanern anzugliedern, die den Gottesdienst in der Kirche versehen sollten; gleichzeitig wurde
den Nonnen strengste Klausur auferlegt. 1328 wird von Arbeiten am Dach der Kirche berichtet; 1330 war der Rohbau fertiggestellt. Weitere 10 Jahre vergingen bis zur offiziellen Einweihung des Gebäudes, die im Beisein des Königspaares und des gesamten Hofstaates vollzogen wurde. Von da an fungierte die Klarissenkirche als eine Art Staatsheiligtum des neapolitan. Königreiches: Sie bildet den Schauplatz der Krönung Johannas I. (1343), der feierlichen Eidesleistungen der Barone und v. a. die bevorzugte Grabkirche des Hauses Anjou.
Das große Erdbeben von 1456 richtete schwere Verwüstungen an; nach mannigfachen Restaurierungsarbeiten des 16. und 17. Jh. unterzogen Gaetano Buonocuore, Giov. del Gaizo und Dom. Ant. Vaccaro 1742-47 das Innere einer durchgreifenden Erneuerung, aus der es als eines der schönsten spätbarocken Interieurs von Neapel hervorging. Ferdinando Fuga entwarf einen neuen Marmorfußboden, Francesco de Mura, Sebastiano Conca, Giuseppe Bonito u. a. schufen Wand- und Gewölbefresken. Am 4. August 1943 lösten in das Kirchenschiff einschlagende Fliegerbomben eine tagelang wütende Feuersbrunst aus; fast die gesamte barocke Innenausstattung fiel den Flammen zum Opfer, zahlreiche ältere Kunstwerke wurden vernichtet oder irreparabel beschädigt. Von den teilweise stehengebliebenen Umfassungsmauern aus wurde der Bau nach Beendigung des Krieges erneuert, wobei man bestrebt war, ihm nach Möglichkeit seine got. Urform zurückzugeben.
Im gegenwärtigen Baubestand erscheinen die Resultate dieser wechselvollen Geschichte in fast unauflöslicher Vermengung; erst das Studium der Restaurierungsakten könnte in Detailfragen Klarheit schaffen. Heute wie ehemals imponiert das Äußere durch die kubische Mächtigkeit des Langhausblockes, dessen gelblich-graue Tuffsteinmauern weithin sichtbar über das Häusermeer der Stadt emporragen. Die Längswände sind nach zisterziensischem Brauch oberhalb der Kapellenzone durch einfache vierkantige Strebepfeiler gegliedert, zwischen denen die hohen und schmalen, nach barocken Veränderungen nun regotisierten Lanzettfenster des Hochschiffs eingebettet liegen. Polygonale Treppentürme markieren die Nahtstellen zwischen dem eigentlichen Langhaus und einem querschiffartigen Abschlußjoch, dessen Außenmauern ohne Rücksprung in der Flucht der Kapellenwände bzw. der Strebepfeilerstirnen bis unter das Dach hinaufreichen; daran schließt sich zwischen 2 längsgerichteten Strebebögen ein wesentlich niedrigerer flachgeschlossener Chorbau.
Die Eingangsfassade wird von wuchtigen Eckverstärkungen
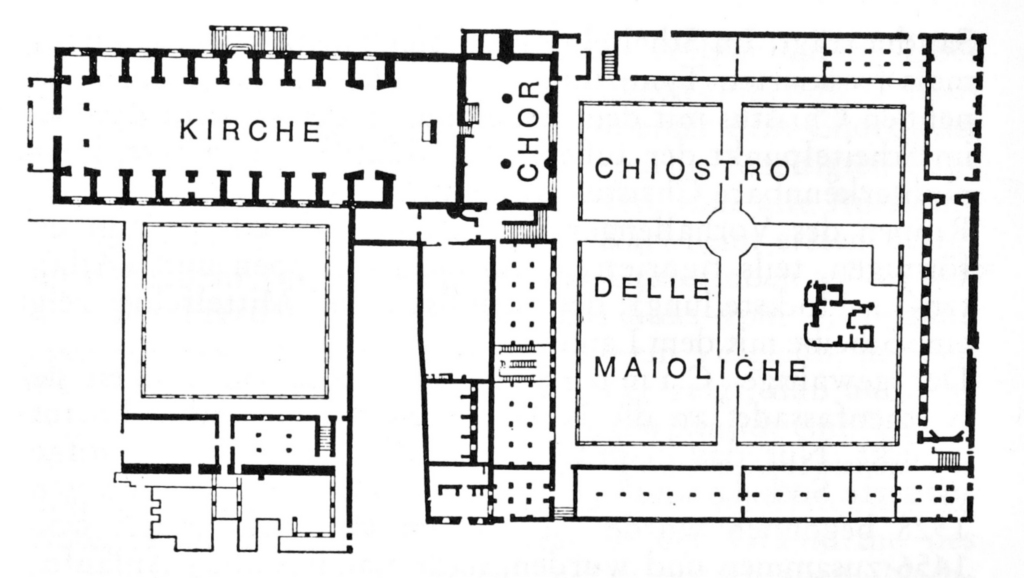 S. Chiara. Kirche und Kloster, Grundriß
S. Chiara. Kirche und Kloster, Grundriß
eingefaßt, die trotz der auffälligen Überschneidung bzw. Verzahnung mit den äußeren Vorhallenpfeilern zumindest in ihren unteren Teilen noch der ersten Bauphase anzugehören scheinen. Ein dünnes Horizontalgesims teilt die l. u. nicht gegliederte Mauerfläche in 2 ungleiche Hälften. Die Mitte des (nach alten Aufnahmen getreu wiederhergestellten) Obergeschosses nimmt ein 6teiliges Rosenfenster ein; senkrecht darüber, im Zentrum des Giebelfeldes, sitzt ein viell. als Trinitätssymbol deutbarer Dreipaß-Okulus.
Ein einziges Portal führt ins Kircheninnere; vor ihm jedoch steht eine in 3 Spitzbögen geöffnete Vorhalle, die ungewöhnlicherweise dem Schema eines röm. Triumphbogens nachgebildet ist (ein großer Bogen, flankiert von 2 kleineren, deren Scheitel unter der Kämpferhöhe des Mittelbogens liegen). Wie die Architektur der gesamten Fassade, so ist auch die der Eingangshalle ganz auf die Wirkung strenger und großer Flächenverhältnisse abgestellt: Glatte, scharfkantig aufeinanderstoßende Mauerstirnen ohne jeden Gliederapparat, nur durch schmale Gesimsleisten abgeteilt oder eingefaßt, lassen die von Quadratur und Triangulatur geregelten Proportionen von Wand und Öffnung rein in Erscheinung treten. Allein die Archivolte des Mittelbogens ist mit einem Profil versehen. Durch sie erblickt man das mit einer feinen Blendarkatur geschmückte, zartfarbige Marmorgewände des Eingangsportals, dessen Türsturz das Wappen der Königin
Sancha trägt. Im Scheitel des Rahmenbogens über dem einstmals freskierten Tympanon thront die Halbfigur eines segnenden Christus mit dem Erdglobus in der Linken; darüber, im Scheitelpunkt der äußeren Blattleiste, eine weitere, kaum noch erkennbare Christus-Büste mit Globus und Zepter. Die Rippen des Vorhallengewölbes ruhen auf teils pyramidenförmigen, teils figurierten Konsolen (Wappen und »Atlanten« in Hockstellung); der Schlußstein des Mittelfeldes zeigt eine Scheibe mit dem Lamm Gottes.
Der gewaltige Campanile steht frei zur Linken der Kirchenfassade, an die NO-Ecke des Grundstückes hinausgerückt. Nur das in prachtvollem Großquaderwerk aufgemauerte Sockelgeschoß gehört dem Urbau an, der spätestens 1328 begonnen wurde; die oberen Partien stürzten wohl 1456 zusammen und wurden, nach mannigfachen Anläufen, erst gegen Ende des 16. Jh. von Costantino Avellone erneuert. 1604 war der Bau bis zu seiner heutigen Höhe gediehen; die Ausführung eines korinthischen Obergeschosses, das die Abfolge der Ordnungen vervollständigen würde, mag aus Furcht vor neuen Erdstößen unterblieben sein. Von besonderem Interesse ist die beim Wiederaufbau neu versetzte got. Bauinschrift, die sich rings um das Untergeschoß zieht: ein authentisches Geschichtsdokument, das in lateinischen Versen die wichtigsten der oben referierten Baudaten der Kirche liefert (Reihenfolge: S-, W-, O-, N-Seite).
Vom Glockenturm aus nach W und S erstrecken sich die Reste der äußeren Begrenzungsmauern des Klosterbezirks, die man jetzt von den später darübergebauten, durch die Bomben zerstörten Häusern befreit hat; erhalten blieben auch die beiden Eingangsportale, einfache Torfahrten mit Stichbogensturz (das früheste Auftreten dieser für die spätere neapolitan. Gotik charakteristischen Bogenform) unter spitzbogigen, schmucklosen Lünettenfeldern; die Außenseite des N-Portals ist durch eine »gronda«, ein schräg vorspringendes, aus Peperinplatten gebildetes Vordach, geschützt.
Vom Inneren des Kirchenraums, in dem soviel Kunst- und reale Geschichte sich abgespielt hat, ist nur mehr das architektonische Gerippe geblieben, und auch für dessen Erhaltung bzw. modernistisch-sachliche Wiederherstellung müssen wir dankbar sein. Der Eintretende sieht sich in einen hohen, kahlen Rechtecksaal von enormen Dimensionen versetzt (92 x 30 m), an dessen Längswänden niedrige, in den
Raum einspringende Kapellenreihen entlanglaufen. Über ihnen liegen von glatten Mauerbrüstungen eingefaßte Emporen, die an der Eingangsseite urspr. in einer dem Chordienst der Franziskaner dienenden, heute spurlos beseitigten Sängertribüne miteinander kommunizierten. Eine alte Anekdote berichtet, daß König Roberts Sohn Karl beim ersten Betreten der Kirche (in der er später sein Grab finden sollte) sich an einen Pferdestall mit rechts und links vom Mittelgang angeordneten Boxen erinnert fühlte — ein Vergleich, der den Bauherrn nicht wenig erboste, uns aber zeigt, daß auch die Zeitgenossen diese Disposition als ungewöhnlich empfanden. Ihr Ursprung dürfte in jenen aus Wandrücksprüngen gewonnenen Laufgängen unterhalb der Hochschiffsfenster zu suchen sein, die in Italien zuerst in der Grabkirche des hl. Franz von Assisi auftreten und in mittelitalien. Nachfolgebauten (Gualdo Tadino, Todi) gelegentlich mit darunterliegenden Seitenkapellen kombiniert wurden. Freilich handelt es sich dort um »zweischalig« angelegte Gewölbebauten, bei denen die Umgangsempore zwischen den das Schiff begrenzenden Pfeilern und den nach außen gerückten Hochfensterwänden lag. Bei unserem Bau dagegen fehlt jedes Anzeichen dafür, daß er je gewölbt oder für eine Einwölbung vorgesehen gewesen wäre (die Strebepfeiler scheinen allein zur Versteifung des hohen, relativ dünnwandigen und fensterreichen Obergadens gegen seitlichen Winddruck unerläßlich); man muß vielmehr annehmen, daß das offene Sparrendach, dessen Stahlbeton-Nachbildung das heutige Langhaus bedeckt, hier wie in allen zeitgenössischen Kirchen Neapels zum urspr. Plan gehörte. Folgerichtig verzichtete man auf ein inneres Stützensystem und reduzierte den Raummantel auf jene glatte, 1schalige »Scheunen«-Wand, die für die holzgedeckten Predigtsäle der italien. Minoriten kennzeichnend ist. Wenn man gleichwohl am Gedanken des Umgangs über eingezogenem Untergeschoß festhielt, so mag das praktische (technische oder liturgische) Gründe gehabt haben, die sich heute nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren lassen; allein das ästhetische Resultat war so sonderbar, daß es weder in Neapel noch anderwärts Nachahmung gefunden hat.
Die zweite Merkwürdigkeit der Kirche ist das Fehlen einer Apsis bzw. einer mit dem Schiff kommunizierenden Chorkapelle. Das Langhaus mündet an seinem südl. Ende in die
Andeutung eines Querschiffes aus: Das letzte Joch ist tiefer, der entsprechende Seitenkapellenbogen flacher und weiter gespannt als die übrigen; im Obergeschoß weitet der Schiffsraum sich seitlich aus, indem die betreffenden Hochwandfelder innerhalb gewaltiger Schildbogenrahmen um Strebepfeilerstärke nach außen rücken. Die den Dachstuhl tragenden Wandoberkanten dagegen laufen absatzlos über die Schildbögen hinweg, um unmittelbar mit der großen, nur von Fensteröffnungen durchbrochenen Quermauer zusammenzustoßen, die den südl. Abschluß des Raumes bildet.
Die untere Zone dieser Abschlußwand wird von einer Gruppe von Grabmonumenten eingenommen, deren pyramidale Dreierkomposition, den Blick des Eintretenden sogleich auf sich ziehend, das Triumphbogenschema der Vorhalle repetiert. Auch die Disposition der lichtspendenden Okuli des Obergeschosses nimmt auf das Dreiecksmotiv Bezug. Im Zentrum der Wandfläche steht ein kolossales 4bahniges Maßwerkfenster. Sein Durchblick geht jedoch nicht ins Freie, sondern in einen jenseits der Trennmauer liegenden Hallenchor, den Coro delle Clarisse, der nur durch ein Türchen in der linken Querschiffkapelle zugänglich ist (falls verschlossen, Zugang durch den Vorraum der Sakristei, von der rechten Querschiffkapelle aus). Hier versammelten sich die Insassinnen des Nonnenklosters zum Gottesdienst. Eine unmittelbare Teilnahme an dem von Franziskanermönchen zelebrierten Meßopfer war ihnen durch rigorose Klausurvorschriften versagt: Die Kommunikation ihres Chorraums mit dem im Querschiff der Hauptkirche aufgestellten Altar beschränkte sich auf die vergitterten Öffnungen in der Zwischenwand, unter dem Grabmal Roberts d. Weisen. Die Grundgestalt dieses Nonnenchors ist querrechteckig; die Breite entspricht etwa der des Langhausbaus, die Tiefe dagegen ist auf 2 Joche begrenzt. Eine Pfeilerstellung läßt 3 annähernd gleich hohe Schiffe entstehen, die äußeren kreuzrippengewölbt, das mittlere holzgedeckt. Dienste und Rippenansätze am südl. Wandpfeilerpaar zeigen an, daß hier urspr. auch im Mittelschiff eine Wölbung geplant war; erst im Laufe der Bauausführung scheint man den Gedanken zugunsten der klassischen neapolitan. Kombination von Gewölbe und Sparrendach über Pfeilern mit glatter vorlageloser Innenseite — vgl. S. Domenico, Dom S. Gennaro u. a. — verworfen zu haben.
Die Existenz des vom Kirchenschiff aus nicht sichtbaren Nonnenchors macht den scheinbar unvollkommenen Chorschluß des Langhauses verständlich; die Gesamtanlage von S. Chiara erklärt sich jetzt als die einer Doppelkirche, die den gottesdienstlichen Bedürfnissen zweier streng voneinander getrennter Konvente zu genügen hatte. Augenscheinlich haben die Planer sich in einem für abendländische Sakralbaugewohnheiten ungewöhnlichen Maße von liturgisch-praktischen Erwägungen leiten lassen; andererseits scheint gerade das neue »Raumgefühl« der Trecento-Kunst, das auf Herstellung in sich geschlossener, bildmäßig geordneter Einheiten abzielte, eine solche zweckrationale Einstellung begünstigt zu haben. Freilich bleibt unser Urteil auch hierin abhängig von der Kenntnis baugeschichtlicher Fakten, über die die Forschung noch keine Klarheit hat schaffen können. Wo wurde der Bau begonnen, und welcher Raum war 1316 schon so weit gediehen, daß in ihm Messe gelesen werden konnte? Wenn es sich um den Klarissenchor gehandelt hat — war dieser von vornherein als von der übrigen Kirche abgetrennter Annex gemeint, oder bildet er, wie schon vermutet worden ist, den Überrest eines mehrschiffig geplanten Langhausbaus, dessen Ausführung durch das Dazwischentreten der Franziskaner (1317) unterbunden wurde? Und hängt etwa die 1318 erfolgte Abfindung des ersten Architekten mit einem solchen Planwechsel zusammen? Erst die Beantwortung dieser Fragen wird uns instand setzen, den künstlerischen Gehalt dieser großen Schöpfung der neapolitan. Gotik richtig zu würdigen.
Ausstattung. Die feierliche Einweihung unseres Baues war noch nicht vollzogen, als das Querschiff sich bereits mit den Gräbern der königlichen Familie zu füllen begann. Der beherrschende Mittelplatz hinter dem Hochaltar war wohl von vornherein dem König zugedacht, der 1343, nach 34jähriger Regierungszeit, das Zeitliche segnete. Schon 15 Jahre vor ihm aber war sein Sohn Karl, Herzog von Kalabrien, auf der Falkenjagd in Kampanien einem Fieberanfall erlegen. Für König Robert bedeutete der Tod des gerade 31jährigen Prinzen den Zusammenbruch aller Zukunftspläne. »Die Krone fällt von meinem Haupt«, soll er ausgerufen haben, »wehe Euch — wehe mir!« Karl erhielt eine Grabstätte an der Chorwand rechts neben dem König. Daneben, an der rechten Schmalwand des Querhauses, ruht seine 2. Gemahlin Marie von Valois (die erste war Katharina von Habsburg, vgl. S. 178), die 1331 ihrem Gatten in den Tod gefolgt war. In die kurzen Jahre
ihrer Ehe, während der sie 5 Kinder zur Welt brachte (bei der Geburt des letzten zählte sie selbst erst 19 Jahre), fällt eine der glanzvollsten Episoden der höfischen Kultur Italiens: Karls florentinische Regentschaft 1326/27. Der von Ludwig d. Bayern bedrohte Stadtstaat hatte Robert d. Weisen, die mächtigste Stütze der Welfenpartei, um Beistand ersucht; der König schickte seinen Sohn, der mit einem über 1000köpfigen Gefolge nach Norden zog und, ohne sich in irgendwelche kriegerischen Unternehmungen verwickeln zu lassen, den staunenden Republikanern das Schauspiel einer fast anderthalb Jahre währenden Folge neapolitan. Hoffeste bot. — Die letzte Tochter des prinzlichen Paares, Maria von Anjou, heiratete zuerst Herzog Karl von Durazzo, der 1348 zu Aversa erdrosselt wurde, danach Philipp III., Fürsten von Tarent; sie starb 1366 und ist in dem Grabmonument links neben dem Königsgrab beigesetzt. Ihr gegenüber, in der linken Seitenkapelle des Querschiffs, befand sich bis zur Anbringung der modernen Orgel das Grab ihres kleinen Sohnes Lodovico von Durazzo (+ 1344) und das der Maria, Tochter der Marie von Valois (1328/29).
Tino da Camaino, Grabmal des Karl von Kalabrien. Gesamtansicht, 1329/1333, Neapel, Santa Chiara
Im Typus gehen alle diese Denkmäler letztlich auf Tino di Camaino zurück, auch wenn der 1337 verstorbene Künstler nur an zwei von ihnen noch selber gearbeitet hat. Am Beginn steht das um 1332/33 entstandene Grab des Karl von Kalabrien (Chorwand rechts). Seine Gesamtform stimmt weitgehend mit derjenigen des Donnaregina-Grabes (s. S. 195) überein. Die Horizontalteilungen des inneren und äußeren Aufbaus sind nun durchgehend aufeinander bezogen, im Sinne jenes allgemeinen Konsonanzeffektes, den man wohl als Quintessenz von Tinos Spätstil ansehen darf. Das Dach der Totenkammer ist abgeplattet, um den heute verschwundenen Freifiguren des Obergeschosses eine ebene Standfläche zu verschaffen (es handelte sich um eine Sitzmadonna mit den beiden angiovinischen Hausheiligen König Ludwig von Frankreich und Bischof Ludwig von Toulouse, die den knienden Herzog der Muttergottes empfahlen). Dem Giebel des Baldachins, der schon im 17. Jh. seinen Fialen- und Krabbenschmuck eingebüßt hat, merkt man die moderne Wiederherstellung an; die unteren Stockwerke dagegen sind relativ wohlerhalten, wenngleich vom Rauch der Feuerbrände verfärbt. Die den Sarkophag tragenden Löwensäulen bezeichnen hier wie schon am Grabmal der Katharina von Habsburg in S. Lorenzo einen Rückgriff auf roman. Formtraditionen, doch sind die Löwen ihrer Beutetiere beraubt und in Haltung und Aufmachung (wie etwa den elegant gescheitelten Mähnen) von der höfischen Gotik Tinos sozusagen domestiziert worden. Die Blattkapitelle mit ihren Männerköpfen erinnern stark an jene des Katharinen-Monuments. Jede Säule ist mit 2 Rücken gegen Rücken stehenden Tugendallegorien geschmückt. Es sind nahezu vollplastisch gearbeitete Figuren; allein die Flügel gehen, der Rundung der Säulen sich anschmiegend, ins Flachrelief über. Höchst geistreich ist die Anordnung der Figurenpaare im Verhältnis zum Achsensystem des
ganzen Grabmals: Die Tugenden stehen frontal über den Längsseiten der darunter liegenden Löwen; da aber vordere und hintere Säulen jeweils um 900 gegeneinander verdreht sind, zeigen Tier- und Menschenleiber sich überall in reizvollem Widerspiel von Profil und Vorderansicht. Die beiden Paare der rechten Seite verkörpern die Kardinaltugenden: vorn die mit Schwert und Waage ausgerüstete »Gerechtigkeit« und die »Stärke« als Siegerin über den Löwen; hinten die »Mäßigkeit« mit einem Vogel und die bücherbewehrte, physiognomisch höchst eindrucksvolle »Klugheit«; links sind die durch Kronen ausgezeichneten christl. Tugenden repräsentiert: die »Hoffnung« mit einem Blumenstrauß und der janusköpfige, d. h. am Alten (Gesetzestafeln) wie am Neuen Testament (Kelch) orientierte »Glaube«; dahinter die »Liebe« mit einer auf-und einer abwärtsgerichteten Kerze; ein 8. Flügelwesen ohne spezifizierendes Attribut dient lediglich als Füllsel. — Mit besonderem Nachdruck ist die Schauseite des Sarkophages behandelt.
Im Zentrum thront Karl in der Attitüde eines Richters, mit Schwert und Zepter ausgerüstet; zu seinen Füßen Wolf und Lamm aus einer Schale trinkend, Symbol des durch Recht gestifteten Friedens. Rechts und links von ihm knien und stehen 11 geistliche und weltliche Ratgeber. So archaisch formelhaft die Reliefkomposition im ganzen anmuten mag, der fast unmerkliche Wechsel der Haltung, der Gesten und Gewandmotive, der von einer Figur zur anderen stattfindet, und die feine, mit äußerster Ökonomie gegebene Charakteristik der einzelnen Köpfe verleihen ihr ein erstaunliches Maß an Lebendigkeit. Die Ablösung der Relieffiguren vom als »Raum« interpretierten Hintergrund suchte Tino hier durch die Verwendung verschiedenfarbiger Marmorsorten zu erreichen. — Neue Wirkungen sind auch in der Gestaltung der Totenkammer angestrebt: Die im Hintergrund dargestellten Welt- und Ordensgeistlichen, die den verstorbenen Fürsten beweinen (sie entsprechen den »pleureurs« der französ. Grabmalkunst), erscheinen als die natürlichen Bewohner des Interieurs, in das die vorhanghaltenden Engel einen momentanen Einblick gewähren. Der tote Herzog trägt über der Franziskanertracht einen reichen, mit Perlen bestickten Mantel; das etwas feiste, joviale und kluge Gesicht, eines der fesselndsten Bildnisse Tinos, ist im Halbschatten des Vorhangs leider nur undeutlich wahrzunehmen.
Das benachbarte Grabmal der Marie von Valois (Querschiff rechts) war beim Tode Tinos noch in Arbeit, zeigt aber in allen erkennbaren Einzelheiten seinen Stil (mit den Einschränkungen, die bei jeder Werkstattarbeit selbstverständlich sind). Die architektonischen Formen sind noch graziler geworden, die Baldachinpfeiler etwas schlanker, das ornamentale Detail reicher und feiner als beim Herzogsgrab. Zwischen Sarkophagdeckel und Totenbett ist ein Friesstreifen eingeschoben, der eine heute verschwundene (wohl nur aufgemalte) Inschrift trug; ein glücklicher Einfall sind die Eckverkröpfungen, die den Vorhanghaltern einen festen Standort
bieten. Die Totenkammer mit den »pleureurs« ist auf diese Weise noch mehr zusammengeschrumpft, die Figur der Toten kaum noch sichtbar. Auf dem Dach haben wieder die beiden angiovinischen Familienheiligen Platz gefunden, welche die Verstorbene der Madonna präsentieren. Die Vorderseite des Sarkophags hat 2 schmale Eckfelder, in denen die Verkündigung Mariae dargestellt ist; in den Mittelfeldern erscheint vor dunkelblauem Mosaikgrund Marie von Valois, flankiert von nicht sicher bestimmbaren Mitgliedern der Familie. Der Unterbau wurde im 17. Jh. verändert; übriggeblieben sind 2 vor schlanken Achtecksäulen stehende Tugendfiguren (Liebe und Hoffnung), die zu den schönsten Schöpfungen des späten Tino zählen.
Von der urspr. Pracht des Grabmals Roberts d. Weisen geben die rauchgeschwärzten Überreste, die sich heute im Zentrum des Chores erheben, nur noch einen undeutlichen Begriff. Die naheliegende Vermutung, Tino di Camaino habe für dieses Hauptmonument des angiovinischen Pantheons einen gezeichneten Entwurf hinterlassen, bleibt unbeweisbar. Überliefert sind nur die Namen der Florentiner Bildhauer »Johannes et Pacius de florentia marmorarii fratres«, mit denen Roberts Tochter Johanna bereits am 20. Januar 1343, d. h. 4 Tage nach dem Ableben ihres Vaters, einen Vertrag über die Errichtung des Grabmals schloß, und die überraschend kurze Ausführungszeit von nicht mehr als 2 Jahren. Das über 14 m hohe Baldachingehäuse wurde von 4 fünfgeschossigen Pfeilern getragen, deren Nischen einem Heer von Statuetten (Propheten, Sibyllen, Aposteln, Heiligen) Platz boten. Die mit reichstem Maßwerkschmuck versehene Giebelzone enthielt weitere Heiligenfiguren und, im Tympanon der Vorderseite, einen von Engeln getragenen Thronenden Christus in der Mandorla. — Die erhaltenen Teile des Innenbaus zeigen Skulpturen von wechselnder Qualität, die freilich niemals mit den Schöpfungen Tinos wetteifern können.
Um so interessanter ist die Anlage für den Ikonographen. Das Untergeschoß bleibt mit je 3 Tugenden an den beiden Sarkophagstützen (es fehlt die »Hoffnung«) im Rahmen des Herkömmlichen.
An der Vorderseite des schwer beschädigten Sarkophages erkennt man den thronenden König Robert, flankiert von seinen nächsten Angehörigen (von links nach rechts, einschließlich der Schmalseiten: Maria von Durazzo — ihre jung verstorbene, aber gleichfalls erwachsen dargestellte Schwester Maria — Roberts 2. Sohn Ludwig (1301-10) — Königin Johanna I. — Sancha von Mallorca und ihr Gemahl, König Robert — Violante von Aragon, Roberts 1. Frau — Herzog Karl von Kalabrien — Marie von Valois — ihre Söhne Ludwig und Martin).
Von den schönen Vorhangengeln der Totenkammer ist nur einer einigermaßen erhalten. Auf dem Ruhebett des Innern liegt die mächtige Gestalt des toten Königs, barfüßig und im Ordensgewand (18 Tage vor seinem Ende legte Robert bei den Franziskanern des Klosters Profeß ab), jedoch mit Krone, Zepter und Reichsapfel geschmückt. Die »pleureurs« aber
sind nicht mehr Geistliche, sondern Allegorien der 7 freien Künste, die den Heimgang ihres großen Protektors beklagen. Der Urheber dieses ganz neuartigen Motivs der Grabkunst ist kein Geringerer als Petrarca: »Durch seinen Tod beraubt, weinten die sieben Künste«, heißt es in dem Grabspruch, den der Dichter dem »heiligen Gebein« seines Wohltäters Robert widmete — ein echt humanistisches Gedankenbild, das erst in der zu vollem Selbstbewußtsein erwachten Renaissance des 15. Jh. neuen künstlerischen Ausdruck finden sollte (zuerst wieder in dem 150 Jahre nach Roberts d. Weisen Tod vollendeten Grabmal des Rovere-Papstes Sixtus IV. von Pollaiolo). — Über dem Dach der Totenkammer erhebt bzw. erhob sich ein zweites, bedeutend größeres Gehäuse, dessen Vorderseite aus 2 mit Vierpaßornamenten geschmückten, von marmornen Vorhängen halb verdeckten Pfeilern bestand. Die Rückwand zeigt eine große, mit Lilien auf blauem Grund ausgemalte Rundnische, in der die starr aufgerichtete Sitzfigur des Königs thront: eine Art von »Majestas«-Darstellung eines weltlichen Herrschers, deren unmittelbares Vorbild in Tinos Pisaner Grabmonument für Kaiser Heinrich VII., den großen Gegenspieler Roberts, zu suchen ist; dahinter steht aber wohl die antiken Mustern nachgeformte Ehrenstatue Arnolfo di Cambios für Karl I. v. Anjou als »Senator Romanus«, im römischen Konservatorenpalast. Am Sockel, der volle Sichtbarkeit der Statue auch für den Blick von unten gewährleistet, die den trocken-feierlichen Idealstil des Denkmals genau treffende Inschrift: Seht den tugendhaften König Robert.
Die Seitenfelder, welche die Nischenwand wieder im Sinne eines Triumphbogenschemas vervollständigen, sind der Majestas-Typologie entsprechend mit freskierten Darstellungen huldigender Untertanen geschmückt. — Das Dach dieses Geschosses trug noch eine Gruppe von Figuren: Sitzmadonna, 2 Engel, die hll. Klara und Franz von Assisi, die den knienden König (der dort zum vierten und letzten Mal erscheint) präsentierte; an der Rückwand befanden sich 2 schwebende Engel in Fresko.
Das Grabmal der Maria von Durazzo, an der Chorwand links vom Königsgrab, stammt von einem unbekannten Nachahmer Tinos (nach 1366). Stilistisch ergibt sich kein neues Element außer einer allgemeinen Vergröberung und Provinzialisierung der Formensprache; inhaltlich scheint das Zurücktreten des Biographischen zugunsten traditionell christl. Themen bedeutsam: Die Porträtdarstellung beschränkt sich auf die leider stark beschädigte Liegefigur; am Sarkophag erscheint die Muttergottes zwischen Heiligen, flankiert von 2 kleinformatigen Tugendfiguren; auf dem. Dach der Totenkammer ist nicht mehr die Aufnahme der Verstorbenen in den Himmel, sondern eine 3figurige Kreuzigungsszene dargestellt.
Die schlichten Grabstätten der linken Querschiffkapellen stammen von Tino di Camaino (die kleine Maria, Tochter der Marie von Valois) und Pacio da Firenze (Lodovico von Durazzo).
Der moderne Hauptaltar, vor dem Grabmal König Roberts, enthält an seiner Vorderseite einen Teil der alten got. Altarmensa: eine Serie marmorner Spitzbogenarkaden auf Säulchen von allen erdenklichen Formen, bedeckt mit Tier- und Pflanzenornamenten; darin einige Heiligenstatuen; das Ganze offenbar eine Arbeit aus der 2. Hälfte des 14. Jh. Hinter dem Altar ein hohes Holzkruzifix vom 3-Nagel-Typ in neuer Fassung, vermutl. umbrisch, Anfang 14. Jh.
Von der übrigen Ausstattung, die einstmals zu den reichsten und interessantesten von Neapel zählte, sind nur mehr spärliche Überbleibsel zu sehen. Endgültig verloren scheinen die berühmten Katharina-Reliefs der Meister Pacio und Giovanni von der Brüstung der Eingangsempore, die aus dem gleichen Umkreis stammende Kanzel, das schöne Grabmal der Antonia Grandino von Giovanni da Nola u. a.
Das Eingangsportal des Langhauses wird von 2 Grabmälern aus der Werkstatt des Antonio Baboccio flankiert, eines aus Piperno bei Frosinone stammenden Bildhauers, der um die Wende des 14. Jh. in Neapel tätig war: rechts Agnese und Clemenza von Durazzo (nach 1381); links Antonio Penna (um 1410 — der Sarkophag jetzt in der 2. Seitenkapelle rechts), an der Wand eine freskierte Darstellung der Trinität und darüber eine Madonna, die von Antonio und Onofrio Penna angebetet wird, wohl gleichzeitig entstanden: Dokumente eines groben und expressiven Naturalismus, der Berührung mit der französ.-niederländischen Malerei des 14. Jh. verrät. Interessant ist das Baldachingehäuse des Penna-Grabes: Es wird von 2 Löwensäulen getragen, deren Schäfte mit üppig rankendem Weinlaub ornamentiert sind. Es handelt sich um freie Nachbildungen zweier heute verschwundener, vermutl. Spätantiker »columnae vitineae« (Weinrankensäulen), die zu den kostbarsten Ausstattungsstücken der Klarissenkirche zählten. Sie trugen staufische Adlerkapitelle und stammten aus der Kirche des kaiserlichen Jagdschlosses Castel del Monte in Apulien, von wo Robert d. Weise sie 1317 zu Schiff nach Neapel transportieren ließ, um sie seiner »carissima consorte« für ihren Kirchenbau zu schenken.
Die Kapellen zur Linken enthalten eine Reihe von Grabmälern, die in zeitlich absteigender Linie den von Tino aufgestellten Formenkanon variieren: 2. Drago und Nicola da Merloto, + 1339 und 1350. 3. Raimondo Cabanis, königlicher Seneschall, und sein Sohn Perotto, + 1333 und 1336. 7. Raimondo del Balzo und seine Frau Isabella Apia, + 1375; die Statue des hl. Franz am Altar gilt als Werk des Giov. Dom. d’Auria. 9. Exzellenter griech. Sarkophag des 4. Jh. v. Chr. mit Darstellungen aus dem Mythos von Protesilaos und Laodameia, aus dem zerstörten Grabmal für G. B. Sanfelice (1632). 10. Links das Grab der Brüder Paride und Marco Longobardi (1529), gegenüber eine feine klassizist. Variante von 1853.
Seitenkapellen rechts: Fragmente weiterer Trecento-Gräber in musealer Aufstellung. An den Wänden einiger noch in Restaurierung begriffener Kapellen werden Trecento-Fresken freigelegt. In der letzten Kapelle die Grabmäler Philips von Bourbon (+ 1777), des 1. Sohnes Karls III., von Gius. Sammartino, und der sel. Maria Cristina von Savoyen (+ 1836), der 1. Gemahlin Ferdinands II. — Von der rechten Querschiffkapelle aus gelangt man durch eine Tür in den Vorraum der Sakristei. Ein anschließendes weiteres Vestibül wird von dem großen Eingangsportal des Klarissenchors beherrscht: Je 2 Paar trecentesker Spiralsäulen mit Weinrankenornament, von liegenden Löwen getragen, bilden die Pfosten; das dorische Sturzgebälk entstammt der barocken Restaurierung. Das Innere des Klarissenchors, dessen barocke Ausstattung (Fresken von Stanzione u. a.) gänzlich verlorenging, wird derzeit zur Aufnahme einzelner aus dem Brand geretteter Skulpturen-und Freskenfragmente hergerichtet.
Vom Vestibül aus führt eine breite Treppe hinab in den Kreuzgang der Klarissen, den berühmten Chiostro delle Maioliche (Tafel S. 97); ist die Glastür verschlossen, muß man die Kirche wieder verlassen, an der linken Außenwand entlanggehen und die Ruine des anschließenden barocken Konventsgebäudes durchqueren.
Höchst überraschend öffnet sich vor dem Beschauer nach Passieren der Eingangspforte ein immergrüner Zier- und Nutzgarten von beträchtlicher Ausdehnung (ca. 82 x 78 m). Der äußere Rahmen — 4 Portiken von je 16 bzw. 17 Spitzbogenarkaden über achteckig abgefasten Pfeilern — stammt aus der ersten Bauzeit des Klosters und präsentiert sich nach einer Restaurierung von 1938-42, die spätere Um- und Anbauten beseitigte, heute wieder in seiner originalen Gestalt.
Die urspr. Baulichkeiten waren im 17. Jh. einer eingreifenden Veränderung unterzogen worden. V. a. unterteilte man die Dormitorien des Obergeschosses in geräumige Einzelzellen, die nur noch 117 Insassinnen (statt den über 200 Nonnen der Gründungszeit) Platz boten. Doch auch mit dem äußeren Bild ihres »all’antica gotica« gebauten Klostergartens waren die zumeist dem städtischen Patriziat entstammenden Damen damals nicht mehr zufrieden. Nach wie vor handelte es sich um das vornehmste Frauenkloster der Stadt, in dem auch die weiblichen Mitglieder des Königshauses, dem der Konvent ja seine Gründung verdankte, gern ein und aus gingen. So war es denn wieder eine Königin, die 1738 in Neapel eingezogene Maria Amalia von
Sachsen, durch deren Eingreifen der Kreuzgang des alten Klarissenklosters sich in eines der bezauberndsten Monumente neapolitanischer Lebenskunst der Rokokozeit verwandelte. Ihre Wünsche konzentrierten sich auf die Neugestaltung des Gartens, und zwar »nach ausländischem Brauch« in Form von Parterres, zwischen denen gepflasterte Wege »bequeme und anmutige Spaziergänge« ermöglichen sollten.
Nachdem die wiederholt ausgesprochenen Ermunterungen der Monarchin nicht von entsprechenden Geldzuwendungen begleitet worden waren, sahen die Nonnen sich genötigt, die Erneuerung auf eigene Kosten ins Werk zu setzen. Die künstlerische Oberleitung der Arbeiten, die sich von 1739 bis 1743 hinzogen, lag in den Händen des gleichen D. A. Vaccaro, der dann auch für die Umgestaltung des Kircheninnern verantwortlich zeichnete; hier wie dort entstand nach seinem Entwurf ein echt spätbarockes Gesamtkunstwerk, an dem Gärtner, Majolikamaler und Brunnenmeister aufs glücklichste Hand in Hand arbeiteten.
Das architektonische Hauptmotiv bildet ein Wegekreuz, das, von der Eingangstreppe neben dem Klarissenchor ausgehend, das Gartenareal in 4 Rechteckfelder von ungleicher Größe teilt. Die aufgeschütteten Gartenparterres werden von halbhohen Wangenmauern eingefaßt; in ihren Außenseiten, entlang den Hauptwegen, laden anmutig geformte steinerne Sitzbänke — »poggi ad uso di canape’« — den Spaziergänger zum Verweilen ein. Den erwünschten Schatten spendet eine von stämmigen Achteckpfeilern getragene, mit Wein überwachsene Pergola, deren Form freilich nicht mehr die ursprüngliche ist: Anstelle der einfachen Balkenlagen muß man sich ein zierliches Gittergewölbe aus genageltem Lattenwerk denken, das über dem oktogonalen Mittelplatz eine hochaufragende Kuppel bildete.
Gut erhalten hat sich glücklicherweise die kostbare Majolikadekoration, welcher der Kreuzgang von S. Chiara seinen Beinamen verdankt. Bauschmuck aus farbig glasierter Majolika war in Neapel zumindest seit dem 17. Jh. heimisch — bes. an Kuppeln und Turmhauben (S. Maria della Sanità, SS. Marcellino e Festo, S. Pietro Martire, SS. Apostoli, S. Maria di Portosalvo, S. Maria del Carmine) — und erscheint als charakteristisches Requisit einer klimabegünstigten, dem südlichen Himmel geöffneten Außenarchitektur. Gern möchte man hier eine ältere, viell. aus islamischen Quellen gespeiste Lokaltradition vermuten; jedoch die Nachrichten über arabische Handwerker, die unter den Anjou in der Gegend des
Ponte della Maddalena Keramikwerkstätten betrieben, sind spärlich und unklar, und der große Bedarf an glasierten Steinen, der im Verlauf der Bauunternehmungen Alfons’ II. von Aragon entstand (La Duchesca, Poggio Reale), wurde durch Importe aus der Toskana gedeckt. Eine eigene Produktion von einiger Bedeutung scheint sich erst zu Beginn des 18. Jh. entwickelt zu haben. Der entscheidende Anstoß kam aus dem Abruzzenstädtchen Castelli bei Teramo, wo sich seit dem 16. Jh. eine bedeutende keramische Industrie befand. Dort war es 1716 zu einem Handwerkeraufstand gekommen, der von einem der bekanntesten Künstler der Gilde, dem gelehrten Francesco Antonio del Grue, angeführt wurde. Nach Niederschlagung der Rebellion wurde Grue mit 53 Leidensgefährten nach Neapel geführt und 10 Jahre lang im Castel Nuovo eingekerkert, wobei ihm aber Gelegenheit gegeben wurde, die Neapolitaner in der Kunst der Keramikherstellung zu unterweisen. Auch Donato und Giuseppe Massa, die in den Urkunden als Meister der Majoliken von S. Chiara genannt werden, sollen sich damals unter seinen Schülern befunden haben. — In jedem Falle zeigt die Verwendung der Majolikatechnik in unserem Kreuzgang unverkennbar süditalien. Züge, die etwa in der römisch-toskanischen Gartenkunst der Epoche keine Entsprechung haben. Hierher gehört die Auflösung alles Tektonischen, das Verschwinden der natürlichen Oberfläche des Steines unter der farbig glänzenden Kachelhaut, v. a. aber das illusionistische Quiproquo von gewachsener und malerisch nachgeahmter Vegetation: Fast unmerklich geht im Spiel des einfallenden Sonnenlichtes das Weinlaub der Pergolen in die Fruchtgirlanden der Pfeiler über, deren zartblauer Grund mit dem Blau des Himmels zu verschmelzen scheint. In der Zone der Wangenmauern verwandelt sich das Rankenwerk in ein barock geschwungenes Rahmenornament, das den Ausblick in eine reine Phantasiewelt freigibt, eine fast unabsehbare Folge jener landschaftlichen »Capriccios«, die zu den anziehendsten Gattungen der italien. Malerei des 18. Jh. gehören. Technisch z. T. von außerordentlicher Feinheit (man studiere v. a. die Bilder unter dem westl. Portikus), bieten sie eine malerisch-freie Apotheose der Golflandschaft: Man blickt über Ebenen und Gebirge, Vulkane, Inseln und besonnte Meeresküsten, weite, von Galeeren und Segelschiffen belebte Marinen und Felsenbuchten, Brücken, Kastelle und ferne Städtchen. Die Bewohner dieses traumhaften Arkadiens beschäftigen sich mit Jagd und Fischfang, Tanz und Spiel; aber auch Maskeraden, Pulcinella-Szenen und karnevalistische Triumphzüge treten auf (die Nonnen selbst begingen damals den Karneval mit Maskenfesten und Aufführungen eigens für sie komponierter Opern). Besonders hübsch eine Darstellung der 4 Elemente über den Bänken des südl. und des westl. Mittelweges: Erde, Feuer und Luft kommen in von Pferden, Löwen und Pfauen gezogenen Festwagen einhergefahren, der Beherrscher des Meeres thront auf einem mit Schaufelrädern versehenen Muschelgefährt, umgeben von
Delphinen, Tritonen und Korallenzweige schwenkenden Seejungfrauen. Ein anderes Bild des W-Weges zeigt, in etwas vereinfachter Darstellung, den Kreuzgang vor der Errichtung der Pergolen; im Zentrum eine Klarissin, die den aus allen Teilen des Gartens herbeispringenden Klosterkatzen ihr Mittagsmahl austeilt.
Von der alten Bepflanzung des Gartens ist nur wenig übriggeblieben; die Parterres sind jetzt teilweise mit Gemüsebeeten bestellt, teils dienen sie als Lagerplatz von Baumaterialien. Ihr monumentaler Schmuck besteht aus 3 versiegten und halb verfallenen Brunnenanlagen. Im nordwestl. Quadranten findet man die Reste der »Fontana rustica«, eines monumentalen Schaubrunnens mit künstlichem Felswerk, delphingeschmückter Schale und durchbrochener Ädikula-Rückwand; eine Pfeilerpergola mit 4 kleinen Wandbrünnlein führte darauf zu. Die beiden östl. Parterres haben frei stehende Brunnen mit großen antiken Marmorschalen; eines der unteren Becken hat Vaccaro mit liegenden Löwen und (heute verschwundenen) Tugendfiguren dekoriert, die von demolierten Trecento-Gräbern zu stammen scheinen; das andere ist mit Majolikafliesen ausgelegt, auf denen Fische, Krebse und anderes Seegetier sich zwischen den blauen Wellen des Golfes tummeln. — In einem Nebenraum rechts vom Eingang eine berühmte vielfigurige Weihnachtskrippe des 18. Jh.
Domenico Antonio Vaccaro, Kreuzgang der Klarissen, 1739, San Chiara in Neapel.
Domenico Antonio Vaccaro, Kreuzgang der Klarissen - Sitzbank, 1739, San Chiara in Neapel.
Domenico Antonio Vaccaro, Kreuzgang der Klarissen - Nordöstliche Galerie, 1739, San Chiara in Neapel.
Domenico Antonio Vaccaro, Kreuzgang der Klarissen - Ansicht von Oben/Südosten, 1739, San Chiara in Neapel.
An der NW-Ecke des Klosterbezirks liegt der ehem. Franziskanerkonvent, der heute den Klarissen als Refugium dient. Der Zugang befindet sich an der Piazza Trinità Maggiore 20, gegenüber dem Gesù Nuovo; doch werden Besucher nur ausnahmsweise und für wenige Augenblicke eingelassen.
An der Stirnwand des heute zur Kapelle umgebauten ehem. Kapitelsaals befindet sich eines der größten Trecento-Fresken Neapels. Die Mitte wird eingenommen von dem auf einem Cosmatenthron sitzenden Christus. Seine rechte Hand ist segnend erhoben, die linke hält ein aufgeschlagenes Buch mit den Worten »Ego sum Alpha et Omega Principium finis dicit Dominus Deus Christus«. Links von ihm stehen auf perspektivisch gezeichnetem Fliesenboden Maria, der hl. Ludwig von Toulouse mit Buch und Krummstab — die Gesichtszüge zeigen einige Ähnlichkeit mit dem Bildnis Simone Martinis im Museum von Capodimonte — und die hl. Klara; rechts der Evangelist Johannes und die hll. Franziskus und Antonius. Im Vordergrund knien die kleinen Figuren der Stifter: links, mit Krone und Reichsapfel, König Robert d. Weise, dahinter Karl von Kalabrien; rechts Sancha und Marie von Valois oder (worauf die Krone hindeuten würde) Johanna I. — Im angrenzenden Chorraum, dem ehem. Refektorium der Franziskaner, befindet sich ein kleineres Fresko mit der Speisung der Fünftausend: Christus, wieder mit Buch und Segensgestus, sitzt erhöht zwischen 2 Palmenbäumen im Kreise der 12 Jünger; St. Peter, rechts vorn, verteilt aus großen Körben Brot und Fisch unter das Volk, das von den knienden Gestalten der hll. Franziskus und Klara eingefaßt wird. Beide Fresken, unter den gegenwärtigen Umständen kaum zu würdigen, scheinen mehrfach übermalt und durch chemische Veränderungen der Farben entstellt zu sein; so sind die wechselnden Zuschreibungen an Künstler aus dem Umkreis Giottos, Cavallinis, Duccios und Simone Martinis, die sich alle auf bestimmte Anhaltspunkte stützen können, derzeit nur schwer verifizierbar.
Nicht zu besichtigen ist der an die W-Flanke der Kirche sich anlehnende Kreuzgang der Franziskaner, dessen strenge und klare Architektur viell. am ehesten geeignet wäre, ein Bild von der Wirkung des Gründungsbaus von S. Chiara zu vermitteln. Er wird aus 1011 Spitzbogenarkaden gebildet, zwischen deren Kämpfern flache Schwibbögen eingezogen sind — ein Motiv, das im Palazzo Pubblico in Siena seinen nächsten Verwandten hat; die Stützen bestehen teils aus antiken Säulenschäften, teils aus einfachen schlanken Achteckpfeilern.
Concezione a Monte Calvario (an der Via della Concezione a Monte Calvario, die von der Via Roma aus, in Höhe der Via A. Diaz, westl. gegen den Vomero aufsteigt)
Nicht zu verwechseln mit der künstlerisch nicht weiter interessanten Chiesa di Monte Calvario oder S. Maria della Mercede an der parallellaufenden Via di Monte Calvario.
1718-25 von D. A. Vaccaro entworfen, erbaut und ausgestattet, bezeichnet die kleine, der Kunstgeschichte kaum bekannte Kirche eine der Sternstunden des neapolitan. »barochetto«.
Die Fassade hat eine Ordnung mit volutengekröntem Rundbogenabschluß und pompöser Stuckdekoration; Portal und Fenster sind in phantastischen Kurven zusammengezogen: ein großer Eingangsakkord für das perspektivenreiche Raumbild, das sich vor den Augen des Eintretenden entfaltet.
Die Ausgangsfigur des Grundrisses — abzuleiten etwa von Fanzagos S. Teresa a Chiaia — ist das klassische »griechische Kreuz« mit 4 gleich langen Armen und einem durch Eckabschrägungen erweiterten Mittelraum. Diese Eckschrägen aber stehen hier nicht genau diagonal, sondern sind leicht in Richtung der Längsachse eingedreht. So nimmt der Hauptraum die Form eines länglich verzogenen unregelmäßigen Achtecks an; die Kuppel entwickelt sich nicht mehr aus dem von einem Kreis überspannten Quadrat, sondern aus einem Rechteck mit ausgerundeten Kehlen. Das Verblüffende dieser Lösung liegt darin, daß alle optisch vergleichbaren Größen des Mittelraums — Kreuzarmöffnungen, Pfeiler etc. — einander ringsum entsprechen und somit das Bild eines reinen Zentralbaus hervorrufen; der Längszug des Ganzen wird dem Beschauer zwar spürbar, allein seine Ursache — die Winkelverzerrung — entzieht sich jeder Kontrolle durch unser an derlei Kunstgriffe durchaus nicht gewöhntes Auge. Eine weitere, nicht sogleich verifizierbare Abweichung vom Zentralschema liegt in der verschiedenen Behandlung der Längs- und Querarme: Jene sind etwas tiefer und sprin-
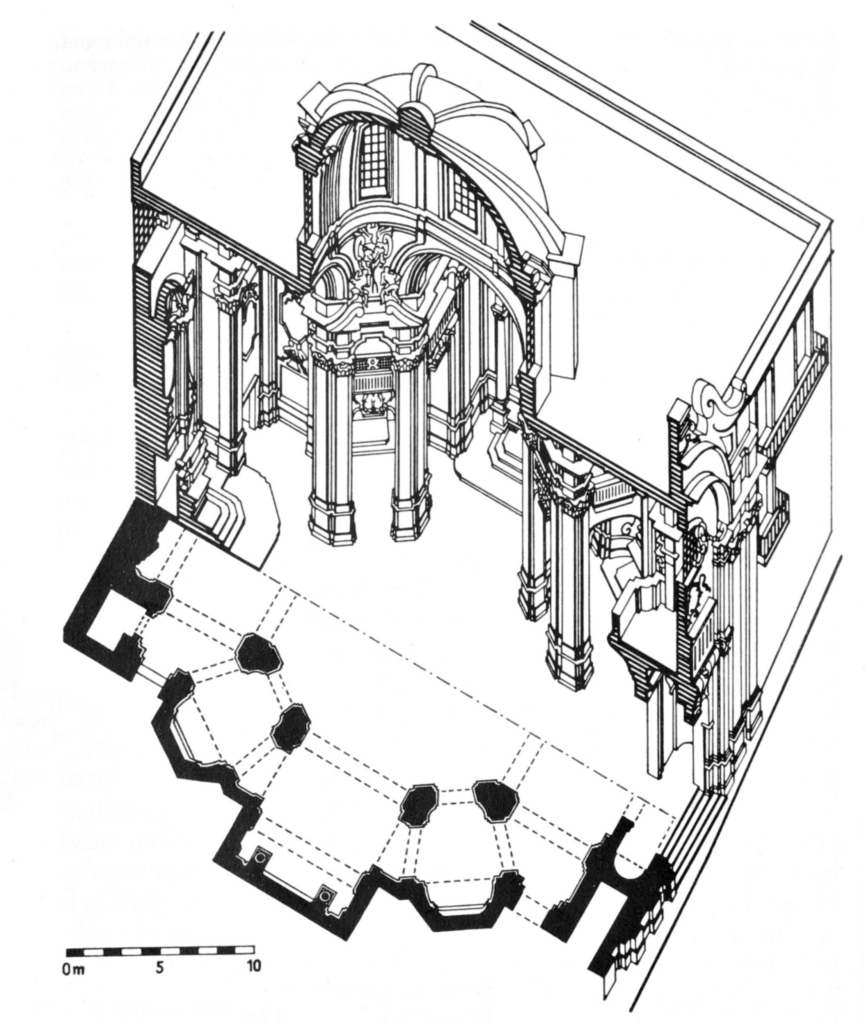 Concezione a Montecalvario. Schnitt
Concezione a Montecalvario. Schnitt
gen gegen Eingangs- und Chorseite hin trapezförmig auf. In die Kreuzarmwinkel sind niedrige Nebenräume mit darüberliegenden Emporen eingesetzt, jeweils nach3 Seiten geöffnet, so daß sich im Grundrißbild die tragen Pfeiler in ein kompliziertes System unregelmäßig gebildeter Freistützen auflösen. Die räumliche Vielfalt des Ganzen wird zusammengehalten durch ein straff durchgeführtes Dekorationssystem: ringsumlaufende komposite Pilasterordnung, die Arkadenöffnungen einheitlich mit »hängen-
den« Bogenprofilen und vergitterten Coretti versehen, ein Motiv, das schon in der Fassade angeschlagen, kaleidoskopartig aus allen Winkeln des Raumes reflektiert wird.
Das ornamentale Detail — Stuck, Coretti-Gitter, Orgelbrüstung — ist von gleichmäßig hohem Rang; von der Stuckierung wußte ein Zeitgenosse zu melden, sie sei mit so viel »bel capriccio« ersonnen und ausgeführt, daß niemand auf den Gedanken komme, sich den Raum etwa freskiert vorstellen zu wollen. So beschränkt sich die figürliche Ausstattung auf die Altäre. Am Hauptaltar stammt nur der zart polychrome Marmoraufbau von Vaccaro; die Figur der Madonna Immacolata wurde aus einem Vorgängerbau übernommen. Dafür brilliert der Maler Vaccaro als Autor der übrigen Altarbilder: in den Querarmen Geburt Christi und Mater dolorosa, raffinierte Meisterwerke dekorativer Malerei in hellen, kühlen Pastelltönen; die kleinen, verschiedenen Heiligen gewidmeten Altäre der dunklen Nebenräume sind, mit genauem Kalkül der Lichtwirkung, in kräftigeren Tönen gehalten. Betrüblich bleibt, daß ein moderner Innenanstrich in Weiß und Graugelb die Effekte im ganzen doch wohl vergröbert und die urspr. Farbstimmung des Raumes bis zu einem gewissen Grade zerstört hat.
SS. Cosma e Damiano (an der S-Seite der Piazza dei Banchi Nuovi, am südl. Ende der Via S. Chiara)
Seit 1570 stand an dieser Stelle die Börse (Loggia dei banchi), die sich jedoch bald als zu klein erwies; 1616 erwarb die Zunft der Bader und Barbiere den Bau und richtete darin eine ihren Schutzpatronen geweihte Kirche ein. Gegen Ende des 19. Jh. wurde das Gebäude gründlich restauriert.
Die urspr. Loggienform hat der Anlage der Kirche ihren Stempel aufgeprägt: Zum Platz hin zeigt sie eine breite, niedrige Front, die durch einfache Lisenen in 3 Felder aufgeteilt wird. Das Innere (Schlüssel in der Wohnung rechts vom Hauptportal) ist eine 3schiffige Halle mit Kreuzgewölben auf Vierkantpfeilern und Quertonnen in den schmalen Abseiten; die letzte Travée erweitert sich zum Querschiff. — Am Hochaltar hübsche Marmorintarsien; darüber eine Beschneidung Christi, bei der die beiden Titelheiligen assistieren, aus dem Umkreis Peruginos, stark restauriert.
Chiesa della Croce di Lucca (am westl. Ende der Via dei Tribunali, schräg gegenüber von S. Pietro a Maiella; das Innere nur in den frühen Morgenstunden zugänglich)
Der Bau gehörte zu einem 1534 gegründeten Karmeliterinnenkloster, dessen übrige Gebäude heute in der angrenzenden Universitäts-Poliklinik aufgegangen sind. Die nach einer ehemals hier befindlichen Kopie des »Volto Santo« von Lucca genannte Kirche wurde um die Mitte des 17. Jh. erbaut, 1739 von Ferdinando Sanfelice mit einer neuen Innendekoration versehen und Ende des 19. Jh. restauriert.
Das Innere, ein Saalraum mit je 3 Seitenkapellen und hohem Oberlichtgaden, verdankt seine Wirkung hauptsächlich den prächtigen Stucchi Sanfelices (Kapitelle der Pilasterordnung, Engelsköpfe, Kartuschen); die Marmorintarsien gehen noch auf Entwürfe F. A. Picchiattis (1684-89) zurück. Die schöne Kassettendecke, in originaler Fassung, enthält ein gänzlich verdorbenes Leinwandbild (Madonna von Karmel mit Heiligen) aus der Nachfolge des G. B. Caracciolo. — In der 2. Kapelle links eine hl. Theresa aus dem Umkreis des A. Vaccaro. In der 3. Kapelle rechts eine Verkündigung von Nicola Malinconico.
S. Croce al Mercato (auch S. Croce al Purgatorio, Madonna del Mercato oder S. Maria delle Grazie; Piazza del Mercato)
Die Kirche bildet das monumentale Zentrum der Piazza del Mercato, einer nur noch teilweise erhaltenen frühklassizist. Platzanlage, die dem 1781 durch eine Feuersbrunst verheerten Hauptmarkt des Hafenviertels ein neues repräsentatives Gesicht verleihen sollte.
Entwerfender Architekt der Anlage war der Messinese Francesco Sicuro (1747-1827). Er ersetzte die niedergebrannten hölzernen Marktbuden durch eine symmetrisch geordnete Folge 1geschossiger Ladengebäude, die an der N-Seite des Platzes, nach dem Vorbild von Vanvitellis »Foro Carolino« (s. S. 360), eine flache Exedra bildeten. In deren Scheitel liegt die Kirche; die offenbleibende S-Seite wird von 2 obeliskengeschmückten Brunnenanlagen eingefaßt. Die ringsumlaufenden älteren Baufluchten, ’von der Kirche S. Eligio im W bis zum Kloster von S. Maria del Carmine im 0, bezeichnen in etwa das Areal des mittelalterl. Platzes, dessen Geschichte sich bis ins 13. Jh. zurückverfolgen läßt. Seit Beginn der angiovinischen Herrschaft diente er (damals noch außerhalb der Stadtmauern) nicht nur als Markt, sondern zugleich als Öffentliche Hinrichtungsstätte; die Kette der hier im Namen der Staatsgewalt verübten blutigen Greuel reicht von der am 29. Oktober 1268 vollzogenen Enthauptung Konradins und seiner Gefolgsleute bis zu den Massenhinrichtungen der Revolutionäre von 1799. Das populäre Mercato-Viertel, Urheimat der »Lazzaroni«, war auch der Hauptschauplatz des großen Volksaufstandes von 1647/48, dessen Protagonist Tommaso Aniello (»Masaniello«) am 16. Juli 1647, dem Festtag der Madonna von Karmel, im Carmine-Kloster von den Schergen des Vizekönigs ermordet wurde; das Wohnhaus des tragisch gescheiterten Volkstribunen lag im NO des Platzes (Vico Rotto 117). Die Rolle der Bastille spielte damals das Castello del Carmine an der Piazza del Carmine südöstl. des Marktbezirkes: 1382 von Karl [II. von Anjou-Durazzo gegr.‚ mehrfach zerst. und umgebaut, diente es bis zu Beginn des 19. Jh. der Regierung als politisches Gefängnis. 1906 fiel das Gebäude der allerdings nie zu Ende geführten Sanierung des Hafenviertels zum Opfer; den einzigen Überrest bildet die Torre Spinella (so genannt nach dem
Architekten Francesco Spinelli, dem Erbauer der aragonesischen Stadtmauer) innerhalb des heutigen »Magazzino Militare«. I. ü. ist die Nähe des Hafens während des 2. Weltkrieges dem Viertel endgültig zum Verhängnis geworden. Fortdauernde Bombardements haben große Teile seiner Gebäude in Schutt und Asche gelegt; so ist die ehemals für ihr buntes Volksleben berühmte Piazza heute, von sinistren Neubauten umstellt, zu einer der häßlichsten Stellen Neapels geworden.
In der Kirche von S. Croce sind die Titel zweier Memorialkapellen vereinigt, die durch den Brand bzw. die anschließende Neugestaltung des Platzes verlorengegangen sind. Die erste, S. Grace, datierte von 1351 und bezeichnete die Stelle der Enthauptung Konradins (in der Gegend des östl. Obeliskenbrunnens); die zweite, S. Maria delle Anime del Purgatorio, nahm etwa den Ort des westl. Brunnens ein und diente dem Gedächtnis der hier in Massengräbern beigesetzten Opfer der Pestkatastrophe von 1656.
Der Neubau Sicuros besitzt eine blockhaft geschlossene, in 2 Ordnungen aufgeteilte Fassade mit leicht vortretendem Mittelrisalit, überragt von einer Majolikakuppel. Das Innere ist ein angenehm proportionierter, ganz symmetrisch gebildeter Kreuzkuppelraum mit massiven, innen leicht abgeschrägten Kuppelpfeilern und verlängertem Chorarm; die Dekoration klassizistisch korrekt und trocken. Links vom Eingang ein Erinnerungsmal an die Hinrichtung des letzten Hohenstaufen: eine Porphyrsäule mit einem marmornen Kreuz und 2 Flachreliefs (Kreuzigung Christi und Pelikan) aus der oben erwähnten Cappella di 8. Croce. Die Seitenaltäre haben 2 schöne Bilder von Giacinto Diana: Madonna mit dem hl. Januarius und Himmelfahrt Mariae.
Le Crocelle (S. Maria della Concezione oder auch S. Maria a Cappella; Via Chiatamone; geöffnet von 7 bis 9 Uhr früh), wurde 1616-27 von den Padri Crociferi erbaut. Hübsche, leicht ausschwingende Fassade des 18. Jh. in der Art des F. Sanfelice. Im linken Querschiff das Grab des Malers Paolo de Matteis (+ 1728); von diesem das Hochaltarbild (Immacolata Concezione) und die Bilder der Querschiffaltäre (Tod des hl. Joseph und hl. Camillus). In der 1. Kapelle rechts schönes Holzkruzifix (17. Jh.). In der Sakristei ein weiterer St. Camillus von Vincenzo Diane (1794).
Der Name Chiatamone wird vom griech. »platamon« abgeleitet und bezieht sich wahrscheinl. auf eine Reihe teils natürlicher, teils künstlicher Grotten und Höhlen in den Tuffelsen des Pizzofalcone, in denen man neuerdings Spuren prähistorischer Besiedlung entdeckt hat. Sie wurden im 16. Jh. auf Befehl des Vizekönigs Pedro von Toledo vermauert, nachdem sie als Versammlungsort gewisser lebenslustiger Gesellschaften in Verruf gekommen waren. Gleichwohl blieb der Chiatamone bis zur Anlage der Via Partenope (nach 1870) die beliebteste Uferpromemade der Stadt; man traf sich zu abendlichen »pranzi allegri« und trank
die heilkräftigen Mineralwässer des Felsens. Um die Mitte des 18. Jh. entstanden hier die ersten großen Hotels, darunter der von vornehmen Reisenden aller Nationen frequentierte Albergo delle Crocelle (Nr. 26/27), in dem 1770 Casanova sich einmietete und allerlei lukrative Bekanntschaften schloß. Gegenüber lag die Casina di Chiatamone, ein vom Fürsten von Francavilla (s. S. 295) erbautes Lusthäuschen mit schattigem Garten über dem Meer. Es kam nach dem Tode des Fürsten (1782) in den Besitz der Bourbonen, wurde von Ferdinand IV. umgebaut und diente seitdem vorwiegend als Gästehaus des Königs. 1822 wohnte hier Friedrich Wilhelm III. von Preußen; nach seiner Rückkehr ließ er im Park des Schlosses zu Berlin-Charlottenburg durch Schinkel den »Neuen Pavillon« errichten, in dem die Grundform des anmutigen Neapler Gebäudes fortlebt. Das Original wurde 1860 aufgestockt, später in ein Hotel verwandelt und endlich 1912 durch ein ordinäres Mietshaus ersetzt (Nr. 57bis).
S. Diego dell’Ospedaletto (Via Medina) führt seinen Zunamen nach einem 1514 von Giovanna Castriota Scanderbeg gegründeten und dem hl. Joachim geweihten Hospital, das nach dem Tode der Stifterin in einen Franziskanerkonvent verwandelt wurde. 1595 wurde die Joachimskapelle abgerissen und durch eine S. Diego geweihte 3schiffige Pfeilerbasilika ersetzt. Das Erdbeben von 1784 und die Bombenangriffe des 2. Weltkrieges haben den Bau schwer getroffen. — Das Innere ist nunmehr frisch restauriert. Zu seiten des Eingangs findet man Grabmäler der Fürsten Ludovisi von Piombino, nach Entwürfen Solimenas von Giac. Colombo gefertigt (1701). Am Altar der 1. Seitenkapelle links ein hervorragend schöner Massimo Stanzione (Tod des hl. Joseph). Die übrigen Bilder sind noch nicht wieder am Ort; die Guiden heben einen S. Pasquale von Francesco de Mura und eine Ekstase des hl. Franz von Michele Regolia hervor. Die linke Chorkapelle enthält kümmerliche Überbleibsel bedeutender Fresken (Szenen aus dem Marienleben) von Regolia und Battistello Caracciolo.
S. Domenico Maggiore (zwischen der gleichnamigen Piazza und der Via S. Pietro a Maiella) Die Kirche bildete urspr. eines der Hauptmonumente der neapolitan. Gotik; doch haben zahlreiche Umbauten und Restaurierungen den Charakter des Baues fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Seit dem 8. Jh. soll sich in der Gegend der heutigen Kirche ein Basilianerkloster befunden haben, mit der nach einer hier ansässigen Familie benannten Kapelle S. Angelo a Morfisa. Das Kloster ging dann in den Besitz der Benediktiner und später der Dominikaner über. Diese erbauten eine ihrem Ordensgründer geweihte Kirche, die 1255 fertig wurde. Unmittelbar daneben legte Karl I. 1289 den Grundstein des heutigen Baues, einer Magdalenenkirche, die zu errichten er während seiner Gefangenschaft nach der Sizilianischen Vesper gelobt hatte. Die alte Dominikanerkirche wurde in den Neubau einbezogen, dessen Magdalenentitel dann alsbald durch das Patrozinium des Ordensheiligen verdrängt. 1324 war der Bau im wesentlichen abgeschlossen. Die Erdbeben des folgenden Jahrhunderts (1455/56) richteten schwere Verwüstungen an;
1506 brannte der angebl. von Novello da Sanlucano wiederhergestellte Bau fast vollständig aus. Eingreifende barocke Restaurierungen (1632 und 1676) wechselten mit weiteren Erdbebenschäden (v. a. 1688); 1732 entwarf D. A. Vaccaro eine neue Innendekoration. Einer Plünderung in der Franzosenzeit fielen große Teile der Innenausstattung zum Opfer; in den 50er Jahren des 19. Jh. endlich erhielt der Bau durch den Architekten Federico Travaglini sein heutiges Aussehen.
Die Piazza S. Domenico, eine der charakteristischen Szenerien des alten Neapel (zu den umliegenden Bauten vgl. S. 290, 298, 318 f.), gewährt einen Blick auf die Chorfassade. Die Freitreppe zur Linken, im 19. Jh. an Stelle einer Treppenanlage aus der Zeit Alfons’ I. von Aragon errichtet, bildet den Zugang zur alten Dominikanerkirche; schönes Frührenaissance-Portal mit gotisierendem Ziergiebel von 1483. Rechts daneben die hochragende, fenster-und schmucklose Apsis des Hauptbaus; im Untergeschoß ein barockes Vestibül, von dem aus 2 geschwungene Treppenläufe ins Innere der Kirche hinaufführen.
In der Mitte des Platzes steht die Guglia di S. Domenico, deren Errichtung von der Bürgerschaft während der Pest von 1656 gelobt und 2 Jahre später in Angriff genommen wurde. Ein erster Auftrag scheint an Fanzago gegangen zu sein, doch stammt der ausgeführte Entwurf in Form eines dicken Obelisken auf hohem Piedestal von F. A. Picchiatti; erst 1737 vollendete D. A. Vaccaro die Dekoration. Beim Ausschachten der Fundamente stieß man auf Teile der antiken Stadtmauer und des westl. Stadttors (Porta Cumana oder Puteolana).
Den Haupteingang erreicht man durch den Vico S. Domenico an der O-Flanke der Kirche, die noch Teile des alten got. Außenbaus zeigt. Ein großer Torbogen führt in einen wüsten Hof; zur Linken erhebt sich die Eingangsfassade, deren aus den disparatesten Elementen zusammengesetzte Form die wechselvolle Geschichte des Bauwerks abspiegelt: Rechts und links erblickt man die mit Pilastern und Blendbögen gegliederten Außenwände zweier Kapellen aus der Zeit nach dem Brande von 1506; die dazwischenliegende hübsche Vorhalle (z. Z. in Restaurierung) mit weit geöffnetem Mittelbogen und kräftigem Volutenschmuck gehört dem 18. Jh. an und geht wohl auf D. A. Vaccaro zurück; darüber die alte Giebelwand mit ehemals barock geschweiftem, jetzt wieder begradigtem Umriß und im 19. Jh. erneuertem got. Maßwerkfenster. — Im Innern der Vorhalle das Portal des
Trecento-Baues: flaches Gewände mit got. Stabwerk, Archivoltenreliefs (Christus und die Apostel), darüber ein hochaufragender Wimperg; die Holztüren stiftete Bartolomeo da Capua, Protonotar unter Karl II. und Robert von Anjou.
Seitlich 2 schöne Tugendallegorien (»Stärke« und »Glaube«), wohl von einem der zerstörten Trecento-Gräber aus dem Innern der Kirche, und alte Inschriften, die sich auf die Gründung des Baues beziehen.
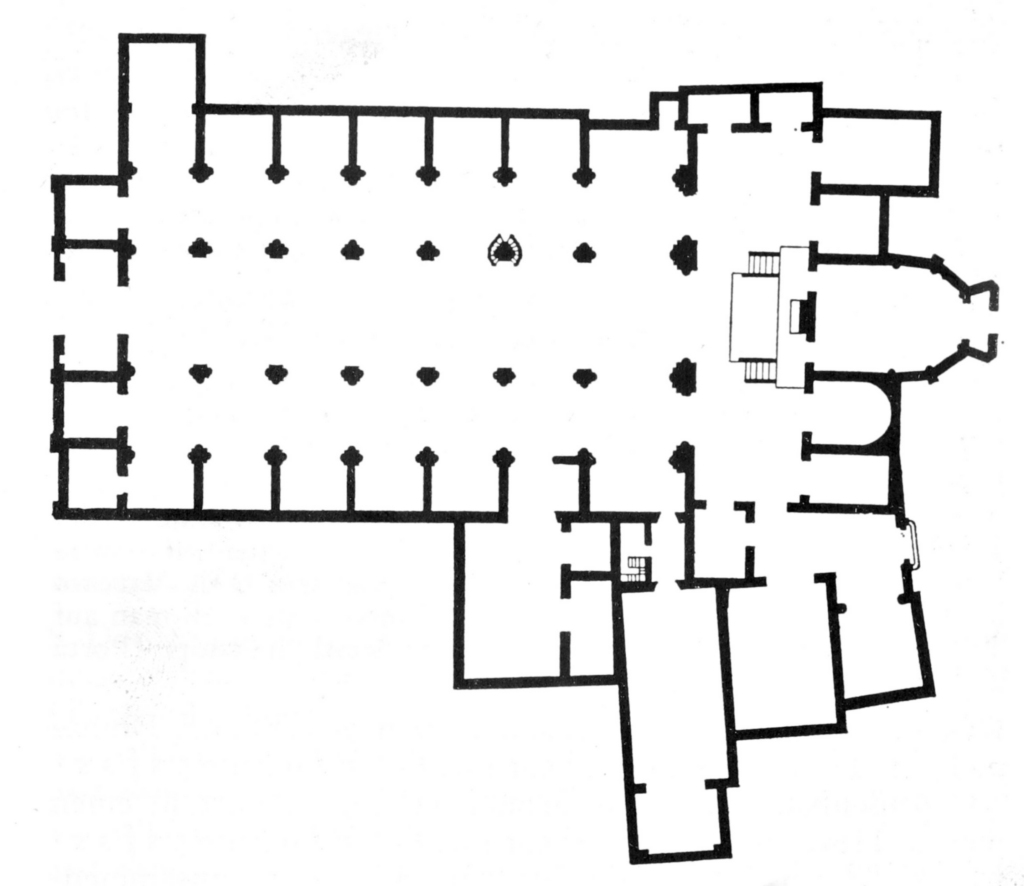 S. Domenico Maggiore. Grundriß
S. Domenico Maggiore. Grundriß
Den Eindruck des Inneren bestimmt der ölvergoldete Prunk des 19. Jh. Das architektonische Gerüst stammt im wesentlichen von 1289: Eine 3schiffige Basilika mit 7 hohen Spitzbogenarkaden über Pfeilern von jener aus der roman. Tradition Süditaliens abzuleitenden Form (rechteckiger Kern mit 3 Rundvorlagen, aber flacher Stirnseite zum Mittelschiff — vgl. S. 115), die für die angiovinische Gotik kennzeichnend ist. Die im 19. Jh. neugefaßte Holzdecke stammt von 1665; der Trecento-Bau dürfte an ihrer Stelle ein offenes Sparrendach getragen haben. Die kreuzrippengewölbten Seiten-
schiffe werden von Kapellen begleitet; an das mit ihnen fluchtende Querschiff (modern gewölbt) fügen sich ein mit 5 Seiten des Achtecks geschlossener Langchor und je 2 Nebenkapellen an. Von der Restaurierung Vaccaros ist glücklicherweise der schöne, einfache Ziegel- und Marmorfußboden erhalten geblieben. 5 Jahrhunderte, in denen die Dominikanerkirche im Mittelpunkt des religiösen Lebens der Stadt stand, haben eine fast unübersehbare Fülle unterschiedlichster Kunstwerke in ihr zurückgelassen. Die wichtigsten Stücke der Ausstattung sollen in Form eines Rundgangs besprochen werden.
In der Eingangswand öffnet sich zur Linken des Eintretenden die Cappella Muscettola mit Altarbild von Giordano (hl. Joseph) und einer interessanten Anbetung der Könige von einem unbekannten deutschen Maler des 16. Jh.; die schöne Rahmenarchitektur des Kapelleneingangs, von 1541, gehörte urspr. zur linken Nebenchorkapelle.
Kapellen am linken Seitenschiff: 1. Reiche Marmordekoration von Andrea Malasoma (1639-47). — 2. Am Altar das Martyrium Johannes’ d. Ev., ziemlich beschädigt, von Scipione Pulzone aus Gaeta (vor 1550-98); links das Grabmal des 1438 verstorbenen Kriegsmannes Antonio Carafa, wohl erst aus der 2. Jahrhunderthälfte (Jacopo della Pila?), mit schönem trecentesken Sarkophag: Typus und Ikonographie folgen noch got. Herkommen, Architektur-und Figurenstil dagegen scheinen bereits von Donatellos und Michelozzos Brancaccio-Grab (S. Angelo a Nilo) inspiriert. — 3. Johannes d. T. gewidmet: Die vorzügliche Nischenfigur des Altars, mit feinem, elegisch geneigtem Kopf und reichem Faltenspiel, stammt von G. d’Auria (ein interessantes Gegenstück in S. Anna dei Lombardi, S. 40); darüber eine kleine Madonnenfigur aus dem Umkreis des Tino di Camaino; an den Seiten 2 Bilder von. Mattia Preti: Johannes vor Herodes und seine Enthauptung. Links das Grab des Dichters Bernardino Rota (1508 bis 1575) von Giovanni Domenico d’Auria mit merkwürdiger Ikonographie: 2 Flußgötter (»Arno« und »Tiber«) reichen dem verstorbenen Poeten Lorbeerkränze; darunter trauern »Kunst« (im weitesten Sinne des Wortes: sie trägt nicht nur die Leier, sondern auch Zirkel, Winkelmaß, Himmelsglobus u. a.) und »Natur« (Diana von Ephesus in der der Renaissance geläufigen Deutung als Dea della Natura). Rechts das Grabmal des Bruders Alfonso Rota von Giovanni Antonio Tenerello (1568-70). — 5. Am Altar eine Bartholomäus-Marten Anfang 17. Jh.; links das Grabmal der Letizia Caracciolo, + 1340. — 6. Hauptaltar: Martyrium der hl. Katharina von Leonardo da Pistoia (um 1500); rechts Madonna mit den hll. Antonius Abbas und Johannes (1. T., darüber Verkündigung von Angelillo Arcuccio (Ende 15. Jh.); Grabmäler von Leonardo und Nicola Tomacelli (+ 1529 und 1473). — Die letzte,
7. Kapelle enthält den Maria-Schnee-Altar von Giovanni da Nola, 1536 entstanden und offensichtlich dazu gedacht, die vielbewunderten Eingangsaltäre von Montoliveto (s. S. 43 f.) in den Schatten zu stellen. Eine hochaufragende, große und schwere Ädikula übergreift nun das Triptychonschema; 2 flach reliefierte Engel mit Inschrifttafeln sind nötig, den bis zum Gebälk verbleibenden Zwischenraum zu beleben, während das Hauptgeschoß nach dem Wegfall der die Figuren sondernden Zwischensäulen fast übermäßig gefüllt erscheint. Auch die Einführung des von der röm. Hochrenaissance bevorzugten dorischen Stils zeigt das Streben nach neuer und zeitgemäßer Monumentalität; der alle Lücken ausfüllende kleinteilige Zierat allerdings, auf den der gelernte Holzschnitzer nicht hat verzichten mögen, macht dann doch einen Strich durch die strenge Rechnung. Die Figuren, höchst kunstvoll gestellt und drapiert, suchen auf jede Weise mit denen von Santacroces Del-Pezzo-Altar zu konkurrieren; die exzellente Oberflächenbehandlung tröstet einigermaßen über den Mangel an innerer Motivation hinweg. — Rechts Kenotaph des großen Barockdichters Giambattista Marino, * 1569 in Neapel, + 1625 in Rom, der mit seinem »Adonis« eine für ganz Europa folgenreiche literarische Stilwende einleitete (sein Grab befindet sich in der Unterkirche von SS. Apostoli).
Im Querschiff links zunächst ein schöner Marmoraltar von 1515 mit großen und monumentalen Flachreliefs (büßender Hieronymus, Verkündigung, Schmerzensmann), viell. von Tommaso Malvito. — In der anschließenden 1. Seitenkapelle befindet sich, umgeben von kostbaren Marmordekorationen, ein signiertes Werk Tizians, Marine Verkündigung. Die aus dem 18. Jh. stammende Nachricht, Luca Giordano habe das Original gegen eine selbstgefertigte Kopie ausgetauscht, hat bei der späteren Kritik keinen Glauben gefunden; gleichwohl haben nicht alle Autoren die Authentizität des Bildes anerkannt. In jedem Falle handelt es sich um ein Werk von hohem Rang, das mit dem Stil Tizians in den späten 50er Jahren (1557 ist lt. Inschrift die Kapelle errichtet worden) gut zusammengeht. Die Komposition, von elementarer Einfachheit, folgt einem schon früher von Tizian entwickelten Schema.
In der Pinselführung ist die Freiheit der spätesten Bilder noch nicht ganz erreicht; das überwältigend schöne Kolorit macht die motorischen Schwächen der Zeichnung vergessen. — An der Querschiffwand, zwischen 1. und 2. Kapelle, das Wandgrab des Rainaldo del Doce (+ 1579), eine leicht vergröberte Nachbildung des gegenüberliegenden Pandone-Grabes (s. u.). — In der 2. Kapelle Goldgrundtafel mit dem hl. Vincenzo Ferreri von einem neapolitan. Künstler des 15. Jh.
Chorkapellen: 1. Grabmäler des Carlo Spinelli von Giovanni Marco Vitale (1634) und des Kardinals Filippo Spinelli von Bernardino del Moro (1544-46). An der Altarwand unter Glas eine Madonna lactans, Überbleibsel eines Trecento-Freskos; das
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Chiesa dell’Ascensione a Chiaia. L. Giordano: Maria und S. Anna (Ausschnitt)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S. Chiara. Chiostro delle Maioliche
umgebende Leinwandbild, hll. Stephanus und Petrus Martyr, wird dem G. B. Beinaschi zugeschrieben; darüber eine schöne Mondsichel-Madonna von Paceco de Rosa. — Die 2. Kapelle (links neben der Hauptapsis) enthält das berühmteste Malwerk der Kirche, die 1607 entstandene Geißelung Christi von Caravaggio, 1924 wiederaufgefunden, restaur. und hier angebracht; gegenüber eine vorzügliche Kopie des 17. Jh., wahrscheinl. von A. Vaccaro, kenntlich an dem leicht rötlich gefärbten, dem Geschmack Riberas angenäherten Inkarnat. Wer Caravaggios Bild vorurteilslos studiert, wird in ihm nichts von jener Roheit finden, die die klassizist. Kunstliteratur dem großen Lombarden nachzusagen nicht müde wurde. Alle rein stofflichen Attribute des Martyriums, Blut und Wunden, sind vermieden: Die stumme Qual des Opfers, die verbissene Grausamkeit der Folterknechte drücken sich allein in der Konfiguration der Köpfe und Gebärden aus. Die Gesamtanordnung und bes. die Haltung Christi weisen zurück auf das von Michelangelo inspirierte Geißelungsbild Sebastiano del Piombos (Rom, S. Pietro in Montorio); zumal das hochexpressive Motiv der langen, geraden Schulter- und Nackenlinie, das bei Caravaggio auch anderweitig vorkommt, ist dort vorgebildet. Unvergleichlich die Qualität der Malerei, die Differenzierung des Lichtes bis in die von sparsamen Reflexen aufgehellten Schattentöne des Vordergrundes; hier zeigt sich, was die Zeitgenossen unter Caravaggios »Naturalismus« — »osservò il naturale in dipingere« — verstanden und bewunderten.
Die Hauptchorkapelle enthält Fresken des 19. Jh. und ein Chorgestühl von Giuseppe da Pareta (1752). Der phantastische Marmorschmuck des Presbyteriums (Hochaltar, Bischofsthron und Balustrade) stammt von Fanzago (1640-46); der Altar wurde nach dem Erdbeben von 1688 durch Ferdinando de Ferdinando und Lorenzo Vaccaro restauriert (1695). — An der linken Wange der Chorbrüstung steht ein monumentaler marmorner Osterleuchter von 1585, in dessen Untergeschoß 9 kostbare Trecento-Statuen als Karyatiden Verwendung gefunden haben. Es sind Tugendallegorien von Tino di Camaino, offenbar ganz eigenhändig ausgeführt und viell. die besten Zeugnisse vom Spätstil des großen Toskaners. Tino schuf 2 Grabmäler, die in der Dominikanerkirche Aufstellung fanden: eines für den Fürsten von Tarent, Philipp von Anjou, den 1331 verstorbenen jüngeren Bruder Roberts d. Weisen; das zweite für Johann, Herzog von Durazzo, einen anderen Bruder König Roberts, der 1335 starb. Beide Werke fielen den barocken Restauratoren der Kirche zum Opfer, und die wenigen erhaltenen Fragmente gestatten keine sicheren Rekonstruktionen. Die Tugendfiguren, jeweils zu dritt um eine Säule gruppiert, waren offenbar als Stützen eines freistehenden Sarkophages gedacht (vgl. etwa das Grabmal der Marie von Valois in S. Chiara). Die Vorderseiten der beiden Sarkophage wurden, leider weit über Augenhöhe, in die Stirnwände des Querschiffs eingemauert (links Philipp, rechts
Giovanni). Man erkennt eine Serie von Blendarkaden, darunter teils stehende, teils sitzende Hochrelieffiguren vor mosaiziertem Grund, die den Verstorbenen im Kreise seiner Familie zeigen: Philipp mit seiner Gemahlin Katharina und seinen 6 blonden Söhnen, den »principi giovanetti«, von deren Auftreten als Turnierritter Boccaccio in der »Fiametta« eine anmutige Schilderung gegeben hat; Giovanni hat seine 3 Söhne zur Rechten, während ihm von der anderen Seite eine Schar ihrem Herrscher huldigender Albanesen entgegendrängt. Gegenüber den gleichmäßig gereihten Nischenfiguren der Sarkophage von S. Chiara zeigt sich hier eine erstaunliche Freizügigkeit der Komposition, die auf Durchbrechung des architektonischen Schemas zugunsten realistisch-szenischer Gesamtwirkung abzielt: ein kühner Schritt, mit dem der wenige Jahre später (1337) verstorbene Meister die Grenzen seiner Kunst zu erweitern sucht.
Weiter an der Chorwand, 1. Nebenkapelle rechts: Deckenfresken von Giovanni Cosenza (1759/60) und 2 Bilder von Luca Giordano: Erscheinung Gottvaters vor S. Vincenzo Ferreri und Erscheinung Christi vor dem hl. Thomas.
In der rechten Stirnwand des Querschiffs öffnet sich ein Durchgang in die alte Dominikanerkirche von 1255, die heute, nach zahlreichen Veränderungen, eine Art Vestibül mit 2 großen Seitenkapellen bildet. Sie enthält weitere Grabmäler des 16. Jh., darunter (an der linken Wand) diejenigen des Alfonso Rota von Tenerello (1569) und der Porzia Capece von Caccavello und Giovanni Dom. d’Auria (1559). Die rechte (vordere) der Seitenkapellen hat am Altar zwischen cinquecentesken Heiligenfiguren eine hohe, schmale Tafel mit dem hl. Dominikus; das wohl erst gegen Ende des 13. Jh. entstandene, mehrfach übermalte und restaurierte Werk gilt als ältestes Bildnis des Ordensgründers. Rechts das Grabmal des Tommaso Brancaccio (+ 1492) von Jacopo della Pila; es zeigt bei aller modern florentinischen Aufmachung die enorme Zählebigkeit des alten Tugendkaryatiden-Schemas.
Zurück ins Querschiff : In der Mitte der rechten Stirnwand das schöne Wandgrab des Galeazzo Pandone (+ 1514) von unsicherer Zuschreibung (Santacroce, G. T. Malvito?). Die Darstellung des Verstorbenen. in Form einer antikisierenden Bildnisbüste atmet reinsten Humanistengeist; soziale Rangabzeichen fehlen ebenso wie die konventionellen Symbole christl. Auferstehungsglaubens — allein 2 kindliche Genien mit gesenkten Fackeln zeigen an, wie die Alten den Tod gebildet. Architektur und Arabeskenschmuck sind von höchster Vollkommenheit; im Tympanon ein Madonnenrelief, das man doch am ehesten dem Santacroce zutrauen möchte. — In der anschließenden Querschiffseitenkapelle ein Altarbild der Madonna vor dem hl. Hyazinth, umgeben von weiteren Heiligenfiguren, neapolitanisch, Anfang 16. Jh. — Am folgenden Abschnitt der Querschiffwand ein marmorner Hieronymus-Altar, inferiores
Gegenstück zu dem T. Malvito zugeschriebenen Altar der gegenüberliegenden Seite; darunter ältere Grabmäler der Familie Donnorso.
Rechtes Seitenschiff. 7. (vom Eingang her letzte) Kapelle: 2 Grabmäler aus dem späten Trecento: links die Grafen von Belcastro, Cristoforo und Tommaso d’Aquino; rechts Giovanna d’Aquino, unter dem Baldachin eine Thronende Madonna mit Kind, Überreste eines größeren Freskos, das vor der Anbringung des Grabes die ganze Wand bedeckt haben muß (Mitte 14. Jh.). Am Altar eine Madonna mit dem hl. Thomas von Aquin von Luca Giordano, eine Huldigung an den berühmtesten Sproß dieses alten, urspr. langobardischen Adelsgeschlechtes, der an der hiesigen Dominikaneruniversität studiert und von 1272 bis zu seinem Tode gelehrt hat.
Die von hier aus erreichbare Sakristei enthält mit dem Deckenfresko des Solimena (wahrscheinl. 1709 entstanden) ein Hauptwerk der dekorativen Malerei des neapolitan. Settecento. Dargestellt ist der durch die theologische Arbeit der Dominikaner bewirkte Triumph des rechten Glaubens über die Ketzerei: zuoberst zwischen den himmlischen Heerscharen Christus, Gottvater und die Taube des Hl. Geistes; etwas tiefer die von verschiedenen Heiligen verehrte Madonna; im Zentrum links der hl. Dominikus, zu seinen Füßen die Allegorie des Glaubens; darunter schließlich ein Erzengel, der die titanengleich gegen diesen katholischen Olymp anrennenden häretischen Unholde mit flammendem Donnerkeil zerschmettert. Den Schwierigkeiten des extrem langen und schmalen Formates der zur Verfügung stehenden Malfläche zeigt Solimena sich mühelos gewachsen. Figuren und Wolkenmassen sind als nahezu gleichberechtigte Elemente der Komposition über den Raum verteilt; hierin wie auch in der Verbindung stark leuchtender Lokalfarben (das Ultramarin wirkt wohl infolge chemischer Veränderung etwas zu grell) mit hellen, luftigen Zwischentönen sieht man den Meister konsequent auf dem 2 Menschenalter früher von Lanfranco (Langhausgewölbe von S. Martino) eingeschlagenen Wege fortwandeln. — Die Sakristei ist außerdem bemerkenswert als Aufbewahrungsort von 45 hölzernen Särgen, die die sterblichen Überreste aragonesischer Fürstlichkeiten und anderer berühmter Männer und Frauen des 15. und 16. Jh. enthalten (auf der Galerie, Zugang durch ein Türchen an der linken Seite). — Die Fresken der Altarkapelle stammen von Giac. del Pò (1705).
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Decke: Der katholische Glaube triumphiert über die Ketzerei durch das Werk des
dominikanischen Ordens, 1709, San Domenico Maggiore (Sakristei) in Neapel.
Weiter im rechten Seitenschiff: 6. Kapelle. Zur Linken des Eintretenden ein Altar mit einer stark übermalten Madonna lactans, darüber Verkündigung, von einem sienesisch beeinflußten Meister (wahrscheinl. Bartolomeo Pellerano aus Camogli) aus der Mitte des 14. Jh. — Geradeaus öffnet sich der geräumige Cappellone del Crocifisso, aus einem Saal des alten Klostergebäudes entstanden (an der linken Wand die alte Arkadenstellung), mit Deckenfresken (Marienkrönung, musizierende Engel und Heilige von Michelei
Regolia, um 1650). Die kleine Kreuzigungstafel des barocken Hauptaltars, die der Kapelle ihren Namen gegeben hat (kampanisch unter toskanischem Einfluß, 2. Hälfte 13. Jh.‚ 1929 durchgreifend restaur.), befand sich ehemals in der alten Dominikanerkirche am Platz des oben erwähnten Dominikus-Bildnisses; dort soll 1272 der Gekreuzigte den vor ihm betenden Thomas von Aquino angesprochen haben: »Gut hast Du über mich geschrieben, Thomas — welche Gnade begehrst Du dafür?« — »Nur Dich selbst (non aliam nisi te)«, war die Antwort des großen Kirchenlehrers. Das Paliotto-Relief stellt auf äußerst plumpe Weise den wunderbaren Vorgang dar. — Links davon eine ausgezeichnete Grablegung Christi in der Art des Rogier van der Weyden, viell. von dem zu seiner Zeit hochberühmten, für uns schwer faßbaren Neapolitaner Colantonio (Mitte 15. Jh.); die gleichfalls hochinteressante Kreuzigung rechts gilt als Werk eines oberitalien. Bramantino-Schülers um 1500. — An der linken Seitenwand des Raumes öffnen sich 2 Nebenkapellen: 1. Cappella di S. Rosa di Lima, feine Renaissance-Architektur, Madonnentafel mit Goldgrund. — 2. Cappella dei Carafa, Conti di Ruvo, oder del Presepe, vor 1511 erb. und ausgeschmückt (exquisite Marmorornamente an Pfosten, Bogenwänden und v. a. an der Eingangsbalustrade). Die Deckenfresken, etwas gewaltsam wirkende Bravourstücke oberitalien. Perspektivmalerei vom Anfang des 16. Jh. (Propheten-Halbfiguren, Fruchtgehänge und dekorative Architektur), scheinen von der gleichen Hand wie die Kreuztragung neben dem Hauptaltar; das Fresko in der Lünette links (Epiphanie) gilt als Werk des Corenzio. Gegenüber dem Eingang das schöne Grabmonument des 1511 verstorbenen Ettore Carafa, wahrscheinl. von Giovanni Tommaso Malvito; links das Grabmal des Troilo Carafa (+ 1591); rechts 2 Krippenfiguren (Maria und Joseph) von Pietro Belverte (1507), Überbleibsel einer ehemals 28 Stücke umfassenden Gruppe. — Die Reihe der Grabmäler setzt sich im Hauptraum fort: links und rechts der Altarwand Francesco und Diomede Carafa (+ 1470 und 1487), Gegenstücke von unklarer Zuschreibung. An der rechten Wand weiter: Placido Sangro (+ 1480), wohl von T. Malvito, darüber das prunkvolle Monument des 1750 verstorbenen Feldherrn Nicola Sangro; Mariano d’Alagni (+ 1477) und Caterina d’Orsini (T. Malvito?), Ferdinando Carafa (+ 1593). — An der Eingangswand rechts ein Altar mit einer Auferstehung Christi von dem Antwerpener Marten-de-Voss-Schüler Wenzel Koberger (1561-1634).
Weitere Kapellen am rechten Seitenschiff der Kirche: 5. Rechts oben ein interessantes Lünettenbild mit der sitzenden Madonna (Typus der »Madonna dell’umiltà«)‚ beischriftlich bez. als Mater Omnium, vom Ende des Trecento, stilistisch am ehesten von sienesischen Vorbildern abzuleiten (Lippo Memmi). — 4. Altarbild von Paceco de Rosa, Rosenkranz-Madonna mit den hll. Dominikus und Karl Borromäus; links Himmelfahrt von Teodoro d’Errico; rechts Taufe Christi von Marco Pino. — 3. Kreuzigung von dem
Manieristen Girolamo Capece, Mitte 16. Jh. — 2. (Cappella di Raimondo di Pennafort). Großer, stark restaurierter Freskenzyklus aus der 2. Hälfte des Trecento mit Einflüssen Giottos und Cavallinis (Kreuzigung, Geschichten Johannes’ d. Ev. und der Maria Magdalena). — 1. Am Altar Reste eines Freskos der Madonna mit dem Kinde, Anfang 15. Jh.; links davon eine Maria Magdalena, 15. Jh., rechts hl. Dominikus von Giov. Filippo Criscuolo; Teile von Grabmälern aus der Nachfolge des Tino di Camaino; links oben ein schöner Solimena, Madonna mit Dominikanerheiligen.
An der Eingangswand rechts die Cappella Carafa di Sanseverino, später Saluzzo, erb. und mit vorzüglichen Marmordekorationen ausgestattet von Romolo Balsimelli aus Settignano, dem Architekten von S. Caterina a Formiello (1508 ff.). Viell. von dem gleichen Künstler stammt das schöne und eigenartige Grabmal des 1513 verstorbenen Galeotto Carafa und seiner Gemahlin, Rosaria Pietramelara, an der rechten Kapellenwand. Das sehr sparsam verteilte Ornament läßt die Strenge des Aufbaus zu voller Wirkung gelangen: Sockelbank, Inschriftplatte, Sarkophag aus dunklem Marmor (eine vereinfachte Nachbildung des klassischen Pantheon-Sarkophags, vgl. S. 46); darüber ein tabernakelartig gerahmtes, physiognomisch höchst eindrucksvolles Bildnismedaillon; die Tugenden (links »Justitia« — die Waage ist zugleich ein Wappenemblem der Carafa —, rechts »Temperantia«) erscheinen hier anmutigerweise als trauernde Sitzfiguren. Gegenüber das Grabmal des 1852 gestorbenen piemontesischen Artilleriegenerals Filippo di Saluzzo, ein gespenstisch anmutendes Waffenarsenal auf ägyptisierendem Unterbau.
Tommaso Malvito, Grabmal des Ettore Carafa in der Cappella Carafa di Ruvo, San Domenico Maggiore, Neapel.
S. Domenico Soriano (an der W-Seite der Piazza Dante) wurde in der Mitte des 17. Jh. von. kalabresischen Dominikanern erbaut; der Entwurf wird dem Cos. Fanzago zugeschrieben. Die Wirkung der in die Häuserzeile eingefügten Fassade, mit großer Pilasterordnung auf hohem Sockel, beruht auf dem Wechsel zwischen den hellen Putzflächen und der dunklen Pietra-serena-Gliederung. — Das Innere, dreischiffig mit Kuppel, wurde 1878-86 stark restauriert. Bemerkenswert das Grabmal des Alessandro Falcone von Gius. Sammartino (1758) in der 1. Kapelle links; ebendort eine sehenswerte Maria von Francesco de Mura.
S. Efremo Vecchio (am Ende der gleichnamigen Straße am O-Hang von Capodimonte, oberhalb des Albergo dei Poveri). In den derzeit unzugänglichen Katakomben zur Linken der Kirche befand sich die Grabstätte des neapolitan. Bischofs Ephebus (nach späterer Lesart Euphebius, vulgo Efremo), der vor 432 gelebt hat. Im 16. Jh. wurde hier das älteste Kapuzinerkloster Neapels gegründet. Der heutige Bau, ein tonnengewölbter Saal mit tiefen Seitenkapellen, stammt vom Ende des 18. Jh.; sehr hübsch der Majolikafußboden, der sich auch auf den großen, annähernd quadratischen Vorplatz erstreckt; in dessen rechter Wangenmauer eine Nische mit einem volkstümlich bunten Majolikabild im Stil des damals gerade entdeckten Alexandermosaiks: S. Eufebio greift zugunsten der Neapolitaner in eine Schlacht gegen die Sarazenen ein (A. D. 1837).
S. Eligio (an der SW-Ecke der Piazza del Mercato)
Die Kirche gehört zu den ältesten got. Bauten der Stadt. Als Gründungsdatum, auch des angeschlossenen Hospitals, wird d. J. 1270 genannt; König Karl I. schenkte das Grundstück, 1360 machten Johanna I. und Ludwig von Tarent weitere Stiftungen. Nach mehrfacher Umgestaltung im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Kirche 1943 von Fliegerbomben getroffen und schwerstens beschädigt; seitdem wird an der Wiederherstellung des got. Urbaus gearbeitet.
Der gegenwärtige Zustand läßt ein 3schiffiges Langhaus mit auffallend breitem Mittelschiff erkennen, das urspr. in 5 kreuzrippengewölbte Travéen aufgeteilt war. Bei einem wohl durch Beschädigung (Erdbeben?) veranlaßten Umbau des späteren Mittelalters wurden der 2. und 4. Pfeiler herausgenommen und die Zahl der Mittelschiffjoche auf 3 reduziert (die Eingangstravée blieb unangetastet), so daß für den Hauptteil des Langhauses eine Art von »quadratischem Schematismus« entstand; die 3teiligen Gewölbevorlagen des alten Systems wurden über den Scheiteln der neuen, niedrigeren Arkadenbögen durch figurierte Konsolen abgefangen.
Nach O folgt ein geräumiges Querschiff mit Flachdecke, dessen Außenfluchten die der Seitenschiffe des Langhauses fortsetzen. 3 Chorkapellen, die äußeren rechteckig, die mittlere aus 5 Seiten des Achtecks gebildet, schließen sich an; die Komposition der Chorwand, mit kleinen Okuli über den seitlichen Kapellenöffnungen, läßt an den Querschiffabschluß von S. Lorenzo Maggiore denken. Im W scheint eine
2-Turm-Fassade geplant gewesen zu sein, von der jedoch nur der S-Turm zur Ausführung kam; darunter, an der südl. Längswand, sitzt das große Eingangsportal mit reich profilierter Archivolte und bekrönendem Wimperg.
Der große Arco dell’Orologio, der hier die Straße überspannt, wurde im Quattrocento errichtet, im 19. Jh. vollständig restauriert. — Unweit davon, an der Ecke Via S. Eligio / Via S. Giovanni a Mare, steht noch der Sockel der alten Capo di Napoli, des populären Wahrzeichens dieses Viertels (s. S. 40); der Kopf selber wurde 1960 an der Via Caracciolo aufgestellt, um das dort installierte Olympische Feuer zu bewachen, und wanderte dann ins Museo Filangieri (s. S. 298).
S. Ferdinando (Piazza Trieste e Trento, gegenüber dem Palazzo Reale)
Urspr. war die Kirche dem hl. Franz Xaver geweiht, dessen 1622 verkündete Heiligsprechung den Anlaß zum Bau der Kirche gab. 1767 ging sie aus dem Besitz der Societas Jesu an den Orden der Konstantinsritter über, die sie zu Ehren König Ferdinands IV. auf ihren heutigen Namen umtauften; seit 1837 gehört sie der Arciconfraternità dell’Addolorata, für die Pergolesi sein »Stabat Mater« komponiert hat; es wird seitdem an jedem Karfreitag hier aufgeführt.
Die von Giov. Giac. Comforto entworfene Architektur hält sich im Rahmen des konventionellen Jesuitenbarocks: reich dekorierte 2geschossige Fassade, innen tonnengewölbter Saalraum mit Seitenkapellen und kreuzförmiger Kuppelvierung vom Typus des röm. »Gesù«, Pilaster mit kräftig verkröpftem Gebälk nach dem Vorbild Grimaldis (S. Maria degli Angeli, SS. Apostoli). Die ausgezeichnete Marmordekoration des Innern stammt von Fanzago; Wände und Gewölbe wurden 1678 ff. von dem bekannten Schnellmaler Paolo de Matteis mit Fresken bedeckt (Triumph der von Ignatius von Loyola, Franz Xaver und Francesco Borgia propagierten Religion über die Häresie, Szenen aus dem Leben und Wirken des Franz Xaver); die Malereien der Kuppel stammen von Giac. Diana. — Am Hochaltar S. Ferdinando von Federico Maldarelli; am linken Querschiffaltar eine Immacolata von Fracanzano und 2 Statuen (Moses und David) von D. A. Vaccaro (der David beg. von seinem Vater Lorenzo). Rechter Querschiffaltar: Erscheinung Christi vor S. Ignazio, dem Stanzione-Schüler F. A. Altobello zugeschr.
SS. Filippo e Giacomo (Via S. Biagio dei Librai, an der Ecke der gleichnamigen Querstraße) wurde 1593 von der Seidenweberzunft gegründet und erhielt um die Mitte des 18. Jh. durch Gennaro Papa seine heutige Gestalt.
Die wuchtige Eingangsfassade zeigt im Untergeschoß die vorzüglichen Statuen der Titelheiligen von Gius. Sammartino, oben »Religion« und »Glaube« von Gius. Picano. — Das Innere, ein tonnengewölbter Saal mit je 4 Seitenkapellen und quadratischer, kuppelbekrönter Chor-Tribuna, hat prächtige Marmor-, Stuck- und Holzdekorationen; bes. hübsch die Weihwasserbecken, die Chorbrüstung, die Gitter der in das Hauptgebälk eingelassenen Coretti und der Sängertribüne über dem Eingang, schließlich der Majolikafußboden (von 1749). Die Fresken des Eingangsbogens (Tugenden) stammen von Alessio d’Elia (1750), die des Schiffsgewölbes (Jakobus auf dem Konzil von Jerusalem, Assunta, Phil-
ippus und Nathanael vor Christus, 1757) und der Kuppelzwickel (Evangelisten, 1759) von dem Solimena-Schüler Giac. Cestaro. Von demselben die Seitenbilder des Chores (Martyrien des Jakobus und Predigt des Philippus, 1757). Am Hochaltar eine Madonna mit Heiligen von Ippolito Borghese. In den Seitenkapellen Bilder von d’Elia, Lorenzo de Caro und Francesco la Marra; die 1. Kapelle links enthält eine schöne hölzerne Pietà-Gruppe des 16. Jh.
S. Filippo Neri (Chiesa dei Gerolomini; an der Via dei Tribunali in unmittelbarer Nähe des Domes) ist eine der schönsten und kunstreichsten Kirchen von Neapel.
Die Kirche ist der Maria und allen Heiligen geweiht, wird aber gewöhnlich mit dem Namen des »humoristischen Heiligen« aus Rom (1515-95) bezeichnet, dessen Jünger, die Padri dell’Oratorio di S. Filippo, den Bau i. J. 1592 gründeten. Der Zuname Gerolomini bzw. Gerolamini leitet sich von einer nach dem hl. Hieronymus benannten Vereinigung von Weltpriestern her, die sich in Rom in S. Girolamo della Carità zu versammeln pflegte und der Filippo Neri angehörte.
Der Entwurf der Kirche stammt von G. A. Dosio, der auch bis zu seinem Tode (1609) die Bauleitung innehatte. 1619 wurde der Bau durch Dionisio di Bartolomeo (+ 1625) vollendet, bis auf Kuppel und Eingangsfassade, die um die Mitte des 17. Jh. von Dionisio Lazzari hinzugefügt wurden.
Die heutige Fassade an der Piazza dei Gerolomini ist das Ergebnis einer Umgestaltung von ca. 1780, für die der greise Ferdinando Fuga verantwortlich zeichnete. Die Front des 17. Jh., ebenfalls 3portalig und mit korinthischer Ordnung gegliedert, sollte, nach zeitgenössischem Zeugnis, durch einen »prächtigeren und dem Reichtum des Tempels angemessenen« Neubau ersetzt werden; so spendeten die Patres die runde Summe von 20 000 Dukaten für eine vollständige Marmorverkleidung der Schauwand. Die Prachtwirkung des kostbaren Materials wird gedämpft durch den kühl distinguierten Altersstil des Florentiners, der sich schon in der porzellanartigen Farbskala von Weiß und Taubenblau zu erkennen gibt. Der Gebrauch der Ordnungen ist klassizistisch streng — auf Verkröpfungen des Gebälks wird fast gänzlich verzichtet; das Detail, im Motivischen (Seitenportal-und Fensterrahmungen) immer noch Michelangelo verpflichtet, ist von einer dünnlinigen Schärfe und Eleganz, die vom Spätbarock weg auf den Geschmack der Empirezeit vorausweist. — Ungewiß bleibt, wie weit die Campanili, deren Borromini nachempfundene Rundformen sich etwas unvermittelt von der starren Flächigkeit der Schau-
wand ablösen, auf Fuga selbst zurückgehen. Der aus der Fassade des 17. Jh. übernommene plastische Schmuck — Moses und Aaron über dem Portal, Peter und Paul auf den Ecken des Hauptgesimses — stammt von Gius. Sammartino, die beiden letztgenannten Figuren viell. nach Entwürfen Fanzagos.
Das Innere, nach schweren Kriegsschäden getreu restaur., zählt zu den reichsten architektonischen Eindrücken der Stadt. Obwohl Dosio sich bes. in seinen vorausgehenden Florentiner Werken intensiv mit der »manieristischen« Architektur Michelangelos und seiner Nachfolger auseinandergesetzt hat, läßt sein eigener Stil sich kaum mit diesem Schlagwort treffen; vielmehr erscheint die Architektur von S. Filippo als ein Beispiel nachlebender Hochrenaissance-Klassik, harmonische Synthese florentinisch-röm. Baugedanken der »goldenen Zeit«. Wie bei der Mutterkirche der Filippiner, S. Maria in Vallicella in Rom, handelt es sich um eine Basilika, d. h. um den Gegentyp zum seitenschifflosen Saalbau der Jesuiten. Das Langhaus ist flach gedeckt, die Hochschiffwände, in Arkadengeschoß und Lichtgaden unterteilt, ruhen statt auf Pfeilern auf je 6 granitenen Säulen: »unzeitgemäße« Züge, die wohl als bewußte Anknüpfung an die Anfänge der Renaissance-Architektur, Brunelleschis Florentiner Langhauskirchen, verstanden werden dürfen. (Die gleichzeitige Jesuitenarchitektur Neapels zeigt ähnlich retrospektive Neigungen, vgl. S. 141.) Über die Bedenklichkeit, die der Säulenarkade für die klassizist. Doktrin anhaftet (Säulen sollen gerade Architrave, nicht Bögen tragen), setzt Dosio sich mit bemerkenswerter Freizügigkeit hinweg, verzichtet auch auf den Ausweg des späten Brunelleschi, der in diesem Fall Säulenkapitell und Bogenanfänge durch ein kämpferartiges Gebälkstück voneinander getrennt hatte. So bleibt das Hauptgebälk zwischen den beiden Geschossen der Hochwand die einzige Horizontalteilung, optisch getragen nur von den großen Pilastern, die dem Florentiner Muster folgend die Vierungspfeiler einfassen. In der Grundrißbildung dieser Pfeiler wiederum ist röm. Gedankengut verarbeitet: Ihre leicht abgeschrägten Innenkanten, die den (trügerischen) Eindruck einer Erweiterung des Vierungsraumes gegenüber dem Langhaus hervorrufen, verraten das Studium der Kuppelbauten Bramantes und seiner Schule (eine ähnliche Scheinerweiterung im Kuppeljoch der Gartenloggia von Raffaels
Villa Madama in Rom). — In Chor und Querhaus ist das Prinzip der Flachdeckenbasilika aufgegeben: 3 prächtig kassettierte Tonnenarme vermitteln das überraschende Bild eines in sich abgeschlossenen, kreuzförmigen Zentralbaus mit Vierungskuppel. Eine echt röm. Perspektive liefern auch die Seitenschiffe des Langhauses mit ihrer Abfolge fein stuckierter Flachkuppeln, die von ferne an Architekturen Raffaels und Giulio Romanos erinnern. — Die Stuckdekoration des Mittelschiffes, die wohl auf Dosio selbst zurückgeht (die Marmorinkrustationen dagegen gehören erst dem 18. Jh. an), ist leider großenteils den Bomben von 1943 zum Opfer gefallen; ebenso ein Teil der reich geschnitzten und vergoldeten Holzdecke von 1627.
Ausstattung. Einigermaßen davongekommen ist glücklicherweise die Eingangswand; sie trägt eines der Hauptwerke Luca Giordanos, Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel, von 1684. Auch hier, im Zenit der neapolitan. Barockmalerei, weht Hochrenaissanceluft: Borgo-Brand und Heliodor-Fresko aus Raffaels Stanzen wirken als Muster des großen, dramatisch bewegten Historienbildes fort; das unmittelbare Vorbild lieferte Lanfranco mit seiner »Piscina probatica« in SS. Apostoli. Eine großzügige, dabei fest und übersichtlich gebaute Architektur (wahrscheinl. von Arcangelo Guglielmelli entworfen) füllt die unregelmäßig begrenzte Fläche wie selbstverständlich aus; kleine Asymmetrien in der Führung der Stufen unten, der Vorhänge oben arbeiten dem Eindruck der Starrheit wirksam entgegen. Aus dem Hintergrund hervortretend, dringt Christus mit souveräner Zorngebärde auf seine Widersacher ein; mit ihm bricht eine wogende Lichtflut aus dem Innern des Tempels hervor, die die vielfigurige Szenerie in wechselvolles Helldunkel taucht. Die virtuose Beherrschung des Gegenlichts, mit lockeren, beinahe durchsichtig wirkenden Schatten und hell überstrahlten Figurenrändern, verrät ein genaues Studium der Venezianer (Tintoretto, Bassano). Nirgends freilich löst die allgemeine Flucht sich in malerisch-formlosen Wirbel auf: eine abgestufte Fülle klarer, schöner Bewegungsmotive, die den unvermeidlichen Aufbruch ausdrücken, macht die Handlung deutlich. Die auf einer Wolke von links oben glorreich hereinschwebenden Engelchen vollenden den Eindruck himmlischer Leichtigkeit des reinigenden Gewaltaktes. Die unvergleichliche Frische und Sicherheit von Lucas Pinsel ist in jedem Detail zu spüren — man gehe die einzelnen Köpfe durch, genieße die treffsichere Ökonomie, mit der das gegenständliche Beiwerk behandelt ist, und erfreue sich an so saftigen Randfiguren wie der Mutter mit den 2 Knaben links oder dem Brezelverkäufer rechts unten neben der Tür.
Die übrige Freskoausstattung der Kirche ist nur lückenhaft erhalten. Das Thema des Eingangsfreskos — Verteidigung der Kirche
gegen Übergriffe weltlicher Gewalten — wird aufgenommen von den 1736 entstandenen Wandbildern der ersten Seitenschiffjoche: links die Vertreibung des Heliodor (vgl. S. 141), rechts die Bestrafung des Königs Usia, der das Priestermonopol gebrochen und selber dem Herrn geräuchert hatte (2. Buch der Chroniken, 26); sie stammen von dem Gaulli-Schüler und Giordano-Nachahmer Lodovico Mazzanti; die beiden Bozzetti werden in der Sakristei verwahrt. Die Heiligen in den Zwickeln der Langhausarkaden sind von G. B. Beinaschi (1681), die Figuren in den Schildbögen der Querschiffe (Moses, David, Abraham, Melchisedek) von Solimena, die Evangelisten der Kuppelzwickel wieder von Mazzanti.
In der durch Bomben beschädigten Kuppelwölbung Freskenreste aus dem 19. Jh. (Camillo Guerra, 1847-52); man hatte damals die von Dionisio Lazzari ausstuckierte alte Kuppel wegen Baufälligkeit abtragen und durch einen Neubau ersetzen müssen.
Kapellen am linken Seitenschiff: 2. Altes Gnadenbild, Madonna della Neve gerahmt von Gottvater, Joachim und Anna, von Gius. Marullo. — 3. Begegnung des hl. Filippo Neri mit dem großen Kirchenreformer S. Carlo Borromeo von Luca Giordano. — 4. H1. Agnes von Roncalli. — Letzte (6.) Kapelle: Am Altar ein schönes Bild von Paolo de Matteis (Madonna mit Petrus, Paulus und Franz von Sales), an den Wänden Szenen aus dem Leben dieses Heiligen von Francesco de Mura.
Kapellen am rechten Seitenschiff: 1. Tod des hl. Alexius von Pietro da Cortona, dem Hauptmeister der röm. Hochbarockmalerei (1638). — 2. Hl. Familie von Fabrizio Santafede. — 3. Hl. Hieronymus von Francesco Gessi. — 4. Epiphanie von Corenzio, an den Seiten Marterszenen (die hll. Ursula und Cordula) von Fabrizio Santafede. — Letzte (6.) Kapelle: Malerisch großartige Maria Magdalena unter dem Kreuz von Luca Giordano.
Die linke Wand des Querschiffs füllt ein 2geschossiger Altar aus, dessen exquisite Architektur möglicherweise noch Dosio verdankt wird (1606 vollendet; rechts gegenüber das später ausgeführte Gegenstück). Die beiden Altargemälde stammen von Cristoforo Roncalli (Christi Geburt) und Fabrizio Santafede (Verkündigung an die Hirten), die Heiligenstatuen von Pietro Bernini.
Chor: Die beiden vielbewunderten Leuchterengel an den Enden der Chorbrüstung schuf Gius. Sammartino; der marmorintarsierte Hochaltar stammt von Dionisio Lazzari, das Mittelbild der Chorapsis (Madonna di Vallicella) von Giov. Bernardo Azzolino, die Seitenbilder von Corenzio (Gefangennahme Christi und Kreuzigung) und Luigi Rodriguez (Grablegung, 1603). — Die linke Nebenchorkapelle ist dem Filippo Neri, der hier gebetet haben soll, geweiht und 1728-30 von Solimena ausgemalt worden. Die kleinformatigen Fresken, leider nicht gleichmäßig gut erhalten, zeigen den Spätstil des 70jährigen Meisters und illustrieren zu-
gleich die letzte Entwicklungsphase der neapolitan. Barockmalerei, die Wendung ins Dekorative; erst im Zusammenklang mit der raffinierten Marmorverkleidung der Wände und des Fußbodens kann der zartfarbige Schmelz der Gemälde sich voll entfalten (elektrische Beleuchtung vorhanden und hilfreich). Über den Seitentüren des Altarraums 2 caravaggeske Nachtstücke, Verleugnung und Befreiung Petri, viell. von Bernardo Cavallino. — In der rechten Nebenchorkupelle eine Immacolata von Cesare Fracanzano.
Nebenräume: Zur Linken der Filippo-Neri-Kapelle (linke Nebenchorkapelle) führt ein schmaler Korridor zu der in reinstem neapolitan. Rokoko ausgestatteten Sakristei. Der vordere Teil des Raumes hat prachtvolles Schrankwerk; das Deckenbild, eine Glorie des hl. Filippo Neri in der Art des Solimena, wird z. Z. restauriert. Es folgt ein kleiner überkuppelter Kapellenraum mit Stuck- und Marmordekorationen von erlesener Delikatesse; die Fresken, in zarten Sfumato-Tönen, stammen von Leonardo Olivieri, einem Schüler Solimenas (1750). Am Altar ein Meisterwerk Guido Renis, Begegnung Johannes’ d. T. mit Christus: 2 Epheben (auch Christus noch bartlos) in klassischen Posen vor arkadisch gestimmtem Landschaftshintergrund; der poetisch-mythologische Grundton, auch das außerordentlich schöne Inkarnat der Jünglingsakte weisen in die Zeit des großen Atalanta- und Hippomenes-Bildes in Capodimonte, zwischen 1620 und 1625.
Von der Sakristei aus gelangt man in die Quadreria, eine veritable Galerie von Gemälden aus dem Besitz der Kirche. Wir nennen unabhängig von der häufig wechselnden Hängung einige der Hauptwerke: Zunächst 2 weitere Renis, ebenfalls aus der Zeit seines neapolitan. Aufenthalts, zu Anfang der 20er Jahre des 17. Jh. Die Flucht nach Ägypten (deren Eigenhändigkeit gelegentlich wohl zu Unrecht angezweifelt wurde) ist ein stimmungsgewaltiges Nachstück von rotbräunlichem Kolorit und feinster Abstufung des mimischen und gestischen Ausdrucks. Die Lodovico Caracci nahestehende Ekstase des hl. Franz zeigt jenen »himmelnden« Blick, durch den Reni beim heutigen Publikum in Verruf gekommen ist; allein die Verve der Malerei und der tonige Reichtum der Atmosphäre werden auch dem voreingenommenen Betrachter Genuß bereiten. Unter den Werken der neapolitan. Schule fallen 2 Bilder von Battistello Caracciolo ins Auge: eine Taufe Christi aus den ersten Schaffensjahren des Künstlers (etwa 1608), Fragment eines für S. Giorgio dei Genovesi gemalten Altarbildes, und die Halbfigur eines kreuztragenden Christus (um 1615/16). Von Fracanzano findet man eine Immacolata und eine Geißelung Christi; von A. Vaccaro eine schöne Anbetung der Hirten; von Stanzione die Hochzeit zu Kana in hartem, caravaggeskem »Kellerlicht«. Eine Beweinung Christi aus der von Ribera bestimmten Frühzeit des Luca Giordano zeigt den jungen Virtuosen auf noch etwas gewaltsamer Suche nach eigenen Effekten. — Matthias Sto-
mer, der flämische Wahlneapolitaner, ist durch einen biederen Hieronymus vertreten. — Von Quinten Massys derselbe Heilige, nach dem bekannten Dürer-Stich. — Zu erwähnen ferner ein kleines vielfiguriges »Ecce homo« vor reicher Stadtkulisse (flämisch, 16. Jh.) und eine auf Kupfer gemalte Kreuzigung mit Maria, Maria Magdalena und Johannes von Girolamo Sicciolante da Sermoneta.
Das Konventsgebäude (zugänglich durch die Quadreria oder von der Via del Duomo, gegenüber der Domfassade) enthält 2 von Dionisio di Bartolomeo und Dionisio Lazzari erbaute, durch eine tonnengewölbte Treppenanlage miteinander verbundene Kreuzgänge. Der untere, ein ehem. Palasthof, noch mit altem Majolikapaviment, hat dorische Arkaden über Marmorsäulen; an der W-Seite ein hübsch dekorierter Uhrturm mit Madonnenrelief. Oben ein großer, überaus prächtiger ionisch-korinthischer Pfeilerhof mit dem lustigen Motiv einer durchbrochenen Attika, durch die der Himmel hereinschaut; ein wohlbestellter Obstgarten gewährt dem Auge die erwünschte Ruhepause. — Von hier aus Zugang zu der berühmten Bibliothek der Gerolomini mit reichen Schätzen an Manuskripten, Inkunabeln und alten Notenbüchern. Der durch 3 Geschosse gehende Hauptsaal, 1726-36 von Marcello Guglielmelli erb. und von Franc. Malerba und Crist. Russo ausgemalt, ist der schönste Bibliotheksraum Neapels (1925 restaur.). Als Lesesaal dient jetzt das ehem. Refektorium der Patres.
S. Francesco all’Arco Mirelli (oder, nach der Familie des Stifters, degli Scaroni; Via dell’Arco Mirelli im Chiaia-Viertel, unmittelbar unterhalb von S. Giovanni e Teresa). Die von G. B. Nauclerio erbaute, 1721 geweihte Franziskanerinnenklosterkirche ist ein einfacher, strenger Kreuzkuppelbau mit abgeschrägten Pfeilerstirnen und leicht in die Länge gezogenen Chorarmen. Die flache Rückwand des Chores öffnet sich oberhalb des Gebälks zu einer vergitterten Emporenöffnung, die Durchblick in das Spiegelgewölbe des hochgelegenen Nonnenchors gewährt. Hauptmotiv der Dekoration sind 16 große Säulen: 8 umgeben die Kuppelvierung, je 2 stehen unter Eingangs- und Chorbogen und an den Querschiffaltären, deren leicht auseinander gedrehte Giebelecken die einzige sichtbare Abweichung vom rechten Winkel bilden. — Die Stuckdekoration der strahlend weißen Wände beschränkt sich auf klar umgrenztes Rahmenwerk und gelegentliche Engelsköpfchen; nur in der Zartheit des Lineaments, dem schmiegsamen Ineinandergleiten struktiver und dekorativer Formen spricht der Geist des Settecento.
S. Francesco delle Cappuccinelle a Pontecorvo (Salita Pontecorvo), ein Kapuzinerinnenkonvent, 1712 von G. B. Nauclerio neu errichtet. Die Straßenfront hat über einer doppelläufigen Rampentreppe ein hübsches Portal mit schräg auswärts gedrehten Pilastern, gebrochenem Segment-
giebel und Ovalmedaillon. — Vom Innern ist leider nur die 2 Joche tiefe Pfeilervorhalle mit feinem grün-weißem Stuckdekor und einem Marmorportal mit bronzenen Türflügeln zu sehen; der Kirchenraum selbst scheint in Wohnungen aufgeteilt und ist vollkommen unzugänglich.
S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito, gegenüber dem Palazzo Reale)
Der Titel geht auf eine von den Anjou gegründete und dem hl. Ludwig von Toulouse geweihte Kirche zurück, die 1482 den Bettelbrüdern des hl. Franz von Paola übereignet wurde. Kirche und Konvent fielen zu Beginn des 19. Jh. der Neugestaltung des Platzes zum Opfer, die ein Hauptwerk des neapolitan. Klassizismus und zugleich die ideale Kulisse einer südl. Residenzstadt bildet.
Die Vorgeschichte des ganzen Komplexes läßt sich bis in die Anfangszeit der Bourbonenherrschaft zurückverfolgen. 1740 errichtete Ferdinando Sanfelice aus Anlaß einer Jubelfeier hier eine monumentale Festdekoration, die nicht zuletzt dazu dienen mußte, die Elendsquartiere am Fuße des Pizzofalcone den königlichen Blicken zu entziehen. Die gleiche Aufgabe fiel 1799 bei den Feierlichkeiten für die erste Rückkehr Ferdinands I. dem Vanvitelli-Schüler Francesco Maresca zu; dieser entwarf dann auch umfangreiche Schaugerüste für den Einzug des Joseph Bonaparte (1806) und seines Nachfolgers Joachim Murat (1808). Im folgenden Jahr faßte der neue König den Entschluß, den Platz zum »Foro Murat« zu erheben und mit einer stabilen Architektur zu schmücken. Aus den im Wettbewerb eingereichten Projekten wählte Maresca dasjenige von Leopoldo Laperuta und Antonio de Simone, das eine dem Pantheon nachgebildete »Rotonda« zwischen 2 im Halbkreis vorspringenden Kolonnadenarmen vorsah. Nachdem der Bau der Säulenhallen bereits in Gang gekommen war, setzte die Vertreibung Murats (1815) den Unternehmungen ein vorläufiges Ende; jedoch griff der wiedergekehrte Ferdinand die Idee auf und befahl den weiteren Ausbau des nunmehr »Foro Ferdinandeo« genannten Platzes und einer dem Franz von Paola geweihten Votivkirche. Das interessanteste Ergebnis des neuen Wettbewerbs war ein Entwurf des 20jährigen Neapolitaners Pietro Valente, dessen Kirche mit Tambourkuppel über griech. Kreuz an Soufflots Pariser Panthéon (Ste-Geneviéve) sowie an die Londoner Paulskathedrale und damit zugleich an die Peterskuppel Bramantes anknüpfte. Eine weitverzweigte Intrige, an der u. a. Antonio Canova und die röm. Lukas-Akademie tätigen Anteil nahmen, verhinderte die Ausführung des preisgekrönten Projektes; an seine Stelle trat ein Entwurf des Pietro Bianchi aus Lugano, nach dem 1817-36 der heute stehende Bau errichtet wurde.
Die Architektur der Piazza del Plebiscito hat Bianchi mit geringen Veränderungen (Reduzierung der Kopfbauten der Kolonnadenarme, dorische statt korin-
thische Ordnung) aus dem Plan des Murat-Forums übernommen. In Gestalt und Anordnung der Säulenhallen wie des giebeltragenden Mittelportikus wirkt die Architektur Palladios (Villenentwürfe) als bestimmendes Muster; für »Lokalfarbe« sorgen steingraue Gliederungen vor karminrot verputzten Wänden, die im Verein mit dem bleichen Graugelb der Häusermasse des Pizzofalcone ein unverwechselbar neapolitan. Bild ergeben. Die östl. anschließende Rechteckfläche des Platzes wird von 2 streng symmetrisch gebildeten 2geschossigen Palastfronten eingefaßt, in denen das Giebelmotiv wiederkehrt. Der Palazzo della Prefettura (ehem. Foresteria) an der N-Seite wurde gegen 1815 errichtet und scheint Laperutas Forum-Plan anzugehören. Der südl. gelegene Palazzo dei Principi (oder dei Ministri dello Stato, später del Principe di Salerno) bestand schon zu Ende des 18. Jh. und wurde wahrscheinl. von Laperuta umgestaltet.
Mit dem Namen Canovas sind die 2 schönen bronzenen Reiterbilder verknüpft, die auf dem Vorplatz der Kirche stehen. Der erste Auftrag von 1807 ging von Joseph Bonaparte aus und betraf ein Napoleon-Monument; bis der gewissenhafte Künstler mit seinem Pferd zu Rande gekommen war, hatten die Zeitläufte sich dahingehend entwickelt, daß nunmehr der Bourbonenkönig Karl III. zum Reiter ausersehen wurde. Ein 1820 nach Neapel transportiertes Modell fand allgemeinen Beifall; man stellte das fertige Werk rechts (vom Beschauer aus) auf und bestellte als Gegenstück ein Denkmal des regierenden Königs Ferdinand, von dem jedoch nur das Pferd von Canova selbst vollendet wurde; nach dem Tode des Meisters (1822) arbeitete Antonio Call die merklich schwächere Reiterfigur (vgl. dazu Canovas Terrakottabüste im Museo Filangieri, s. S. 298).
Bianchis Kirche ist nach der großen Rotunde von St. Blasien (M. d’Ixnard, 1768-83) der wichtigste neuere Nachfolgebau des Pantheons. Sie imponiert durch gewaltige Dimensionen, ohne dabei jenen Eindruck erdgebundener Massigkeit zu erzeugen, der für das röm. Denkmal charakteristisch ist.
Das Äußere des vollständig fensterlosen Gebäudes ist ringsum von glattem, gleichmäßig verfugtem Quaderwerk überzogen. Der hinter den Kolonnaden sichtbare Unterbau erscheint als ein stereometrisch reiner Rechteckblock; aus ihm steigen ohne weitere Vermittlung die mächtigen Trommeln der Hauptkuppel und ihre beiden Trabanten empor.
Dem antiken Vorbild folgt das Profil der Gewölbeschalen
mit ihren gestuften Fußringen (jetzt durch aufmontierte Scheinwerferbatterien verschandelt) und rippenlosen Kalotten; jedoch sind die Scheitelöffnungen von kegelförmigen Glasdächern überdeckt. Am genauesten schließt sich die Eingangshalle, ein Raum von unbestreitbar großartiger Wirkung, dem klassischen Muster an: 6 ionische Marmorsäulen zwischen Antenpfeilern bilden die Front (auf dem Giebel eine Allegorie der Religion, flankiert von den hll. Franz von Paola und Ferdinand von Kastilien); das Innere ist durch weitere Säulenstellungen in 3 tonnengewölbte Schiffe unterteilt, deren jedes auf ein riesenhaftes Eingangsportal zuführt.
Der Übergang zwischen Vorhalle und innerem Rundraum wird hier durch eine in der Querachse ausgespannte Vestibülzone vermittelt; zu ihr gehören die beiden schon von außen her sichtbaren Eckkapellen, Kuppelräume über sechseckigem Grundriß mit quadratischen Chorarmen und flachen Apsiden. — Der kreisrunde Mittelraum, in seinem Hauptmotiv dem großen Vorbild getreulich nachgestaltet, erinnert gleichwohl eher an den Prunksaal eines Empireschlosses als an einen Bau der Antike. Das durch die Verglasung gedämpfte Oberlicht, von der grau-weißen Marmordekoration gleichmäßig reflektiert, taucht den Raum in einheitlich-diffuse Helligkeit; die Wände des Zylinders erscheinen in beiden Geschossen aufgelöst in ein durchsichtiges Gitterwerk von Säulen und Pfeilern, jenseits dessen eine unkontrollierbare Zone im Halbschatten liegender Nebenräume sich auftut. Die wichtigsten »Korrekturen« des klassischen Musters liegen einmal in der Nutzbarmachung der Attika als Logengeschoß, zum anderen in der Reglementierung des Aufrißsystems: In gleichmäßigen Abständen laufen die Säulen des Untergeschosses ringsum, teils frei vor den Öffnungen stehend, teils als 3/4-Säulen mit den Mauerkernen der Pfeiler verbunden; ihre Achsen setzen sich nach oben bis in die Kassettierung der Kuppel fort und geben dem Aufriß von Wand und Gewölbe ein festes Gerüst. Demgegenüber steht ein eigentümlicher Substanzverlust des Raumes selbst, bewirkt durch die leichte Streckung aller Verhältnisse, die das elementare Proportionsgesetz des Vorbildbaus — Höhe gleich Weite, Höhe der aufgehenden Wand gleich Kuppelradius — zerstört. So hat die höhlenhaft-geschlossene Schale des röm. Tempels sich in
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Duomo S. Gennaro (S. Restituta). Reliefplatte mit der Geschichte Josephs (12./13. Jh.)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Duomo S. Gennaro (S. Giovanni in Fonte). Kuppelmosaik (5. Jh.)
eine im modernen Sinne »offene« Struktur verwandelt; das feste Gleichgewicht der Kräfte und Lasten hat einem schwerelos-labilen Aufwärtsstreben Platz gemacht.
Vor der Chorkapelle gegenüber dem Haupteingang steht ein prächtiger Pietra-dura-Altar von Anselmo Cangiano (1641), der aus SS. Apostoli hierher verbracht wurde; die 8 antikisierenden Heiligenstatuen des Mittelraums und die Altarbilder der Seitenkapellen stammen von Künstlern des 19. Jh.
Dom S. Gennaro (Via del Duomo) San Gennaro, Neapels größtes und prächtigstes Gotteshaus, umfaßt Bau- und Kunstdenkmäler aus allen Epochen des Christentums.
Der alte Tempelbezirk im O der Agora (s. S. 18) erscheint schon in frühchristl. Zeit als Sitz des Episkopats. Schriftquellen wie architektonische Überreste ermöglichen die ungefähre Rekonstruktion eines Baukomplexes, der an die »Doppelkathedralen« des 1. Jahrtausends (Trier, Aquileia, Pavia) denken läßt: 2 nebeneinanderliegende, parallel zu den »Cardines« des alten Straßennetzes von S nach N orientierte Basiliken, deren Eingänge dem Decumanus Maior (Via dei Tribunali) zugewandt waren. Die westliche dieser Basiliken, urspr. wohl eine Marienkirche, wurde im 8. Jh. mit den Reliquien der hl. Restituta (vgl. S. 436) ausgestattet. Sie bildet heute eine Art Seitenkapelle des Domlanghauses (vgl. S. 117); ihr Grundriß — extrem breites Mittelschiff, doppelte Seitenschiffe, kein Querhaus, stark einspringender Triumphbogen auf Freisäulen, Baptisterium am Ende der rechten Seitenschiffe — erinnert an nordafrikanische Basiliken (Sabratha). Über ihre Entstehungszeit ist nichts Sicheres auszumachen. Der Urbau könnte identisch sein mit jener von Konstantin d. Gr. »in civitatem Neapolim« errichteten Basilika, von der der röm. Liber Pontificalis berichtet; jedoch weist die Form der Kämpfer über den Triumphbogensäulen, wie unlängst beobachtet wurde, zum mindesten auf einen Umbau des 5. Jh. hin. — Der weiter östl., etwa in der Gegend des heutigen Querschiffs gelegene, dem Salvator geweihte Zwillingsbau, die Stefania, wurde um 500 von Bischof Stephan I. gegründet, gegen Ende des 8. Jh. durch Feuer zerstört und von Stephan II. wiederhergestellt; seit Athanasius I. (849-872, vgl. S. 135) führt er den Titel des hl. Januarius. Einige Säulenstellungen, die man innerhalb des heutigen Bischofspalastes gefunden hat, lassen auf eine Basilika mit 3schiffigem, relativ kurzem Langhaus (6 Säulenarkaden) und 4 x 6 Säulen umfassendem Atrium schließen.
Der Entschluß zur Errichtung des neuen, west-östlich gerichteten Domes, der zunächst der Maria Assunta geweiht war, wird traditionellerweise mit Karl I. von Anjou in Verbindung gebracht, ohne daß dieser Umstand sich näher belegen ließe; erst aus den
Jahren 1294-1313, also aus der Regierungszeit Karls II. und seines Sohnes Robert d. Weisen, sind Baunachrichten überliefert. Die weitere Geschichte zeigt den für Neapel charakteristischen Wechsel von Erdbebenschäden und Restaurierungen; umfangreiche Wiederherstellungsarbeiten sind für die Zeit um 1500, 1680, 1787 und 1837-44 bezeugt.
Eine nahezu vollständige Neuschöpfung des späteren 19. Jh. stellt die Eingangsfassade dar.
Die Fassadenarchitektur des Urbaus, über deren Vollendungsgrad wir nichts sagen können, fiel dem Erdbeben d. J. 1349 zum Opfer, das auch dem ganzen übrigen Gebäude schwere Schäden zufügte. Erhalten hat sich aus dieser ersten Phase nur die sehr schöne, dem Tino di Camaino nahestehende Sitzmadonna in der Nische des Tympanons über dem Mittelportal. Die übrigen Teile der 1943 durch Bomben beschädigten, 1951 restaurierten Portaldekoration entstammen einer Wiederherstellung vom Anfang des 15. Jh.; die Inschrift über dem Türsturz nennt, in gewundenem Latein, das Vollendungsdatum 1407, eine andere, heute zerstörte Inschrift am Sarkophag des Penna-Grabmals in S. Chiara den Meister Antonio Baboccio aus Priverno (»Abbas Antonius Babosius de Piperno me fecit et Portam Maiorem Katedralis ecclesiae Neapol.«). Die alte Tympanon-Madonna erhielt als Assistenzfiguren die hll. Petrus und Januarius, die den knienden Stifter Kardinal Enrico Minutolo empfehlen. Am Türsturz wechselt das Minutolo-Wappen mit dem des Königs Ladislaus von Durazzo; dazwischen die 4 Evangelisten; in der Archivolte des Bogenfeldes Halbfiguren der 12 Apostel, an der Spitze 2 Engel in Anbetung der Taube. Der Wimperg enthält im kreisrunden Mittelfeld eine Marienkrönung, umgeben von musizierenden Engeln. Die Giebelspitze wird bekrönt von der Statue des Erzengels Michael; die flankierenden Fialen tragen zuoberst eine Darstellung der Verkündigung, darunter Statuen der hll. Agrippinus, Euphebius, Petrus Martyr und Anastasia (links) sowie Restituta, Agnellus, Thomas und Nikolaus (rechts). Die beiden Porphyrsäulen mit ihren prächtigen Trägerlöwen, die ein Rind und einen Widder in ihren Klauen halten, scheinen nicht zum ursprünglichen Bestand der Portalarchitektur zu gehören; sie könnten von dem im 16. Jh. zerstörten Grab des Karl Martell von Ungarn (s. S. 129) stammen.
Die erste durchgreifende Erneuerung der Gesamtfassade geschah 1781-88. Das im Stich überlieferte Projekt des neapolitan. Architekten Tommaso Senese bildet ein interessantes Exempel für die romantische Neogotik des späten 18. Jh. Die alte Tuffsteinmauer wurde hell verputzt, ihr winklig gebrochener oberer Umriß durch fialenartig aufragende Zierobelisken akzentuiert; Gesimse und schlanke Halbsäulendienste ergaben ein durchgehendes Feldersystem, in dem Portale, Spitzbogenfenster und spitze Dreiecksgiebel vertikale Einheiten bildeten. 2 fensterlose, gequaderte Ecktürme faßten die Front ein. 1876 wurde, anläßlich des Ausbaus der Via del Duomo zur Hauptstraße des alten Stadtzentrums, die Errichtung
einer neuen Fassade beschlossen. Wie an der kurz zuvor begonnenen Schauseite des Florentiner Domes entschied man sich für eine 3-Giebel-Front nach Art der Fassaden von Siena und Orvieto, in aufwendigster Manier mit Fialen, Wimpergen und Maßwerkfenstern, Statuen, Büsten und Flachreliefs dekoriert; die auf den Bau des 18. Jh. zurückgehenden Ecktürme sollten urspr. hochragende, von steilen Pyramidendächern bekrönte Campanili zu tragen bekommen. Der Entwurf stammte von Enrico Alvino und wurde nach dessen Tode (1876) von Nicola Breglia und Giuseppe Pisanti ausgeführt (1877-1905); den plastischen Schmuck schufen die berühmtesten Meister der damaligen neapolitan. Bildhauerschule, Francesco Jerace, Domenico Pellegrino, Raffaele Belliazzi, Salvatore Cepparulo und Alberto Ferrer.
Das Innere hat im Laufe zahlreicher Restaurierungen viel von seiner urspr. Wirkung eingebüßt; nur die machtvollen Raumverhältnisse erinnern daran, daß wir uns in einer der großen got. Kathedralen Italiens befinden. Dabei muß allerdings die Bezeichnung »gotisch« in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt werden. Der Grundriß — 3schiffiges Langhaus, weit ausladendes Querhaus, 3 Chorapsiden in den Fluchten der Längsschiffe — bleibt der von Montecassino ausgehenden roman. Tradition der Campania verpflichtet. 8 hohe spitzbogige Pfeilerarkaden fassen das Mittelschiff ein; doch wird ihre Aufwärtsbewegung sogleich durch ein kräftiges Horizontalgesims abgefangen. Darüber liegt ein relativ niedriger Lichtgaden mit urspr. rundbogig schließenden Fenstern (die barocke Holzdecke sitzt noch etwas tiefer als der offene Dachstuhl des ersten Baues). In apulischen Kirchen des 12. Jh. (Barlétta, Ruvo u. a.) findet sich der Pfeilertyp vorgebildet, der für die angiovinische Gotik Neapels kanonisch werden sollte. Er hat einen längsrechteckigen Kern mit Rundvorlagen (hier aus teilweise antiken Säulenschäften) nach den kreuzrippengewölbten Seitenschiffen und den Laibungen der Arkaden; die dem holzgedeckten Mittelschiff zugekehrten Breitseiten jedoch bilden glatte Flächen, so daß, für den Blick des Eintretenden, das echt italien. Bild eines wandhaft geschlossenen, in die Tiefe gerichteten Einheitsraumes über das nordisch-got. Jochsystem triumphiert. Das breite und tiefe Querschiff, gleichfalls flach gedeckt, bildet wiederum einen Raum für sich. An seiner O-Wand reihen sich 5 Chorkapellen, von denen die beiden äußeren aber nicht zum urspr. Bestand gehören. Die originale got. Gliederstruktur hat sich in der 1. Nebenkapelle rechts erhalten.
Als empfindlichster Eingriff in das Raumbild des ganzen Domes muß der barocke Umbau der Hauptchorkapelle be-
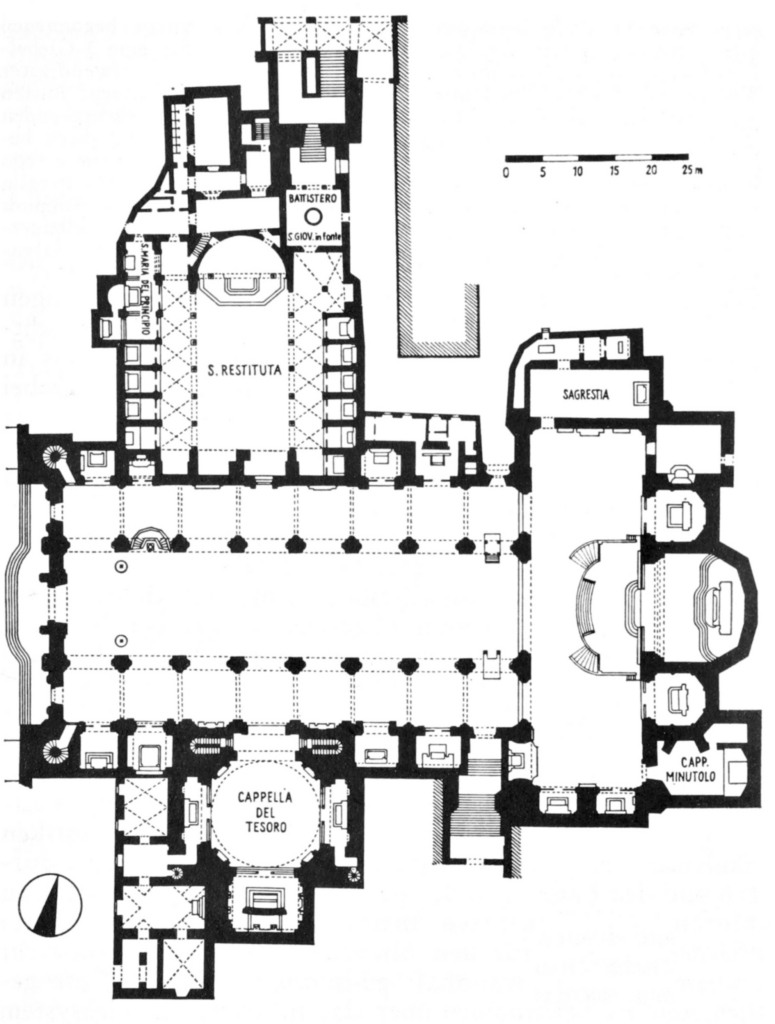 Dom S. Gennaro mit S. Restituta und Baptisterium. Grundriß
Dom S. Gennaro mit S. Restituta und Baptisterium. Grundriß
wertet werden. Ihre aus 7 Seiten des Zwölfecks gebildete Apsis besaß vordem ein von schlanken Diensten getragenes Rippengewölbe und 5 große Maßwerkfenster, deren riesige, steil aufschießende Lichtbahnen mit dem Horizontalismus des Langhaussystems äußerst wirkungsvoll kontrastiert ha-
ben müssen. Wiederholte Erdbebenschäden, v. a. 1349 und 1456, hatten fortlaufende Reparaturen dieses fragilen Bauwerkes notwendig gemacht; gegen Ende des 16. Jh. entschloß man sich zu einer durchgreifenden Verstärkung des Mauerwerks, wobei die Strebepfeiler der Außenwände durch Querbögen untereinander verbunden und 2 Fenster vollständig zugesetzt, die anderen in ihrer Öffnung wesentlich reduziert wurden. Als nach dem großen Beben von 1732 weitere Schäden aufgetreten waren, gab der sienesische Architekt Paolo Posi, im Auftrag des Kardinal-Erzbischofs Giuseppe Spinelli, dem Innern des Chores seine heutige Form (1741 ff.): Eine komposite Pilasterordnung nimmt nun die Geschoßeinteilung des Langhauses auf; in der unteren Zone sitzen halbhohe, scheinperspektivisch erweiterte Rundbogenfenster, im Obergaden ovale Lukarnen, darüber (jedoch etwas unterhalb des alten z. T. noch erhaltenen Rippengewölbes) eine mit flachen Gurtbändern verzierte geschlossene Apsiskalotte. Weitere Sicherungsarbeiten des 19. Jh. (1805 und später) scheinen den Formenbestand nicht mehr verändert zu haben.
Die bedeutendsten Werke der Innenausstattung des Domes sind an 3 Stellen konzentriert: in der ehem. Basilika der hl. Restituta und ihrem Baptisterium, in der Krypta (Succorpo) und in der Schatzkapelle des hl. Januarius (Tesoro); sie sollen in unserer Beschreibung den Vorrang erhalten.
S. Restituta, Neapels älteste Basilika, wurde bei Errichtung des got. Domes unter Karl II. an den Neubau angeschlossen (Zugang durch eine Holztür mit Bischofswappen in der Mitte des linken Seitenschiffes) und dabei weitgehend umgebaut. Nur die Säulen der Schiffe und des Triumphbogens blieben an Ort und Stelle (zum Urbau s. S. 113). Die urspr. Eingangsfront, viell. auch ein Stück des Langhauses, wurden beseitigt, die äußeren Schiffe in Kapellen umgewandelt, die inneren Schiffe eingewölbt, Mittelschiffarkaden und Obermauer neu aufgeführt. Unverändert blieb der Triumphbogen; Beschreibungen des 17. Jh. erwähnen noch das alte Mosaik mit dem von leuchterhaltenden Seraphim flankierten Thronenden Christus und den 24 Greisen der Apokalypse. Beim Erdbeben von 1688 stürzte ein Teil des Gebäudes zusammen; für die unbekümmert spätbarocke Wiederherstellung mit reichlichem Stuck- und Marmorzierat zeichnete Arcangelo Guglielmelli verantwortlich; das
große Deckengemälde (die wunderbare Seefahrt der hl. Restituta, begleitet von Maria, S. Gennaro und der im Wasser singenden Sirene Parthenope) stammt von Luca Giordano (1692).
An der inneren Eingangswand, Zur Linken des Eintretenden, steht ein marmorner Januarius-Altar von D. A. Vaccaro; er befand sich ehemals in der Krypta des Domes und wurde nach deren Restaurierung i. J. 1887 hierher verbracht. Hinter dem Hochaltar ein interessantes Tafelbild, Thronende Madonna. mit den hll. Michael und Restituta, in der Predella Szenen aus deren Geschichte, von einem unbekannten Meister des frühen 16. Jh.; das Hauptbild verrät venezianische, die sehr reizvolle Predella umbrische Einflüsse.
Am Ende des linken Seitenschiffes befindet sich die Cappella della Madonna del Principio, deren Ursprünge eine unbestätigte Lokaltradition bis in die Zeit der Kaiserin Helena, der Mutter Konstantins d. Gr., zurückverlegt. Auf dem 1322 datierten, wohlerhaltenen Apsismosaik (dessen Inschrift auf diese Überlieferung Bezug nimmt) sitzt die Himmelskönigin mit dem gleichfalls gekrönten Kinde auf einem prunkvollen, mit gedrehten Säulchen verzierten Cosmatenthron, flankiert von S. Gennaro und S. Restituta. Die Figur der Madonna zeigt alle Merkmale der röm. Cavallini-Schule; der in der Inschrift genannte Meister Lellus ist sonst nirgends nachweisbar. Die benachbarten Kapellenräume enthalten 2 marmorne Reliefplatten unklarer Herkunft und Bestimmung, Hauptwerke der kampanischen Plastik des 12. oder des beginnenden 13. Jh., deren nächste Verwandte etwa in Sessa Aurunca zu suchen wären. Figurenstil (große Köpfe, grazile Körper), Faltenbildung und vor allem die überaus subtile Marmortechnik verraten den Einfluß byzantin. Elfenbeinarbeiten. Die linke Platte (Tafel S. 112) stellt die Geschichte Josephs und seiner Brüder dar. Die obere Reihe zeigt die Schicksale des jungen Joseph (die Szenen laufen in jeder Reihe von rechts nach links): 1. Joseph erzählt im Kreise seiner Brüder dem Vater seine Träume. 2. Jakob schickt ihn aus, die Brüder zu besuchen. 3. Diese versenken ihn in den Brunnen. 4. Sie weisen den verzweifelten Eltern sein blutbeflecktes Gewand vor. 5. Er wird an die Händler verkauft und auf einem Kamel davongeführt. In der mittleren Reihe sehen wir Joseph in der ägyptischen Gefangenschaft: 1. Verkauf an Potiphar, dessen Weib bereits voll Interesse aus dem Fenster lugt. 2. Josephs Flucht vom Lager der Frau. 3. Joseph wird Potiphar vorgeführt, sein Rock zeugt gegen ihn. 4. In einem orientalisch-märchenhaften Gefängnis deutet Joseph dem Bäcker und dem Mundschenken ihre Träume. 5. Pharao träumt von den Ähren und den Kühen. In der unteren Reihe schließlich Josephs Triumph: 1. Die große Traumdeutungsszene vor Pharao. 2. Der von Pharao über alles Volk erhöhte Joseph fährt im Triumphwagen daher. 3. Er läßt Korn speichern.
4. Nach dem Besuch der Brüder wird Josephs goldener Becher in Benjamins Reisesack gefunden. S. Joseph hat die Seinen nachkommen lassen und schließt seinen alten Vater in die Arme. — Der Stil der rechten Platte hebt sich in vielem von dem des Gegenstückes ab: Das dekorative Beiwerk tritt in den Hintergrund; die Figuren sind größer und plastisch reicher, in Gewand- und Bewegungsmotiven von zahlreichen Klassizismen durchsetzt; die Kompositionen sind komplizierter, aber auch fester geworden. Dargestellt sind in der oberen Reihe Wunder-und Marterszenen aus dem Leben des hl. Januarius; in der mittleren die Geschichte Simsons; unten die kriegerischen Heiligen der Ostkirche, Theodor, Demetrius, Eustachius mit dem Hirsch und Georg.
Gegenüber, am Ende des rechten Seitenschiffs, finden sich ein röm. Sarkophag mit bacchantischen Szenen, ein hübsches Marmortabernakel aus der Schule des Tommaso Malvito, einige trecenteske Sarkophage und Fragmente der Domfassade des 18. Jh. (Fries mit heraldischen Motiven).
Von hier aus Zugang zum Baptisterium S. Giovanni in Fonte, dem bedeutendsten frühchristl. Monument von Neapel.
Als Gründer des Baues gilt, nach Auskunft der alten Bischofslisten, der hl. Severus (362-408); Umbauten oder Restaurierungen, deren Art und Umfang wir nicht beurteilen können, sind in den gleichen Quellen für die Zeit des Bischofs Soter (465-486) bezeugt.
Die Grundform des Raumes ist quadratisch; in der Gewölbezone entsteht durch über die Ecken gespannte flachbogige »Trompen« ein Oktogon, das ohne Absatz in eine segmentförmig abgeflachte Rundkuppel übergeht — viell. die älteste über Viereckigem Grundplan aufsteigende Kuppel in der Baukunst des christl. Okzidents. Genau unter dem Scheitel der Kuppel liegt das kreisrunde Taufbecken, eine Übergangsform zwischen »Piscina« und Taufstein: Der Täufling stand hier nur bis zu den Knien im Wasser und wurde übergossen (Infusionstaufe). Die Richtung des mosaizierten Kuppelkreuzes hat die meisten Autoren veranlaßt, den urspr. Zugang an der O-Wand des Raumes zu suchen (obwohl der Eintretende dann ja das Bild verkehrt herum sehen würde). Doch wäre ein quer zur Eingangsachse liegendes Kreuz für jene Zeit nichts Ungewöhnliches (vgl. Ravenna, Mausoleum der Galla Placidia); so bleibt es immerhin denkbar, daß Baptisterium und Restituta-Kirche von Anfang an in der heutigen Weise miteinander kommunizierten. Im Zentrum der O-wie der W-Wand, zwischen den Trompen, saß je ein kleines Fenster; die N-Wand wurde in nicht näher
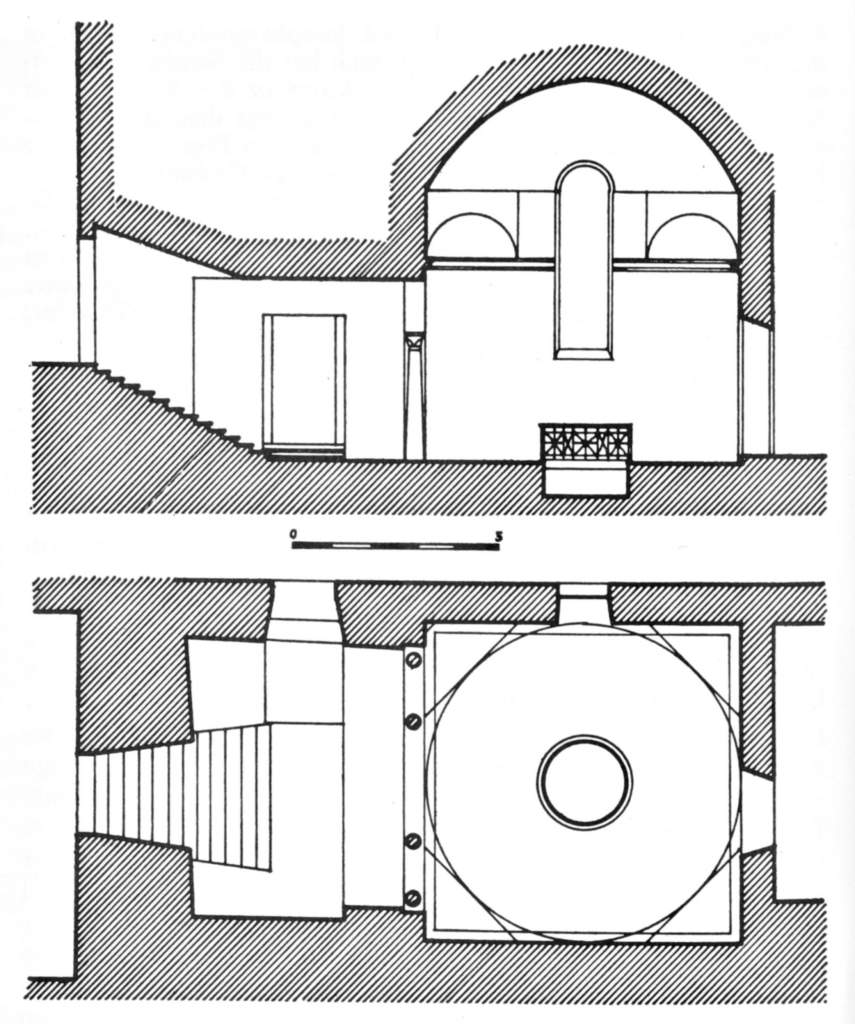 Baptisterium S. Giovanni in Fonte. Längsschnitt und Grundriß
Baptisterium S. Giovanni in Fonte. Längsschnitt und Grundriß
bestimmbarer Zeit (6. Jh.?) in eine offene Säulenstellung umgewandelt, um eine Verbindung mit den angrenzenden Teilen des Bischofspalastes herzustellen.
Wunderbarerweise haben sich Teile der originalen Mosaikdekoration erhalten (1896 sorgfältig restaur.; die freskierten Büsten Christi und der Maria an N- und S-Wand lassen auf eine Übermalung bzw. Ergänzung durch Künstler des Cavallini-Kreises im frühen Trecento schließen); sie zählen zum Schönsten, was an Malerei der Spätantike auf uns gekommen ist. Der Reichtum de
figürlichen wie ornamentalen Erfindung, die minuziöse Steintechnik, das blausilbrig schimmernde Kolorit, die unendlich fein modulierten Übergänge von Licht und Schatten, durch die eine atmosphärisch belebte Einheit von Raum und Figur sich herstellt, haben weder in Rom noch in Ravenna ihresgleichen. Am nächsten verwandt erscheinen die Mosaiken im Mausoleum der Galla Placidia und das Apsismosaik von S. Aquilino in Mailand, wohl aus der 1. Hälfte des 5. Jh.; auch der Mosaikschmuck des 458 erbauten Dombaptisteriums von Ravenna zeigt Ähnlichkeiten. Allein in allen diesen Beispielen scheint doch der Aufbau im ganzen großflächiger, die Zeichnung härter und eckiger, linearer, die Steinfügung gröber als in den Neapler Bildern; so wird man, unabhängig von der Datierungsfrage (Severus oder, wahrscheinlicher, Soter), bei der Beurteilung ihres Stils auch die Sonderstellung dieser immer noch »quasi griechischen Stadt« zu bedenken haben, in der hellenistisch-östliche Traditionen sich reiner und freier ausleben konnten als irgendwo sonst in Italien. (Ein etwas jüngeres Werk der gleichen Schule in S. Prisco bei Capua.) Fragt man nach dem Bedeutungsinhalt, so fällt zunächst das freie Ineinanderspielen der einzelnen Darstellungssphären ins Auge: Zeichen, Figuren, Szenen und dekoratives Beiwerk vereinigen sich zu einem Gesamtbild von fast teppichhafter Vielfalt und Dichte, in dem tektonische Rahmen- und Gliederungsformen nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen; dementsprechend tritt auch das ikonographisch-gedankliche Einheitsmoment des — hauptsächlich christologischen — Programms viel weniger scharf hervor als etwa in den Mosaiken des ravennatischen Baptisteriums. — Im gestirnten Himmel des Mittelkreises erscheint, flankiert von den Anfangs- und Endbuchstaben des griech. Alphabets, das Kreuzmonogramm Christi, über dem die Hand Gottes einen edelsteingeschmückten Kranz hält. Der blaue Grund des Firmaments ist von den Rändern zur Mitte hin illusionistisch abgetönt; die 74 Sterne funkeln mit jeweils 8 Strahlen und an deren Enden leuchtenden Punkten. Die ringsumlaufende Rahmenbordüre enthält Pflanzen und Fruchtkörbe mit Pfauen, Tauben und Perlhühnern und (an der W-Seite) einen aus den Flammen steigenden nimbierten Phönix als Chiffre der Auferstehung. — 8 Radialstreifen mit aus Vasen aufsteigenden, von Bändern durchflochtenen und gleichfalls von Vögeln belebten Fruchtgirlanden teilen die darunterliegende Gewölbefläche auf. Die einzelnen Felder zeigen in ihrer oberen Hälfte, zwischen schweren, faltig gerafften Vorhängen, nochmals Fruchtschalen mit gegenständigen Vogelpaaren; darunter szenische Darstellungen aus dem Leben des Erlösers, von denen sich folgende noch ungefähr erkennen lassen: An der Eingangsseite die Fragmente zweier Seewunder: unten Petri wunderbarer Fischzug (man sieht zur Linken die Gestalt des jugendlichen Christus, die Hand gegen das Wasser ausgestreckt, in diesem Fische und allerlei Seegetier, daneben wäre das Boot zu ergänzen); im oberen Streifen
ein Boot mit einem unbekleideten Fischer (vgl. Johannes 21, 7), viell. der Gang über das Wasser. Das nächste Feld links (Tafel S. 113) zeigt die Einsetzung des Apostelfürsten zum Statthalter Christi (Traditio legis): Christus, auf der Weltkugel stehend, reicht Petrus eine Schriftrolle mit den Worten DOMINUS LEGEM DAT; auf der linken Seite ist der stehende Paulus anzunehmen. Die Figuren und bes. der Kopf Christi zeigen einen etwas gröberen, primitiveren Stil als die übrigen: Wahrscheinl. haben wir es hier wie auch an einigen anderen Stellen (etwa in den Heiligenfiguren der unteren Zone) mit einer frühmittelalterl. Restaurierung zu tun. Das folgende Bild fehlt; im übernächsten ist die Schilderung des Weinwunders auf der Hochzeit zu Kana leicht zu erkennen; davor die Samariterin mit Christus am Brunnen. Auf der gegenüberliegenden Seite endlich war wohl der Engel mit den Frauen am Grabe dargestellt. Eines der ausgefallenen Bilder könnte die Taufe Christi gezeigt haben, die anderen weitere Wundertaten des Herrn (Krankenheilungen u. dgl.); doch scheint es kaum möglich, eine genaue Abfolge zu rekonstruieren. — Der unterste Streifen wird an den 4 Hauptseiten von stehenden Märtyrer- oder Apostelpaaren eingenommen; in den Zwickelfeldern der Diagonalseiten herrscht wieder die pastorale Idylle: Palmen mit Vögeln, weidende Lämmer, Hirsche, die zur Quelle gehen, im Zentrum jeweils liegend oder stehend ein Hirte. — Einen letzten Höhepunkt des Zyklus bilden die Ecknischen. Der seltsame Bildgedanke der 4 geflügelten Mischwesen, in denen sich die göttliche Majestät manifestiert (nach den Visionen Hesekiels, 1, 5 ff., und der Apokalypse, 4, 6 ff., von Irenäus und Hieronymus theologisch ausgedeutet und später zu »Evangelistensymbolen« erstarrt), ist viell. niemals großartiger realisiert worden; zumal der gleich einer feurig glühenden Erscheinung am nächtlichen Firmament auftauchende Markus-Löwe ist ohne Gegenstück in der westlichen Kunst (man vergleiche außer den schon genannten Monumenten die freilich durch einschneidende Restaurierungen entstellten Evangelistensymbole der Apsis von S. Pudenziana in Rom, vom Anfang des 5. Jh.). Zu seiner Rechten die Gestalt des Engels oder eher des Menschen (Matthäus), gegenüber der nur fragmentarisch erhaltene Lukas-Stier; der Adler des Johannes ist leider ganz verlorengegangen. Die eigenartige Bildung der Flügel aus einzelnen großen Federn, die wie Palmenwedel emporstehen, kehrt übrigens in S. Prisco wieder.
An der rechten Seitenwand ein großes hölzernes Kruzifix aus der 1. Hälfte des 13. Jh.; gegenüber ein Altarbild (Taufe Christi) von Francesco Curia.
Mosaikkunst. Kuppelkompartiment. Der wunderbare Fischzug, 451/500, Neapel, Catacombe di S. Gennaro.
Mosaikkunst. Szenen aus dem Leben Christi, Apostel und Evangelistensymbole, 451/500, Neapel, S. Gennaro, Baptisterium.
Die unter der Hauptapsis gelegene Krypta — »il Succorpo« — verdankt ihre Entstehung dem Wunsch des Kardinals Oliviero Carafa (1431-1511), den von ihm nach Neapel zurückgeholten Gebeinen des hl. Januarius eine würdige Ruhestätte zu schaffen.
S. Gennaro, Neapels ältester Schutzpatron und allzeit unentbehrlicher Nothelfer gegen Hungersnot, Krieg, Pestilenz, Erdbeben und Vesuv-Ausbrüche, lebte und wirkte um die Wende des 3. Jh. in Benevent; als Bischof der dortigen Christengemeinde soll er i. J. 305, während der Diokletianischen Christenverfolgung, in Pozzuoli umgekommen sein (s. S. 126, 446). Die Legende berichtet, man habe ihn zunächst ins Amphitheater geführt, um ihn dort wilden Tieren Zum Fraß vorzuwerfen; nachdem die Bestien sich weigerten, den hl. Mann anzurühren, sei er in der Solfatara enthauptet worden. Die sterblichen Überreste des Märtyrers wurden zwischen 413 und 431 nach Neapel überführt und in den nach ihm genannten Katakomben beigesetzt (s. S. 135). Während der vergeblichen Belagerung Neapels durch den Langobardenherzog Sika, 821, eigneten sich die Beneventaner den kostbaren Leichnam an; nachdem er 2 Jahrhunderte lang in Benevent geruht hatte, wurde er i. J. 1154 unter ungeklärten Begleitumständen nach der Abtei von Montevergine verbracht. 1480 entdeckte Oliviero Carafa, damals Kommendatarabt des Klosters, dort ein altes Tongefäß mit Knochenresten, die als Reliquien des hl. Januarius identifiziert wurden; 1497 erteilte Papst Alexander VI. die Genehmigung Zur Translation nach Neapel.
Ein 1503 verfaßtes Gedicht des Fra Bernardino Siciliano schildert die neue Grabkapelle im Bau und nennt als ihren Schöpfer den aus Como gebürtigen Tommaso Malvito (eigentlich Sumalvito), einen Schüler und Mitarbeiter des Francesco Laurana, der sonst allerdings nur als Bildhauer tätig war; bedenkt man die großen technischen Schwierigkeiten des Unternehmens, so möchte man glauben, daß Baupläne von der Hand eines erfahrenen Architekten seiner Arbeit zugrunde lagen. Kardinal Carafa, einer der großen Mäzene der Epoche (in seinem Auftrag erbaute Bramante i. J. 1500 den Kreuzgang von S. Maria della Pace in Rom), scheint das Werk mit Nachdruck gefördert zu haben. 1506 wurde die Reliquie deportiert, 1508 war der Bau in allen Teilen vollendet. Die unvermeidlichen barocken Veränderungen (neuer Marmoraltar, Seitenaltarbilder, Beichtstühle u. a.) gingen auf eine Stiftung König Karls III. von 1737 zurück; ein kunstbegeisterter Nachkomme des Gründers, Herzog Riccardo Carafa, veranlaßte 1887 die Wiederherstellung des originalen Zustandes. Die beiden halbkreisförmig ausschwingenden Treppenläufe, die heute vom Querschiff aus in die Krypta hinabführen, entstanden während des Chorumbaus von 1741; von den alten geradläufigen Treppen sind nur die untersten Stufen erhalten geblieben.
2 prächtige, mit Wappen und Wahlspruch des Kardinals geschmückte bronzene Gittertüren markieren die Nahtstelle zwischen Neu- und Altbau. Man betritt eine 3schiffige Säulenhalle, deren unerwartet zartes und zierliches marmornes Gliederwerk den Charakter des Unterirdischen durchaus
negiert; im Gegenteil scheint alles darauf angelegt, innerhalb relativ bescheidener Dimensionen (ca. 912 m) den Eindruck luftigster Weite hervorzurufen. So gleitet der Blick frei zwischen den schlanken Säulen und den Pilastern der Seitenwände hindurch bis in die Tiefe der großen, im Schatten liegenden Halbrundnischen, die sich wie in antiken Hypogäen an den Längsseiten des Raumes hinziehen. Im Innern jeder Nische, von Gesims und Muschelkalotte umschlossen, steht ein einfacher Marmoraltar (Tafel S. 128); das fein balancierte Widerspiel zwischen Hohlform und Kubus zeigt jenen neuartigen Sinn für »perspektivisch« aufgebaute Wandstrukturen, der den Übergang von der Früh- zur Hochrenaissance kennzeichnet. Der Arabeskenschmuck der Gewände und Pilasterstirnen ist von diszipliniertester Anmut. Etwas grobschlächtig wirken die Halbfiguren-Tondi der gleichfalls ganz in Marmor ausgeführten Decke (Maria, Evangelisten, Kirchenväter, Heilige); »die menschlichen Figuren, die hier ohnedies auf keine Weise den Ornamenten ebenbürtig sind, auch lastend an der Decke anzubringen, war«, wie Jacob Burckhardt meinte, »ein ganz speziell neapolitanischer Gedanke«.
An der O-Seite mündet das Mittelschiff in einen kleinen Kuppelraum mit Apsis und Bischofsthron; die Seitenschiffe enden in modern verglasten Fenstern, durch deren schräg in
die Chorfundamente eingeschnittene Gewände reichlich Licht einfällt. Gegenüber, zwischen den Eingangstreppen, liegt die Sakristei, ein beim Umbau der Treppen vollständig erneuerter Raum, in dem heute auf S. Gennaro bezügliche Gegenstände ausgestellt sind.
Der im vorletzten Joch des Mittelschiffs frei stehende Januarius-Altar, dessen modernistische Aufmachung einen empfindlichen Mißton in das sonst so harmonisch gestimmte Ambiente bringt, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Das oben erwähnte Gedicht des Fra Bernardino schildert ein höchst aufwendiges Projekt mit frei stehenden Engelsfiguren zu Häupten und zu Füßen eines von 4 Harpyien getragenen Sarkophages, »in mezzo (di) quel subcorpo hedificato«. Die Ausführung beschränkte sich dann auf einen einfachen Block mit Engelreliefs. 1737 wurde der Altar von D. A. Vaccaro mit einem prächtigen Marmoraufbau umgeben; es scheint, daß er bei dieser Gelegenheit von seinem urspr. Standort, der etwa dem heutigen entsprochen haben mag, in den Kuppelraum am östl. Ende des Schiffes versetzt wurde. 1887 wurde der Umbau Vaccaros entfernt und in der Basilika der hl. Restituta aufgestellt (s. S. 118); 1964 hat man sich entschlossen, auch den Malvito-Altar auseinanderzunehmen (einzelne Stücke davon sind jetzt in der Sakristei zu sehen) und die Urne mit den Gebeinen des Heiligen in einem Glaskasten zur Schau zu stellen.
Ähnlich erging es der schönen Statue des an seinem Betpult knienden Stifters. Von ihrem urspr. Aufstellungsort, der lt. Zeugnis des Fra Bernardino am Eingang des Mittelschiffs zwischen den Treppen lag, wanderte sie 1737 seitlich vor den Barockaltar. Der Restaurator von 1887 glaubte den originalen Zustand wiederherzustellen, indem er die Statue in die Apsis hinter den Altar versetzte; der Gedanke, den Kardinal so zwischen Betpult und Bischofsthron knien zu lassen, als ob er diesen »soeben« verlassen habe, scheint für den Geschmack der Epoche charakteristisch: Das Motiv der »Ewigen Anbetung« wurde als eine Art lebendes Bild verstanden. Neuerdings hat man die Figur — leider ohne den dazugehörigen Sockel — wiederum an den von Fra Bernardino geschilderten Platz transportiert, wo sie nun in bedenklichem Maße den frommen Berührungen der Gläubigen ausgesetzt ist, die den Renaissance-Kirchenfürsten für S. Gennaro zu halten scheinen; die erhoffte Verbesserung der Beleuchtungsverhältnisse wird durch das elektrische Licht zunichte gemacht, das die gleichgültige Rückseite grell hervorhebt, die Vorderansicht mit der großartigen Cäsarenphysiognomie des Kardinals jedoch in undurchdringliches Dunkel taucht.
Die Cappella S. Gennaro, auch Cappella del Tesoro oder kurz »il Tesoro« (der Schatz) genannt, bildet einen selbständigen Anbau am rechten Seitenschiff des Langhauses,
genau in der Achse der gegenüberliegenden S. Restituta. Sie enthält die kostbarsten Reliquien der Kathedrale, den vom Körper getrennten Schädel des hl. Januarius sowie 2 Ampullen mit seinem Blut, die, wie Wilhelm Rohlfs schreibt, »in der Geschichte Neapels eine größere Rolle gespielt haben als irgendein anderer Heiligenrest in irgendeiner anderen Stadt der Welt«.
Die Legende berichtet, ein von S. Gennaro sehend gemachter Blinder habe das Blut bei dessen Enthauptung aufgefangen; während der Überführung des Leichnams von Pozzuoli nach Neapel soll es sich wunderbarerweise in den Händen des Bischofs Severus verflüssigt haben. Der älteste uns erhaltene Bericht von einer Wiederholung dieses mirakulösen Vorgangs stammt aus d. J. 1389; seitdem erneuert das Wunder sich regelmäßig für je eine Woche nach dem 1. Sonntag im Mai und dem 19. September, ferner am 16. Dezember und dem darauffolgenden Tage; außerdem bei Gelegenheit hoher Besuche in der Schatzkapelle sowie, als tröstliches Omen, immer dann, wenn Naturkatastrophen die Stadt oder ihre Umgebung heimsuchen (zuletzt beim Erdbeben von Ariano Irpino am 22. August 1962). Die Versuche, dieses einzige sich periodisch wiederholende, kalendarisch voraussehbare Wunder der katholischen Welt naturwissenschaftlich (phototropisch, hydrotropisch‚ psychologisch) zu erklären, sind fast so alt wie die historische Überlieferung des Ereignisses selbst, haben indes niemals zu einem wirklich befriedigenden Resultat geführt; wir erwähnen hier nur den Hinweis des witzigen Abbé Galiani auf eine Stelle bei Horaz, der auf einer Reise nach Brindisi von Priestern in ein Geheimnis der antiken Chemie eingeweiht wird, wonach gewisse, geronnenem Blut ähnlich sehende Stoffe bei Berührung mit der menschlichen Hand in den flüssigen Zustand übergehen.
Der Entschluß zum Bau einer neuen Schatz-und Reliquienkapelle geht auf ein Gelübde d. J. 1527 zurück, durch das die Neapolitaner sich den Beistand ihres Heiligen gegen die große Pestepidemie von 1526-29 Zu sichern suchten. Doch verging nahezu ein Jahrhundert, bis man genügend Mittel beisammen hatte, um einen der Größe des städtischen Schutzpatrons angemessenen Bau in Angriff zu nehmen. Am 8. Juni 1608 wurde der Grundstein gelegt, 1615 war das Gebäude im wesentlichen vollendet; an der Ausstattung wurde noch lange Zeit gearbeitet. Architekt war der Theatinerpater Francesco Grimaldi.
In Anlehnung an die Kapelle Sixtus’ V. an S. Maria Maggiore in Rom, von D. Fontana, schuf Grimaldi einen in sich abgeschlossenen Zentralkuppelbau von beträchtlichen Dimensionen, mit tonnengewölbten Kreuzarmen und einem durch Abschrägung der Pfeilerinnenseiten ausgeweiteten Vierungsraum (Typus der St.-Peter-Vierung Bramantes).
Ein charakteristisches frühbarockes Stilelement liegt in der Betonung der tragenden Vertikalen durch plastisch hervortretende, mit eigenen Gebälkverkröpfungen versehene Eckpilaster, die in ebenso massiv ausgebildeten Gurtbögen ihre Fortsetzung finden; so bilden nicht mehr die 4 schrägen Innenflächen, sondern die 8 rechtwinklig einspringenden Kantenstücke der Vierungspfeiler die bestimmenden Elemente des Raumeindrucks. Die hohe und steile Kuppel empfängt durch einen doppelten Fensterkranz (im Tambour und im Ansatz der Kalotte) reichliches Licht. Die Doppelpilasterordnung des Tambours ist von Michelangelos Peterskuppel hergeleitet.
Das übrige Dekorationssystem, in etwa der von D. Fontana eingeschlagenen Richtung folgend, läßt Raum genug für eine malerische und plastische Ausstattung von wahrhaft festlichem Gepräge. Bei der Vergabe der Gewölbefresken ließ man nichts unversucht, sich eines großen Namens zu versichern. Nach vergeblichen Anträgen an Cavalier d’Arpino und Guido Reni einigte man sich zunächst (1623) auf Fabrizio Santafede; nachdem jedoch die ersten Arbeitsproben seiner Werkstatt nicht befriedigt hatten, wurde der Auftrag suspendiert und erst nach dem Tode des Künstlers (1630) wieder vergeben. Der neue Mann war der bolognesische Caracci-Schüler Domenico Zampieri, gen. Domenichino, der soeben mit seinem Freskenzyklus in 8. Andrea della Valle zu Rom höchsten Ruhm geerntet hatte. Domenichino, kein Schnellmaler vom Schlage der späteren Neapolitaner, arbeitete 10 Jahre für den »Tesoro«, unterbrochen von einer durch allerlei kollegiale Intrigen und Quertreibereien veranlaßten Flucht nach Frascati (1634/35). Als er 1641 starb, waren die Fresken der Kreuzarme und die der Kuppelzwickel sowie 5 der 6 Altargemälde vollendet, die Ausmalung der Kuppel selbst jedoch gerade erst begonnen worden. Dies bot dem als Nachfolger berufenen Giovanni Lanfranco, dem 2. großen Erben der Caracci-Tradition, die erhoffte Gelegenheit, über den Landsmann und Erzrivalen zu triumphieren. Um für sich selbst freie Hand zu erhalten, bestand er darauf, daß Domenichinos Anfänge aus der Kuppel wieder entfernt wurden; an ihre Stelle setzte er in knapp 2jähriger Arbeit sein »Paradiso«, ein von tieferen Gedanken unbeschwertes Bravourstück corregesker Illusionsmalerei, das die Zeitgenossen tatsächlich aufs stärkste beeindruckte und den wichtigsten neapolitan. Deckenmalern der 2. Jahrhunderthälfte (Preti, Giordano, Solimena) den Weg wies. Dem subtilen Hochrenaissance-Klassizismus der 4 großen Zwickelfresken Domenichinos konnten Wirkungen dieser Art nicht beschieden sein. Ungleich solider in Zeichnung und Maltechnik, mit präzisem Sinn für formale Nuancen begabt, läßt seine Kunst doch jenen spezifisch »barocken« Impuls vermissen, auf den
die Zeit aus war; die Bewegungen seiner Figuren, so mächtig sie ausholen, erstarren doch immer wieder zu vereinzelten Posen, die Mienen bleiben idealisch leer und teilnahmslos — man glaubt zu spüren, wie schwer es dem Künstler fiel, sich in das vom Thema geforderte Pathos hineinzusteigern. I. ü. bilden Domenichinos Fresken hochwichtige Dokumente für die Ikonographie der Gegenreformation: S. Gennaro wird von Christus im Himmel empfangen; im Verein mit Maria und anderen Heiligen leistet er Fürbitte für die Stadt, deren allgemeine Tugendhaftigkeit (Kardinaltugenden) und spezielle Verdienste (u. a. die Niederwerfung der häretischen Unholde »Luterus« und »Calvinus«, über dem Pfeiler rechts vom Eingang) allegorisch personifiziert werden. — Weitaus reicher und freier bewährt sich Domenichinos an Raffael geschulte Einbildungskraft in den Historienbildern, zumal in den 3 großen Halbrundfeldern der Kreuzarme: Der aus den Wolken herabschwebende S. Gennaro bringt die Lava des Vesuv-Ausbruches von 1631 zum Stehen (Eingangsseite); er befreit, in einer von wilder Dramatik erfüllten Schlachtenszene, Neapel von den Sarazenen (linker Querarm); er wird mit seinen Gefährten Festus und Desiderius zur Richtstätte geführt (rechter Querarm). Das große Tondo im Gewölbe des Chorarms schildert den Triumph des Heiligen über die Raubtiere im Amphitheater zu Pozzuoli; die Seitenfelder hier und in den anderen Kreuzarmen zeigen weitere Wunder- und Marterszenen aus seinem Leben.
Francesco Grimaldi, Capella di San Gennaro/ del Tesoro - Kuppeltambour, San Gennaro in Neapel.
Francesco Grimaldi, Capella di San Gennaro/ del Tesoro - Innenansicht zum rechten Altar, San Gennaro in Neapel.
Francesco Grimaldi, Capella di San Gennaro/ del Tesoro - Innenansicht, San Gennaro in Neapel.
Francesco Grimaldi, Capella di San Gennaro/ del Tesoro - Kuppelgewölbe mit Ausmalungen, San Gennaro in Neapel.
Francesco Grimaldi, Capella di San Gennaro/ del Tesoro - Kuppelwölbung mit Ausmalungen, San Gennaro in Neapel.
Im selben Themenkreis bewegen sich die teilweise auf Kupfer gemalten Altarbilder. 5 von ihnen stammen gleichfalls von Domenichino; das 6. und weitaus interessanteste jedoch (im rechten Querarm) ist ein Werk des Giuseppe Ribera. Es schildert, in effektvoller, auf den Standort des Beschauers kalkulierter Untersicht, wie der unverwundbare Heilige die zu Nola in einem Kalkofen vorgenommene Feuerprobe übersteht. Alle malerischen Mittel sind aufgeboten, den Vorgang zu verdeutlichen; der psychologische Kontrasteffekt — hier die wüsten Gestalten der Folterknechte, dort der aristokratisch kühle Bischof, der in himmlischer Seelenruhe aus dem ganzen Getriebe herausschaut — wird koloristisch dargestellt durch den Gegensatz von hellem Blau und rötlich brauner Düsternis in Himmel und Figurenszene.
Der Chorarm wird abgeteilt durch eine von Fanzago entworfene Brüstung mit Bronzegittern von Onofrio d’Alessio; davor 2 enorme silberne Kandelaber von Filippo Jodice nach Entwürfen von Bartolomeo Granucci. Der Hauptaltar stammt von Francesco Solimena (1706), das silberne Paliotto-Relief (Überführung der Januarius-Reliquie von Montevergine nach Neapel) wurde von Dom. Vinaccia nach einem Entwurf des Dom. Marinelli ausgeführt (1695). An der Wand dahinter befindet sich eine Nische, die mit zwei 1667 von Karl II. von Spanien gestifteten Türen verschlossen ist; sie enthält die in einen got. Tabernakel eingelassenen Blutampullen sowie eine Januarius-Büste aus vergoldetem Silber (1306
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Duomo S. Gennaro. Krypta, Altarnische (T. Malvito)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Duomo S. Gennaro. Reliquienkapelle, Kreuzreliquiar (12./15. Jh.)
im Auftrag Karls II. von Anjou von den französ. Hofgoldschmieden Etienne Godefroy, Guillaume de Verdelay und Milet d’Auxerre gefertigt), deren Haupt den Schädel des Heiligen umschließt.
Die große Bronzefigur des S. Gennaro in der Nische darüber ist ein Werk des Giuliano Finelli. Vom gleichen Künstler stammt die Mehrzahl der übrigen Bronzestatuen der Kapelle; von Fanzago der hl. Antonius von Padua und die hl. Therese (im linken bzw. rechten Querarm), von Vinaccia der hl. Franz Xaver (linker Querarm), von Marinelli der Filippo Neri (rechter Querarm), von Montani der hl. Asprenus, von Monterossi der hl. Athanasius (beide im Chorarm). Finelli schuf außerdem die beiden Marmorstandbilder des Petrus und Paulus in den Nischen der Eingangsfassade der Kapelle (im Seitenschiff des Domes), Fanzago das Bronzegitter des Eingangsportals mit der Büste S. Gennaros und eine Inschriftkartusche, deren erstaunlich fortgeschrittenen Ornamentstil man wohl als »Protorokoko« bezeichnen könnte (1668!). Schließlich lieferte Fanzago auch den Entwurf für den Marmorfußboden der Kapelle. Der plastische Schmuck wird noch vervollständigt durch silberne Büsten der 45 Schutzpatrone von Neapel (17.-19. Jh.), die im Mai und im September an den Wänden Aufstellung finden. — Die vom rechten Querarm aus zugängliche Sakristei enthält eine Enthauptung S. Gennaros von Domenichino, eine sehr schöne Besessenenheilung von Stanzione (1646) und Deckenfresken von Nic. Rossi, Farelli und Giordano.
Übrige Innenausstattung
Mittelschiff. Die prächtige Holzdecke, eine Stiftung des Kardinal-Erzbischofs Decio Carafa (1621), enthält 3 große Leinwandbilder: Verkündigung von Giovanni Vincenzo Forli; Darstellung im Tempel von Girolamo Imparato; Anbetung der Könige von Fabrizio Santafede. Zwischen den Obergadenfenstern eine Serie von Aposteln, Kirchenlehrern und Schutzheiligen der Stadt von Luca Giordano (1687). Beide Zyklen setzen sich im Querschiff fort: Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingstwunder, von Fabrizio Santafede; Erscheinungen Christi vor den Aposteln und vor Maria, von Girolamo Imparato. An den Hochwänden weitere Schutzpatrone; die hll. Anastasius und Damaszenus am rechten Ende stammen von Solimena. — An den Pfeilern die 1681 gestifteten Marmorbüsten der ersten 16 Bischöfe von Neapel. — Die Eingangswand über dem Hauptportal trägt einen riesigen, von D. Fontana entworfenen Marmoraufbau mit den Sitzfiguren Karls I. von Anjou, Karl Martells von Ungarn und seiner Gemahlin Clementia, der Tochter Rudolfs I. von Habsburg; das Werk wurde 1599 von dem Vizekönig Enriquez de Guzman gestiftet, um die Erinnerung an die im Laufe des 16. Jh. zerstörten originalen Grabmäler dieser Fürsten wachzuhalten. — Unter der 2. Arkade links steht das alte Taufbecken von 1618; den Unterteil
bildet eine mit Masken verzierte antike Schale aus ägyptischem Basalt. — Die Orgeln, in den letzten Arkaden links und rechts, stammen von Pompeo Franco (Mitte 17. Jh.) und Fra Giustino da Parma (16. Jh.); unterhalb der linken steht in einem spätgot. Altartabernakel der Bischofsthron (16. Jh.).
Linkes Seitenschiff. 2. Kapelle: Schöne Marmordekorationen des 16. Jh., am Altar ein Ungläubiger Thomas von Marco Pino (1573). — Es folgen 2 marmorne Wandgräber: links, Kardinal Alfonso Carafa, + 1565, von einem unbekannten Meister; rechts, Kardinal Alfonso Gesualdo, + 1603, von Michelangelo Naccherino, mit schöner Statue des hl. Andreas; dazwischen der Eingang zu S. Restituta. Es folgt die Cappella Brancacci, mit beachtlicher Architektur von Dosio (1598); über dem Eingang ein Verkündigungsrelief von Girolamo d’Auria, Statuen (Petrus und Paulus) von Pietro Bernini; am Altar Taufe Christi von Francesco Curia. — In der letzten Seitenkapelle ein großes Altarbild, Himmelfahrt Mariae, früher dem Perugino zugeschr., heute meist als Schulwerk angesprochen. Starke Übermalungen fast aller Partien des Bildes erlauben kein sicheres Urteil. Die untere Zone mit der Gruppe der Apostel vor einer umbrischen Hügellandschaft im Abendlicht ist reich an Schönheiten; in dem links im Vordergrund knienden, von S. Gennaro präsentierten Stifter glaubt man den Kardinal Oliviero Carafa wiederzuerkennen, von dem Vasari berichtet, er habe eine Himmelfahrt Mariae bei Perugino in Auftrag gegeben.
Rechtes Seitenschiff. 1. Kapelle: Altarbild (hl. Nikolaus) von Paolo de Matteis. — 2. Kapelle: Grabmäler der Familie Caracciolo aus dem 14. Jh.; am rechten eine »Justitia« von Tino di Camaino, wahrscheinl. ein Überbleibsel von dem zerstörten Grabmal der Mathilde von Hainault, das unmittelbar nach deren Tode (1331) bei Tino in Auftrag gegeben wurde. Am Altar schönes Kruzifix des 18. Jh. — Es folgt als 3. Kapelle die Cappella S. Gennaro, s. o. — Die 4. Kapelle (Cappella delle Reliquie) enthält, außer verschiedenen barocken Goldschmiedearbeiten, eine Staurothek (Kreuzreliquiar) aus vergoldetem Silber, wahrscheinl. eine sizilianisch-arabische Arbeit des 12. Jh. (Tafel S. 129). Die Vorderseite zeigt neben reichem Filigran- und Edelsteinschmuck 4 Medaillons mit den Büsten der Evangelisten mit griech. Namensinschriften; im Zentrum eine runde Scheibe mit dem Kreuzespartikel. Auf der Rückseite in ziemlich grober Treibarbeit das Lamm Gottes und die 4 Evangelistensymbole, offenbar Ergebnis einer späteren Restaurierung. Der spätgot. Kreuzesfuß mit den Figuren Mariae und Johannis und dem Carafa-Wappen dürfte erst um 1400 entstanden sein. — 5. Kapelle: Großes Baldachinwandgrab des Kardinals Francesco Carbone (+ 1405). Am Pfeiler neben dem linken Seitenschiffeingang schönes Kenotaph für Antonio Pignatelli, Erzbischof von Neapel und nachmals Papst Innozenz XII. (1691-1 700), von Domenico Guidi, 1703.
An der linken Schmalwand des Querschiffs 2 Grabmäler: Links Andreas von Ungarn, der 1345 auf Befehl seiner Gemahlin Johanna I. in Aversa umgebracht wurde; darüber 2 große Tafelbilder von Giorgio Vasari, urspr. Orgelflügel: Geburt Christi (im Vordergrund der Auftraggeber Kardinal Ranuccio Farnese nebst Gefolge) und Papst Paul III. (mit Bischofsmitra, ganz links) im Kreise der Schutzpatrone von Neapel. — Weiter rechts das Grabmal des in Neapel gestorbenen Papstes Innozenz IV. (Sinibaldo Fieschi aus Genua, 1243-54); die Grabinschrift berichtet von seinem Kampf gegen Kaiser Friedrich II., den »Feind Christi«. Den einzigen Überrest des urspr. Grabmonumentes bildet der Sarkophag, mit antikisierender Blendarchitektur und (im 16. Jh. ergänztem) Mosaikschmuck. An der Stirnseite ein Relief mit dem Schmerzensmann, rechts Reste einer gemalten Maria (?), beides etwa um 1400. Die Liegefigur des Papstes scheint zu Beginn des 16. Jh. dem mittelalterl. Original nachgebildet worden zu sein; aus der gleichen Zeit stammt die Inschrift, eine Kopie derjenigen des Erzbischofs Humbert d’Ormont (de Montauro, 1308-20), der das Grab im neuen Dom aufstellen ließ. Die schöne Lünettenmadonna wird dem Tommaso Malvito zugeschrieben.
Die 1. Nebenchorkapelle links (Cappella di S. Lorenzo), gestiftet von dem 1320 verstorbenen Erzbischof Humbert, trägt an der inneren Eingangswand ein gewaltiges Fresko aus dem Umkreis des Pietro Cavallini (vgl. S. Maria Donnaregina), um 1300, leider stark verdorben und mit Ölfarben übermalt. Dargestellt ist, vor ehemals blauem, jetzt schwärzlich verfärbtem Hintergrund, der Stammbaum Christi (»Wurzel Jesse«, nach Jesaias 11, 1): zuoberst in der Mandorla die machtvoll thronende Gestalt des Erlösers mit Buch und Segensgestus; unter ihm Maria als Orantin; darunter Joachim, dann Salomon mit den Insignien der Königswürde und der lautespielende David; zu Füßen des Ganzen liegt der träumende Abraham; auf den Zweigen des Baumes sitzen Propheten und Sibyllen mit Weissagungstexten. Ist der Glanz der Malerei auch weitgehend erloschen, so lassen doch die große und freie Komposition, die leidenschaftliche Bewegtheit vieler Einzelfiguren die Hand eines bedeutenden Meisters ahnen. — Am Pfeiler zwischen den Chorkapellen ein hübscher St. Georg von Francesco Solimena (1689). — 2. Nebenchorkapelle: Grabmäler des Fabio Galeota (+ 1668), von Cos. Fanzago, und des Giacomo Galeota, von Lorenzo Vaccaro (1677).
Hauptchorkapelle. Von Pietro Bracci, einem der Hauptmeister der röm. Skulptur des 18. Jh. (er schuf u. a. den Skulpturenschmuck der Fontana di Trevi), stammt die imposante Gruppe der von Engeln umgebenen Maria Assunta im Chorhaupt (1739).
Der Entwurf entstand in Verbindung mit dem Architekten des Chorumbaus Paolo Posi, der mit Bracci auch anderwärts zusammengearbeitet hat. Die Figur der Jungfrau wurde in Marmor ausgeführt, Engel und Wolken in Stuck. Nach dem Vorbild der
»Kathedra Petri« Berninis in der Peterskirche zu Rom ist das ganze überdimensionale Gebilde auf den Fernblick vom Eingang her berechnet; der bernineske Effekt des vom Kopf der Maria verdeckten Fensters, dessen Licht von den vergoldeten Strahlen der Glorie reflektiert wird, kann nur bei zugezogenen Seitenfenstern ausgekostet werden. Im Gewölbe ein Engelchor von Stefano Pozzi; von diesem auch das Bild der rechten Seitenwand (Befreiung Neapels von den Sarazenen durch die hll. Januarius und Agrippinus); links gegenüber die Übertragung der Reliquien der hll. Acutius und Eutikles von Pozzuoli nach Neapel, von Corrado Giaquinto; Chorgestühl von Marcantonio Ferraro (17. Jh.).
Rechts neben dem Hauptchor die Cappella Tocco; unter ihrem Altar die Grabstätte des hl. Asprenas (vgl. S. 64), an den Wänden Fresken mit Szenen aus dessen Leben, von Filippo Andreoli (1750); über dem Altar ein schönes Madonnenrelief von Diego de Siloe (1495-1563). — Rechts anschließend die reich geschmückte Cappella Minutolo. Die Wände tragen Fresken des 14. und 15. Jh., bis zur Unkenntlichkeit übermalt. Am Seitenaltar ein bemerkenswertes Triptychon des Sienesen Paolo di Giovanni Fei (Anfang 15. Jh.). Der Hauptaltar hat einen 1301 datierten Paliotto mit den stark byzantinisch anmutenden Figuren der Hohenpriester Aaron und Zacharias in Graffitto-Technik. Dahinter das monumentale Baldachingrab des 1412 verschiedenen Bischofs Arrigo Minutolo, noch zu dessen Lebzeiten (1402-05) von röm. Marmorari aus der Werkstatt des Abbate Baboccio gefertigt.
Capella Minutolo. Gesamtansicht, 1310, Neapel, S. Gennaro.
Grabmal des Kardinals Arrigo Minutolo (fest. 1412). Gesamtansicht, 1412, Neapel, Capella Minutolo in S. Gennaro.
Zur Linken das Grab des Orso Minutolo, + 1327, aus dem Umkreis des Tino di Camaino. Rechts der auf gedrehten Säulen stehende, mit cosmatesken Mosaiken gezierte Sarkophag des Filippo Minutolo, dessen Beisetzung i. J. 1301 den Hintergrund der 5. Novelle des 2. Tages des Decamerone bildet; viell. von einem Schüler des Arnolfo di Cambio (bedeutsam als Zeugnis der neapolitan.
Grabmalskunst kurz vor dem Erscheinen Tinos). Aus der gleichen Zeit stammt das außerordentlich schöne Marmormosaik des Fußbodens mit Ornamenten und heraldischen Tieren. Vor dem Kapelleneingang ein weiteres Grabmal, G. B. Capece-Minutolo, von Girolamo d’Auria.
Die 2. Kapelle der rechten Schmalwand des Querschiffs enthält eine Annunziata von Nic. M. Rossi (1. Hälfte 18. Jh.); an den Wänden abgenommene Freskenfragmente des 15. Jh. — In der anschließenden, an das Langhaus angrenzenden Kapelle eine schöne Maria Magdalena von Nic. Vaccaro; am Pfeiler zur Rechten das Grabmal des Erzbischofs Antonino Sersale (+ 1755), von Giuseppe Sammartino.
Die südlich am Dom entlangführende Via dei Tribunali öffnet sich nach wenigen Schritten in die Piazzetta Sisto Riario Sforza. Sie ermöglicht einen Blick auf die Außenfront des S-Querschiffs, die von 2 polygonalen Eck-
türmen eingefaßt wird (vgl. dazu den Chorbau von S. Chiara); zwischen ihnen spannt sich ein runder Blendbogen über die ganze Fassadenfläche; ein massives Kranzgesims auf Konsolen und Bögen bildet den oberen Abschluß.
Im Zentrum des Plätzchens erhebt sich die Guglia di S. Gennaro (Tafel S. 144), ein Ehrenmal für den Stadtheiligen, dem es am 16. Dezember 1631 gelungen war, Neapel vor den Aschen- und Lavamassen eines katastrophalen Vesuv-Ausbruchs zu schützen. Der mit der Planung beauftragte Cosimo Fanzago schuf hier die Inkunabel einer spezifisch neapolitan. Gattung, die den Zeitgenossen zum Inbegriff künstlerischer »meraviglie« wurde. Ihr Grundgedanke, aus antiker Überlieferung sich herleitend, ist das Säulenmonument (das Wort »guglia«, eigentlich »aguglia«, bezeichnet im Italienischen Fialen, Obelisken, Pyramiden und alle möglichen anderen spitzig aufragenden Gebilde); die Form, die es unter den Händen Fanzagos und seiner Nachfolger annahm, erinnert an Festdekorationen aus vergänglichem Material, wie man sie damals bei jeder Gelegenheit aufzurichten liebte. Die Ausführung des Denkmals zog sich bis 1670 hin. Fanzagos erster Entwurf (1637) rechnete mit einer kolossalen antiken Säule aus grünlichem Cipollino-Marmor, die man in der Nähe des Domes gefunden hatte; allein nach einem Streit zwischen dem Kardinal-Erzbischof Filomarino und der Bürgerschaft, in dessen Verlauf die Eminenz auf der Piazza del Nilo von Don Peppo Carafa einen Fußtritt erhielt, zog der Bischof es vor, seine Säule den Theatinern zu schenken. Fanzago ersetzte sie durch einen in 4 langgezogene Voluten verpackten Säulenstumpf, der mit seinem ionischen Kapitell und einem daraufgesetzten Gebälkstück wie eine groteske Mißbildung anmutet. Gleichsam als Signatur Fanzagos erscheinen an der Basis des Monumentes große marmorne Blütenknäufe (»rosoni«); überdies hat der Künstler in einem Bildnismedaillon sich selbst als modisch gekleideten Kavalier (»Eques Cosmus Fansagus«) verewigt. Das Piedestal trägt eine Kartusche mit Widmungsinschrift an den Heiligen; der rokokohaft asymmetrische Rahmen läuft in die Halbfigur der Sirene Parthenope aus; gegenüber das Wappen der Stadt mit der Büste des Schutzpatrons. Die zuoberst stehende Bronzefigur des segnenden S. Gennaro stammt von Giuliano Finelli; zu ihren Füßen 4 Engelchen, die mit den bischöflichen Insignien spielen.
Cosimo Fanzago, Gesamtansicht Guglia di S. Gennaro, 1637/1670, Neapel, Piazza Riario Sforza.
Cosimo Fanzago, Entwurf zu der Guglia di S. Gennaro, 1637/1670, Neapel, Piazza Riario Sforza.
Cosimo Fanzago, Inschrift der Guglia di S. Gennaro, 1637/1670, Neapel, Piazza Riario Sforza.
Cosimo Fanzago, Guglia di S. Gennaro, Fliegende Engel, 1637/1670, Neapel, Piazza Riario Sforza.
Vor der N-Flanke des Domes liegt der zu Anfang des 15. Jh. neu errichtete, später vielfach veränderte Palazzo Arcivescovile. Aus der ersten Bauzeit stammen große Teile der langgestreckten Fassade am Largo Donnaregina (Nr. 22/23) mit Quaderverkleidung und einem durazzesken Eingangsportal.
Das Innere enthält Dekorationen aus der Zeit des Erzbischofs Ascanio Filomarino (1642). In einem der Säle des 1. Stockwerks hängt ein vorzüglich erhaltenes Tafelbild des Trecento, darstellend den 1320 verstorbenen Erzbischof Humbert d’Ormont und im Giebelfeld darüber den hl. Paulus, beide frontal als Halbfiguren. Die Sicherheit in der Darstellung der Volumen und die klare und kräftige, dabei sehr nuancenreiche Modellierung lassen an einen Meister ersten Ranges denken, doch hat keine der bisher versuchten Zuschreibungen (Cavallini, Simone Martini) sich überzeugend begründen lassen. — Auf dem gleichen Stockwerk befindet sich die im 19. Jh. eingerichtete erzbischöfliche Privatkapelle. In die Längswände des Raumes ist der berühmte Marmorkalender aus S. Giovanni Maggiore eingelassen: 2 lange Marmortafeln, die in von reliefierten Säulchen getrennten Schriftkolonnen den ältesten auf uns gekommenen Heiligen- und Festkalender der Kirche tragen. Die Zusammenstellung der Namen und Daten scheint auf das 8. Jh. zurückzugehen; die Ausführung der Schrift wird in die Zeit des Bischofs Tiberius (821-841) datiert. Für die historische Stellung Neapels zwischen Byzanz und Rom ist es bezeichnend, daß über die Hälfte der angeführten Märtyrer dem Bereich der Ostkirche angehört; erst ganz wenige Namen stammen aus dem Frankenreich. An der Schmalwand die jetzt abgetrennten Rückseiten der Tafeln; sie enthalten palmettengerahmte Friese mit Ranken und gegenständigen Tierpaaren (geflügelte Löwen, Greife, Pferde), hervorragende Arbeiten aus dem späten 11. oder dem 12. Jh.
S. Gennaro extra moenia (S. Gennaro dei Poveri; im Valle della Sanità zu Füßen der Anhöhe von Capodimonte)
Neapels erstes Januarius-Heiligtum und zugleich eine der ältesten Kirchen der Stadt. Die Besichtigung der Basilika ist nur um den Preis der Durchquerung zweier von Elendsgestalten aller Art bevölkerten Hospitalhöfe zu haben, deren Anblick selbst erfahrene Neapel-Besucher in Schrecken zu setzen vermag.
Die gleichnamige Straße, westl. unterhalb des Corso Amadeo di Savoia, führt auf die barocke Fassade des Ospizio di S. Gennaro, 1667 errichtet und mit Statuen der hll. Petrus und Paulus, des spanischen Königs Karl II. und des Vizekönigs Pedro von Aragon, von Bartolomeo Mori, geschmückt.
Die Gründung des Hospitals (1468) geht auf den Erzbischof Oliviero Carafa zurück; nach der großen Pest von 1656 wurde auf Initiative des genannten Vizekönigs der jetzt stehende Bau errichtet und mit Mitteln zur Kranken- und Armenpflege ausgestattet;
die Satzung sah u. a. eine Art Aufsichtsamt für den städtischen Straßenbettel vor, der den Angehörigen dieses Berufsstandes — 1667 waren es 800 — ihre Bezirke zuwies.
Die Entstehung der Basilika läßt sich mit dem Namen des Bischofs Johannes I. (+ 432) verknüpfen, der die Reliquien des hl. Januarius auffand und sie mit eigener Hand ins Valle della Sanità trug, wo sie im Kreise anderer Märtyrergräber beigesetzt wurden. Zur Erbitterung der Beneventaner, als deren Bischof Januarius den Martertod erlitten hatte, erwiesen sich seine Überreste als überaus wundertätig und wurden alsbald zum Palladium Neapels und seines Episkopats. Auch ihre gewaltsame Entführung nach Benevent i. J. 821 (vgl. S. 123) konnte daran nichts ändern; Bischof Athanasius I. (849-872) verbrachte den angebl. geretteten Schädel des Heiligen in die Kathedrale, ließ aber zugleich das »extra moenia« (vor den Mauern) gelegene Heiligtum restaurieren und gründete dazu ein Benediktinerkloster. Im 15. Jh. wurde die Kirche noch einmal umgestaltet, im 17. Jh. neu ausgestattet und im 19. Jh. durchgreifend restauriert.
Eine 1927 eingeleitete Freilegungs- und Ausgrabungskampagne führte zu einem einigermaßen klaren Bild von der Zusammensetzung des Baus. Anstelle des im 19. Jh. entstandenen Eingangstraktes muß man sich eine einfache Fassadenwand mit 3 Portalen denken; wahrscheinlich, aber nicht sicher nachgewiesen, ist die Existenz eines offenen Atriums. Die Pfeilerarkaden des Langhauses und die mit ihnen im Verband stehenden Kreuzgewölbe der Seitenschiffe entstammen dem Umbau des 15. Jh. Das gleiche gilt für die merkwürdigerweise nicht axial sitzenden Spitzbogenfenster des Obergadens; sie waren im 19. Jh. durch große, über den Scheiteln der Arkaden sitzende Rundbogenfenster ersetzt worden und konnten nun aus dem Befund des Mauerwerks wiederhergestellt werden. Die Außenwände der Seitenschiffe mit ihren kleinen Rundbogenfenstern gehören der Erneuerung des 9. Jh. an. Das Langhaus des Gründungsbaus aus dem 5. Jh. entsprach in seinem Grundriß dem heutigen; anstelle der Pfeiler standen antike Spoliensäulen, die ebenfalls durch Rundbogenarkaden verbunden waren. Vom aufgehenden Mauerwerk dieser Teile hat sich nichts erhalten, doch läßt der gesicherte Bestand sich leicht zu einer 3schiffigen holzgedeckten Basilika ergänzen. Die Langhauswände waren freskiert; bei den Grabungen von 1927 fand sich ein herabgestürztes Stück der alten Obermauer mit 3 großen tunikabekleideten Heiligenfiguren im Stil des 5. Jh. (jetzt zu sehen unter einem Glasgehäuse im rechten Seitenschiff). Un-
angetastet ist die Apsis des Urbaus auf uns gekommen. Ihr Grundriß ist leicht hufeisenförmig; der etwas einspringende Schildbogen wird von 2 in die Apsisöffnung eingestellten korinthischen Spoliensäulen getragen; die zwischen Kapitell und Bogenanfang liegenden Kämpferplatten scheinen im 5. Jh. gearbeitet zu sein (vgl. die ähnliche Lösung in der Apsis von S. Restituta, s. S. 113). In den Flanken der Apsis öffneten sich 2 rundbogige Durchgänge, deren Innenseiten ebenfalls von in die Wand gestellten Säulen eingefaßt waren. Auch die Seitenschiffe enden in großen Rundbogenöffnungen, die offenbar der Verbindung zu den angrenzenden Katakomben dienten.
Seiner Entstehungsgeschichte und Lage nach stellt der Urbau von S. Gennaro das klassische Beispiel einer frühchristl. Coemeterialkirche dar, d. h. er bildet das Kultzentrum eines Gräberbezirks, der vom 2. bis zum 10. Jh. in Gebrauch war und in dem Märtyrer, Bischöfe und auch Herzöge von Neapel ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Es handelt sich um die größte Katakombe der Stadt; sie ist erst teilweise erforscht, und die topographisch-chronologischen Zusammenhänge des sehr ausgedehnten Komplexes sind derzeit noch nicht übersehbar. Die Eingänge befinden sich gegenüber der O-Wand der Basilika; der Kustode der Kirche läßt sich dazu überreden, Besucher durch einen Teil der Räume zu führen, doch muß man selber mit Lampen versehen sein. Die sichtbaren Freskenfragmente sind sehr unterschiedlich erhalten und vielfach von Staub- und Kalksinterschichten zugedeckt; bemerkenswert sind: die weißgrundigen Groteskendekorationen an der Decke eines heidnischen Kubikulums aus dem 2. Jh.; eine Lünette mit den impressionistisch schwungvoll gemalten Figürchen von Adam und Eva am Baum der Erkenntnis (3. Jh.); ein Arkosolium des 4. Jh., dekoriert mit Pfauen und Gartenmotiven; aus der gleichen Zeit ein Schafhirte mit einem Hakenkreuz-geschmückten Gewand, an der Rückwand eines Kubikulums, und verschiedene alttestamentliche Szenen (Jonas in der Kürbislaube, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen); aus dem 5. Jh. zahlreiche Porträtbüsten und Figuren von Verstorbenen in Orantenhaltung, Büsten von Petrus und Paulus und das inschriftlich bezeichnete älteste Bild des hl. Januarius: Der jugendliche, mit Tunika und Pallium bekleidete Heilige steht als Orant zwischen 2 Frauen, flankiert von Leuchtern mit brennenden Kerzen; sein großer Nimbus enthält die sonst nur dem Erlöser zukommenden Zeichen A, Q und das Monogramm Christi; aus dem 6. Jh. der Rest eines Kruzifixus; aus dem 8. bis 10. Jh. Heiligen- und Christus-Bilder.
Katakomben di San Gennaro, Vestibolo Inferiore, ab 201, San Gennaro in Neapel.
Katakomben di San Gennaro, Nordwand, ab 201, San Gennaro in Neapel.
Katakomben di San Gennaro, Arcosolium mit dem Portät des Verstorbenen in Mosaik, 401/500, San Gennaro in Neapel.
Gesù e Maria (Via Gesù e Maria, zwischen Via Salvator Rosa und Montesanto) ist die Kirche des gleichnamigen Hospitals. 1585 gegr., soll der Bau seit 1593 unter Leitung Domenico Fontanas gestanden haben. Da
Portal stammt von Francesco Vannelli (1616/17), die Freitreppe von Donato Vannelli (1637-46). Die Kuppel wurde 1664 von Pietro de Morino umgebaut. — Das seit dem 2. Weltkrieg unzugängliche Innere enthält Bilder von Criscuolo, Lama, Azzolino, de Maio, Sarnelli u. a., sowie Marmordekorationen von Giuseppe Gallo (Ende 17. Jh.).
Gesù delle Monache (auch S. Giovanni in Porta; Via Porta S. Gennaro / Piazza Cavour)
Die Vorgeschichte der heutigen Kirche läßt sich bis zum Anfang des 16. Jh. zurückverfolgen. Lucrezia Capece und Antonia Monforte gründeten hier 1511 ein Klarissenkloster, dessen Bau jedoch trotz des Interesses der königlichen Familie — Johanna III., Gemahlin Ferrantes I. von Aragon und Schwester Ferdinands d. Katholischen, wollte hier begraben sein — nicht vorankam; erst 1582 wurde das heute stehende Kirchengebäude begonnen. Etwa ein Jahrhundert später unterzog Arcangelo Guglielmelli das Innere einer durchgreifenden Restaurierung und fügte die Eingangsfassade hinzu.
In bescheideneren Verhältnissen wiederholt die Eingangsfassade das Motiv der Vorhalle mit inneren Eingangstreppen, mit dem Guglielmelli, auf den Spuren Fanzagos, an S. Giuseppe dei Ruffo brilliert hatte. Die Beschränkung auf einen zentralen Treppenlauf führte zu ungewöhnlich steiler Proportionierung des Mittelbogens, woraus sich für die Gliederung der Fassade im ganzen ein nicht sehr glücklich wirkendes Drei-Ordnungs-System ergab. Heiligenstatuen schauen aus Nischen herab, zuoberst die Immaculata; Voluten und Zierobelisken flankieren das Giebelfeld.
Im Inneren finden wir einen Rechtecksaal von schlanken Verhältnissen, mit Seitenkapellen und einem Fenstergeschoß, zusammengehalten von korinthischen Pilastern auf Piedestalen. Über dem verkröpften Gebälk eine schöne hölzerne Kassettendecke; der kurze Chorarm ist von einer Querovalkuppel mit übergroßer Laterne bedeckt, durch die eine bedeutende Lichtmenge einfällt (eine ähnliche Lösung in Rom, S. Pudenziana, 1595 von Francesco da Volterra).
Hochaltar: Beschneidung von. Cesare Turco (zugeschr.); 2. Kapelle links: Madonna mit Heiligen von Luca Giordano, flankiert von 2 prächtigen Solimenas: Verkündigung und Vermählung Mariae; 2. Kapelle rechts: Triumph der hl. Klara, gleichfalls von Solimena; hübscher Majolikaboden.
Gesù Nuovo (Trinità Maggiore; an der gleichnamigen Piazza am »Spaccanapoli«, gegenüber von S. Chiara)
Die große Jesuitenkirche von Neapel. Urspr. der Unbefleckten Empfängnis Mariae geweiht, ging sie nach der Vertreibung der Jesuiten aus Neapel (1767) an die Franziskaner über und trug von da an den Dreifaltigkeitstitel.
An die ältere Benennung erinnert eine kolossale Mariensäule, die Guglia dell’Immacolata, die den Vorplatz der Kirche beherrscht. An ihrer Stelle stand vordem ein bronzenes Reiterbild des spanischen Königs Philipp V. von Lorenzo Vaccaro; 1705 mit großem Gepränge eingeweiht, wurde es 2 Jahre später, während der Be-
setzung Neapels durch die Österreicher unter Marschall Daun, vom Volk zerstört. Den Entschluß zur Errichtung der Guglia faßte 1746 der populäre Jesuitenprediger Francesco Pepe. An einem Wettbewerb unter dem Protektorat König Karls III. beteiligten sich Gioffredo, Astarita u. a. namhafte Künstler; den Sieg trug der sonst unbekannte Giuseppe Genuino davon, der den Einfall gehabt hatte, die Basis seines Modells mit den (später nicht ausgeführten) Figuren des Monarchen und seiner Familie zu schmücken. 1741 legte man den Grundstein des 34 m hohen Monuments; 1750 wurde die Mondsichel-Madonna aus vergoldetem Kupfer auf die Spitze gesetzt. — Die Grundform der bizarren »macchina« ist ein mit 4 Ecksporen besetzter Rundkörper, der sich stufenweise nach oben verjüngt und am Ende unter dem wuchernden Voluten-, Kartuschen-und Rankenwerk fast verschwindet. Auch der figürliche Schmuck tritt in seiner Wirkung zurück hinter dem ornamentalen Gesamteffekt — ein posthumer Triumph des großen Fanzago, der 100 Jahre zuvor als erster diesen Weg beschritten hatte und in dessen Œuvre sich übrigens auch alle hier auftretenden Ornamentmotive vorgebildet finden. Allerdings wäre ein Stilvergleich zwischen seiner Guglia (s. S. 133) und der des Settecento-Meisters lehrreich: er würde erst erweisen, um wieviel leichter, freier, aber auch äußerlich-dekorativer sich hier die Formen entfalten, wogegen Fanzagos Werk, preziös und gravitätisch, bei aller Spielfreude doch vom Ernst des Hochbarock durchdrungen scheint. Das Darstellungsprogramm der Skulpturen, von Francesco Pagano und Matteo Bottiglieri, verbindet die Verherrlichung Mariae (Reliefs mit Mariengeburt, Verkündigung, Reinigung bzw. Darstellung im Tempel und Krönung) mit der des Jesuitenordens (Statuen der hll. Ignatius, Francesco Borgia, Franz Xaver, Giovanni Francesco Regis; Bildnismedaillons der hll. Luigi Gonzaga und Stanislaus Kostka).
Die gewaltige Quaderfassade der Kirche, die der sarkastische Aufklärer und Jesuitenfeind Milizia mit einer Gefängnismauer verglich, ist über ein Jahrhundert älter als der dahinterliegende Innenraum; sie gehörte urspr. dem 1455-70 errichteten Palazzo Sanseverino, von dem sich auch die innere Rahmung des Hauptportals mit ihrem Wappenschmuck erhalten hat. Der Architekt dieses von den Zeitgenossen als »magnifica domus« und »triumfale palatium« gerühmten Bauwerkes war, lt. Inschrift am linken Fassadenende, Novello da Sanlucano. Die »Diamantquaderung« dürfte von gewissen kurz vorher entstandenen Sockelpartien des Castel Nuovo angeregt sein, wäre also letzten Endes wohl auf katalanische Einflüsse zurückzuführen (s. S. 334 — die bekannten Diamantquaderpaläste in Fer-
rara und Bologna sind später entstanden); ähnliches Quaderwerk zeigte das Untergeschoß des heute verschwundenen Palazzo Sicola, von unklarer Datierung.
In der 1. Hälfte des 16. Jh. spielte der Palast als Sitz des Ferrante Sanseverino, Fürsten von Salerno, eine glanzvolle Rolle im humanistischen Leben der Stadt. 1535 besuchte ihn der aus Tunis zurückgekehrte Kaiser Karl V., zu dessen Ehren Ferrante im Festsaal Theateraufführungen veranstaltete. Später ging das Gebäude durch verschiedene Hände, bis es 1584 von den Jesuiten erworben und zum Abbruch bestimmt wurde.
Am 15. Dezember 1584 fand im Hof des Palastes die Grundsteinlegung der Kirche statt. Den Bauplan entwarf der Maler und Architekt Giuseppe Valeriani (1542-95), Mitglied der Societas Jesu und Schlüsselfigur für die Entstehung einer spezifischen Jesuitenarchitektur (sein Name wird mit dem Collegio Romano bei S. Ignazio in Rom, mit der Genueser Jesuitenkirche SS. Ambrogio e Andrea und neuerdings auch mit der komplizierten Baugeschichte von St. Michael in München in Verbindung gebracht). 1601 war der Rohbau vollendet. 1639 wurden Teile des Innern durch Feuer zerstört; Cos. Fanzago entwarf eine neue Innenausstattung, deren Ausführung sich bis ins 18. Jh. hinzog. Nachdem beim Erdbeben von 1688 die Hauptkuppel eingestürzt war, dauerte es kein halbes Jahr, bis eine neue Kuppel von Arcangelo Guglielmelli erbaut, von Paolo de Matteis fertig ausgemalt war; allein zur Freude der neapolitan. Künstlerschaft zeigte die Arbeit der beiden geschwinden Kollegen alsbald erhebliche technische Mängel: In den tragenden Pfeilern taten sich Risse auf, und 1769 war man genötigt, eine Expertenkommission um Vorschläge für die Sicherung des Gebäudes zu bitten. Ferdinando Fuga verfiel auf den Ausweg, das erste und letzte Arkadenpaar des Mittelschiffes durch Unterzüge zu versteifen. Gleichwohl mußte 4 Jahre später Guglielmellis Kuppel abgetragen und durch die heute bestehende leichte Holz- und Rohrkonstruktion ersetzt werden.
Das Grundrißbild des Innenraums ist nicht leicht aufzufassen. Den Kern bildet ein zentraler Pfeiler-und Kuppelbau vom Typus der Peterskirche oder der Madonna di Carignano in Genua (Mittelkuppel über der Vierung, tonnengewölbte Kreuzarme, Nebenkuppeln über den 4 Eckräumen). Doch greift das Längsschiff nach Eingangs- und Chorseite hin um je 1 Joch weiter aus als die Querarme; man müßte also im Sinne der herkömmlichen Terminologie von einem griech. Kreuz mit ungleichen Armen sprechen: Ein 5 Joche tiefes, 3schiffiges Langhaus wird von einem gleichfalls 3schiffigen, aber nur 3 Joche langen Querhaus durchkreuzt. Im heutigen Raumbild des Längsschiffes frei-
lich tritt dieses Schema kaum noch in Erscheinung: Das 1. Arkadenpaar wurde auf Anweisung Fugas in seiner Bogenöffnung stark reduziert, das vorletzte durch eingezogene Orgeltribünen ausgefüllt, das letzte wiederum verengt und durch flache Apsidiolen geschlossen. Aber auch im Bereich der Seitenschiffe ist der Typus nicht rein durchgeführt; die Abseiten des Eingangsjochs sind mit Flachkuppeln überwölbt und setzen sich damit gegen die Pendentifkuppel der zentralen Raumgruppe ab; diejenigen des Chorteils tragen Längstonnen und sind so überhaupt nicht mehr als Seiten-
schiffjoche, sondern als Nebenchöre charakterisiert. — Unverkennbar bleibt in alldem das Bemühen, den höchsten Sakralbaugedanken des 16. Jh., die zentrale Kreuzkuppelkirche mit frei stehenden Binnenpfeilern, in den Jesuitenbarock herüberzuretten (die gleiche Tendenz zeigt Valerianis schon genannte, unter dem unmittelbaren Eindruck von Alessis Carignano-Madonna entworfene genuesische Jesuitenkirche). Allein die Zukunft gehörte nicht der harmonisch geordneten Vielfalt der Renaissance, sondern dem längsgerichteten Einheitsraum, wie ihn Vignola in Rom konzipiert hatte (Il Gesù). So sind es auch in unserem Bau die 4 großen, hell erleuchteten Rechtecksäle der Kreuzarme, die den Eindruck bestimmen; die im Halbdunkel liegenden Nebenzentren wirken demgegenüber als bloße Annexe, denen keine räumliche Eigenbedeutung mehr zukommt.
Ausstattung. Die Innenseite der Eingangswand trägt eines der berühmtesten Fresken Neapels, die Vertreibung des Heliodor von Solimena (1725). Die Geschichte steht im 2. Buch der Makkabäer, Kap. 3: Heliodor, der Kanzler des syrischen Königs Seleukos IV. (187-175 v. Chr.), hat den Tempelschatz von Jerusalem konfisziert und ist dabei, ihn abtransportieren zu lassen, als 3 Engel des Herrn erscheinen, einer beritten und 2 zu Fuß, die den Eindringling überwältigen und fast zu Tode bringen; erst die Gebete des frommen und weisen Hohenpriesters Onias stellen ihn am Ende so weit her, daß er zu seinem König zurückkehren und die Macht Jehovas bezeugen kann. Die großen Motive der Erzählung — die einherstürmenden Engel, der halb aufgerichtet am Boden liegende Heliodor, rechts im Hintergrund der im Gebet versunkene Priester — waren durch Raffael geprägt, und Solimena sah keinen Anlaß, den Spuren des großen Vorgängers auszuweichen; Architekturbühne und vielfigurige Inszenierung gehen auf die Vertreibung der Wechsler zurück, die Luca Giordano 40 Jahre früher auf die Eingangswand von S. Filippo Neri gemalt hatte. Die dort noch herrschende Symmetrie ist hier aufgegeben, der Fluchtpunkt der Perspektivkonstruktion aus der Mitte an den linken Bildrand gewandert. Auch in Figurenstil und Komposition wird Bewegung an sich zum Hauptthema der Darstellung, löst das Drama sich auf in eine unruhig hin und her wogende Massenszene. Nur im Vordergrund, wie im Wechslerfresko, einige Randfiguren in stillebenhafter Gruppierung, freilich ohne Giordanos natürliche Lebensfülle. Dafür bieten die Hauptakteure, v. a. die Engel, einen ungetrübten Genuß. Bewundernswert die virtuose Handhabung der Beleuchtungseffekte: das Licht aus rauchiger Atmosphäre hervorflackernd, die Schatten farbig und in alldem noch die gelungenste Luft- und Farbperspektive, welche die riesige Bildfläche
räumlich zusammenhält (besonders eindrucksvoll im Fernblick vom Hochaltar der Kirche her).
Buntheit und Kleinteiligkeit der Marmorinkrustation, die Wände und Decken des Raumes gleichmäßig überspannt, lassen nicht auf Anhieb erkennen, daß auch an der übrigen Freskoausstattung bedeutende Maler tätig waren. Das berühmteste der Deckenbilder sank 1688 mit der Hauptkuppel in Trümmer: Lanfrancos »Paradiso«, ein Himmels- und Allerheiligenbild nach dem Vorbild Correggios im Dom zu Parma, 1635/36 entstanden; übriggeblieben sind nur die Zwickelfelder zwischen den Vierungsbögen: 4 kraftgeladene, heftig bewegte Evangelistenfiguren — Lukas die Madonna malend, die anderen auf die verschiedenste Weise mit ihren Texten beschäftigt, unter lebhafter Anteilnahme von Engeln und anderem himmlischen Personal. — Unter den Bildern der Tonnengewölbe ragen die des Chorarms hervor, ein Marienzyklus von Stanzione, ausgeführt 1639/40. In den übrigen Schiffen stammen die Mittelbilder im Scheitel der Wölbung von P. de Matteis, der Rest von Corenzio. Das Gewölbe des linken Nebenchors enthält Fresken (Engel und Putten) des 18jährigen Solimena, leider bald nach ihrer Fertigstellung beschädigt und von Lodovico Mazzante stark übergangen.
Francesco Solimena, Ausmalung der Innenfassade - Die Vertreibung des Heliodor aus dem Tempel, 1725, Gesù Nuovo in Neapel.
Das bedeutendste Altargemälde der Kirche befindet sich in der 2. Seitenkapelle rechts: eine Heimsuchung Marine von M. Stanzione aus den letzten Lebensjahren des 1656 gestorbenen Meisters, posthum von Schülerhand vollendet; die großflächig zusammengefaßte Komposition ganz auf die Leuchtkraft jenes einfachen Rot-Blau-Akkordes abgestellt, dem der Maler sein Leben lang treu blieb (relativ günstiges Licht in den Abendstunden). — Gegend über, in der 2. Kapelle links, Geburt Christi, eines der Hauptwerke des neapolitan. Manieristen Girolamo Imparato, flankiert von 2 Marmorfiguren: links der hl. Andreas von Michelangelo Naccherino, dat. 1601, rechts Matthäus mit dem Engel, von P. Bernini; die oberen 4 Figuren, Johannes d. T., Johannes (1. Ev., Gennaro und Niccolò, von Tommaso Montani.
Die Stirnwände der Querschiffe sind mit monumentalen, von Cosimo Fanzago entworfenen Wandaltären ausgefüllt. Der linke ist dem Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, geweiht (1688 durch Erdbeben, 1943 durch Bomben zerst. und jedesmal sorgfältig wiederhergestellt). Von Fanzago auch die beiden manieriert-virtuosen Statuen des David und des Jeremias. Das heutige Mittelbild des Altars — Ignatius und Franz Xaver in Verehrung der von Engeln bewachten Madonna — ist eines der besten Werke des oftmals so liederlichen Paolo de Matteis. Von den 3 Riberas, die die oberen Felder füllten, konnte nur der rechte gerettet und restauriert werden: die Bestätigung der jesuitischen Ordensregel durch Papst Paul III. Der Hauptaltar des rechten Querschiffs, architektonisch eine getreue Nachbildung seines Gegenübers, trägt den Namen des hl. Franz Xaver, des großen Indien-Missionars der
Massimo Stanzione, Die Heimsuchung, 1656, Neapel, Chiesa del Gesù Nuovo, Capella della Visitazione (Capella Merlino).
Jesuiten (1506-52). Das Mittelbild von Bernardino Azzolino zeigt den Heiligen in Ekstase, die 3 oberen, brillant gemalten Szenen aus seinem Leben stammen von Luca Giordano.
Die überaus prächtige Rückwand des Hochaltars, mit 6 Kolossalsäulen und kurvig geschwungenem Giebelabschluß, ist ein Werk des 18. Jh., möglicherweise von D. A. Vaccaro; die Statuen sind wie der 3geschossige Altar selbst von verschiedenen neapolitan. Künstlern um die Mitte des 19. Jh. gefertigt worden.
Gesù Vecchio (eigentlich SS. Nomi di Gesù e Maria, seit 1726 S. Luigi Gonzaga; innerhalb der Universität an der Via G. Paladino, zwischen »Rettifilo« und Via S. Biagio dei Librai)
Das älteste kirchliche Bauwerk an dieser Stelle (etwas nördlich der heutigen Kirche) war eine 721 von Herzog Theodor gegründete Diakonie SS. Giovanni e Paolo. Ihre Überreste wurden 1566 beseitigt, da sie dem Chor der ersten Gesù-Kirche im Wege standen, die seit 1557 im Bau war und als holzgedeckter Saal mit je 4 Seitenkapellen und Kuppelvierung beschrieben wird (interessant für die Typologie der frühesten Jesuitenarchitektur). 1605 brach man auch diesen Bau wieder ab, um für die Vergrößerung des Collegio-Hofes Platz zu schaffen. Die heute bestehende Kirche wurde nach einem Plan des Ordensarchitekten Pietro Provedi aus Siena 1614 begonnen und 1632 eingeweiht. Um die Mitte des 18. Jh. entwarf Giuseppe Astarita eine neue Innenausstattung (im 19. Jh. restaur.).
Die Fassade mit schräggestellten Pilastern im Untergeschoß und lebhafter Stuckornamentik stammt wohl auch von Astarita. Die Disposition des Inneren — tonnengewölbter Saal mit je 4 Seitenkapellen, Vierungskuppel mit kurzen Kreuzarmen — folgt in etwa dem Vorbild der röm. Mutterkirche des Ordens, Vignolas Il Gesù.
In der 4. Kapelle links: Wundertaten des hl. Stanislaus von Girolamo Cenatiempo (1712). — 3. Kapelle rechts: Statue des hl. Francesco Borgia von Pietro Ghetti aus Carrara, viell. von Berninis hl. Longinus angeregt; die Dekoration der Kapelle schuf Pietros Bruder Bartolomeo Ghetti nach einem Entwurf Vinaccias. — 4. Kapelle rechts: am Altar die Erscheinung der Jungfrau vor dem hl. Franz Xaver, von Cesare Fracanzano; seitlich davon Transfiguration und Madonna mit den hll. Laurentius und Ignatius, von Marco Pino. — Im Querschiff links ein höchst bedeutender Solimena: Die wahre Religion triumphiert durch das Werk: des hl. Ignatius über Häresie und Unglauben; das malerische Thema des stark an Giordano erinnernden Bildes ist die Wirkung des aus dem Himmel hervorbrechenden Lichtes, das alle irdischen Trübungen durchdringt und aufhellt. Die Statuen (Josua und Gideon) sind von Matteo Bottiglieri. — In der Sakristei ein interessantes
hölzernes Gabelkruzifix aus der Mitte des Trecento; außerdem Bilder von Marco Pino (Geburt Christi) und Fr. de Mura (hll. Ludwig und Luigi Gonzaga) sowie eine Januarius-Büste von Bottiglieri.
Rechts, Nr. 39, das Rustikaportal des ehem. Jesuitenkollegs (s. S. 360).
S. Giacomo degli Spagnuoli (S. Giacomo Maggiore; Piazza del Municipio)
Heute ein Teil des Palazzo Municipale (Palazzo di S. Giacomo), dessen 5geschossige klassizist. Fassade die ganze W-Seite der am Hafen gelegenen Piazza del Municipio einnimmt.
Die dem Schutzpatron der iberischen Halbinsel geweihte spanische Nationalkirche wurde i. J. 1540 von Don Pedro di Toledo, Vizekönig und Statthalter Karls V., gegründet, dessen Grabmonument aufzunehmen sie später ausersehen wurde. Sie bildet das einzige wenigstens teilweise erhaltene Werk Ferdinando Manlios, des wichtigsten neapolitan. Architekten in der 1. Hälfte des 16. Jh. (f um 1570), dessen große, von Don Pedro in Auftrag gegebene Bauten fast durchweg späteren Umgestaltungen zum Opfer fielen (Palazzo Reale, Castel Capuano, SS. Annunziata). Das gleiche Schicksal ereilte die Fassade unserer Kirche, als Stefano Gasse 1819-25 den zur Aufnahme (von Ministerien der königlichen Regierung bestimmten Palast errichtete; alte Ansichten zeigen eine 3portalige Front im Basilika-Typus, mit Schneckenvoluten zu seiten des Obergeschosses, die bereits im 18. Jh. einige Veränderungen erlitten zu haben scheint. Städtebaulich bemerkenswert ist die in alten Guiden erwähnte Ausrichtung des Baues nach der Achse des »Molo Grande«; ein vermutlich gleichzeitig angelegter Straßenzug führte in gerader Linie vom Hafen zur Kirche herauf, und man hätte bei geöffnetem Eingangsportal vom Hochaltar aus den Molenkopf sehen können.
Verschiedentlich restauriert, aber in seinen Hauptlinien unversehrt ist das Innere, das man heute durch das rechte Portal der Palastfront betritt. Nach Passieren eines Treppenvestibüls, an dessen Stelle sich ehemals eine Terrassen- und Freitreppenanlage erstreckte, öffnet sich eine 3schiffige Pfeilerbasilika von angenehmen Verhältnissen, deren Wirkung allerdings durch den uniformen klassizist. Anstrich beeinträchtigt wird. Von der urspr. Farbigkeit, mit weißen Putzflächen zwischen grauen Hausteingliederungen, mag die rechte Chorkapelle ein ungefähres Bild vermitteln. Die 5 Langhausarkaden erheben sich über massigen Pfeilern mit ionischen Pilastern auf Piedestalen; das Mittelschiff trägt ein Tonnengewölbe mit Fensterstichkappen, die Sei-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Piazzetta Riario Sforza. Guglia di S. Gennaro (C. Fanzago) 14. Jh.
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S Lorenzo Maggiore. Inneres
tenschiffjoche sind überkuppelt (das rechte Seitenschiff mußte nach Bombentreffern im 2. Weltkrieg teilweise erneuert werden). Die damals selten realisierte Verbindung von Mehrschiffigkeit und Wölbung könnte hier durch Entwürfe des jüngeren Antonio da Sangallo angeregt sein; kurz darauf hat Palladio die dem Typus innewohnenden Möglichkeiten aufgedeckt (Venedig, S. Giorgio Maggiore).
Eine vom Üblichen abweichende Gewölbeanordnung zeigt das Presbyterium mit den 3 Chorkapellen: Während die eigentliche Vierung lediglich von einem flachen Segelgewölbe überspannt wird, sitzt die Hauptkuppel, in deren Rundung 8 Stichkappenfenster einschneiden, über dem anschließenden quadratischen Chorjoch.
Möglicherweise handelt es sich hier um eine spätere Planänderung, deren Zweck darin liegt, den Hauptstrom des Oberlichtes auf die polygonale Chorapsis und das dort aufgestellte Grab des Vizekönigs zu konzentrieren; eine Absicht, die freilich durch den Einbau der schweren barocken Orgeltribüne gründlich zunichte gemacht wurde. Überdies ist der Blick auf das Grab heute durch den barocken Altarprospekt verbaut; der Zugang führt durch eine der beiden seitlichen Chorkapellen.
Über den Zeitpunkt der Entstehung des Grabes ist nichts Genaues bekannt. Sicherlich wurde es zu Lebzeiten Don Pedros und von diesem selbst in Auftrag gegeben. Eine Nachricht Vasaris besagt, es sei urspr. dazu bestimmt gewesen, zusammen mit den sterblichen Überresten des Vizekönigs nach Spanien überführt zu werden. Doch ruhen die Gebeine des großen Spaniers weder hier noch in seinem Heimatland, sondern im Dom zu Florenz, wo er 1553 auf einer Besuchsreise zu seinem Schwiegersohn, dem Großherzog Cosimo I. Medici, gestorben war. Die Aufstellung des Kenotaphs in S. Giacomo erfolgte, wie die Inschrift besagt, erst 1570 durch Don Pedros Sohn Garzia. — Mit der Ausführung war der beste Bildhauer von Neapel, Giovanni da Nola, beauftragt worden. Wie weit der 1558 gestorbene Meister eigenhändig gearbeitet hat und was seinen Schülern und Nachfolgern Domenico d’Auria, Caccavello u. a. zu verdanken ist, bleibt schwer zu entscheiden. Die vorzügliche Qualität der Porträtfiguren zeigt in jedem Falle einen erstrangigen Künstler, auch das dekorative Detail (Karyatiden, Masken, Wappenkartuschen etc.) hält sich durchweg auf hohem Niveau. Der Typus des Freigrabes mit der Darstellung des Verstorbenen »au vif« zu seiten seiner Gattin Maria Osorio de Pimentel scheint am ehesten auf französ. Vorbilder zurückführbar: Man denkt an die Königsgräber in St-Denis, v. a. das freilich erst 1554-60 entstandene Grabmonument Franz’ I.; den Prototyp der Gattung dürfte das heute verschwundene, aber im Stich überlieferte Grab Karls VIII. von Guido Mazzoni da Modena, dem Mei-
ster der Pietà-Gruppe von S. Anna dei Lombardi, gebildet haben (1497). Aber auch spanische Grabmäler, etwa die Luna-Kapelle im Dom von Toledo, kommen als Muster in Betracht. In jedem Falle möchte man meinen, der Geist des ernsten und willensstarken, auf »decorum« und Ordnung bedachten Regenten habe in seinem Grabmal einen vorzüglichen Ausdruck gefunden. Die stärkste Wirkung geht von der großen und klaren Disposition aus: Viel freier Raum ist um die Figuren; Vizekönig und Vizekönigin knien in strenger Vereinzelung, die Blicke parallel zum Altar gerichtet, hinter ihren mit Wappen gezierten Betpulten. Darunter die zu einer breiten Plattform vergrößerte Tumba; sie trägt an ihrer Stirnwand die Inschrift Don Garzias, an den übrigen Seiten Reliefs, die wichtige Stationen aus der langen und ereignisreichen Regierung Pedros (1532-53) festhalten: Wir sehen den Vizekönig im Feldzug gegen die Türken, beim Einzug Karls V. durch die Porta Capuana, entlang der mit Rundtürmen bewehrten aragonesischen Stadtmauer, und schließlich die Seeschlacht von Baia gegen den maurischen Seeräuber Barbarossa (hübsche Ansicht des Golfes von Pozzuoli: im Vordergrund Pozzuoli selbst, darüber Baia mit seinem Kastell, links Kap Miseno und dahinter Ischia). Auf den Ecken des nochmals breit ausspringenden Sockels stehen 4 rundliche, von wehenden Gewändern umgebene Frauengestalten, die das für neapolitan. Herrschergräber unerläßliche Tugendprogramm — »Justitia«‚ »Prudentia«, »Temperantia«, »Fortitudo« — verkörpern; die zeitgemäß-humanistische Form der fürstlichen Tugendallegorie — ein Zyklus von Herkules-Taten — hat in den Reliefs der Oberseite Platz gefunden.
Im Scheitel der Hauptchorkapelle steht das Grabmal des Don Pedro Mayorga; unten die Liegefigur des Verstorbenen, darüber eine Statue des hl. Petrus (1609). Seitlich davon die Gräber zweier vornehmer Kriegsleute aus dem Gefolge Karls V., von Giovanni da Nolas Schüler Caccavello: links der Spanier Alfonso Basurto, rechts Hans Walther von Hiernhaim, Oberst und Landsknechtsführer, mit Inschrift in deutschen Knittelversen: »Carls Rath und Obrister ich was / seinem Sun Philippsen ich gleichermaß / treullich dienet, seine Land und Leute zu verfechten / zog herein mit sechstausend Landsknechten ...« Ein neapolitan. Autor des 19. Jh. hat die got. Lettern auf gut Glück transkribiert und das Ergebnis als Denkmal einer heute gänzlich verschollenen Sprache bestaunt. — Ein weiteres Kriegergrab von unbekannter Hand (1551) befindet sich in der rechten Nebenchorkapelle. Der Verstorbene, Federico Vries, liegt in gelöster Haltung auf seinem trophäengeschmückten Sarkophag, in der Lünette darüber eine Madonna. Gegenüber noch ein Grab des 16. Jh., ohne Inschrift, erst neuerdings angebracht. Am Altar eine Immaculata von Giuseppe Marullo.
Der reich dekorierte Hochaltar mit dem Marmorrelief des toten Christus, der von Engelchen zur Ruhe gebettet wird, stammt von
D. A. Vaccaro. — Vom gleichen Künstler das Martyrium des hl. Jakobus am rechten Querschiffaltar.
Langhaus: linkes Seitenschiff, 2. Kapelle: Kreuzigung von Giovanni Bernardo Lama. — Rechtes Seitenschiff, 1. Kapelle: Madonna mit den hll. Antonius und Franz von Paola, von Marco Pino; 2. Kapelle: Grabmal des spanischen Ritters Pedro de Vargas (1566); am Altar die Erscheinung der Madonna vor dem hl. Hieronymus, von einem unbekannten Meister des 16. Jh.; 4. Kapelle: eine zu Unrecht dem Giorgio Vasari zugeschriebene Epiphanie. — Im Vestibül 2 Grabmäler, Ferdinando Maiorca und seine Gemahlin Porzia Coniglia (1597/98), vermutl. von Michelangelo Naccherino; etwa aus der gleichen Zeit die schönen geschnitzten Türflügel (links die Madonna und der Evangelist Johannes, rechts der hl. Jakob und Maria Magdalena).
S. Giorgio dei Genovesi (Via Medina, bei der Piazza del Municipio) wurde gegen 1620 von Bartolomeo Picchiatti erbaut: eine Saalkirche mit Kuppelvierung vom üblichen Typus, aber mit ungewöhnlich steilen Raumverhältnissen, v. a. in der hochaufragenden, spitzbogig profilierten Tambourkuppel. Von besonderem Reiz ist die üppige Stuckdekoration. — Das bedeutendste Gemälde der Kirche ist das Antonius- Wunder (am 3. Seitenaltar links, St. Anton erweckt einen Toten), ein leider schlecht erhaltenes Frühwerk des Battistello Caracciolo (um 1607); 4. Altar links: Kreuzigung von Domenico Fiasella; hinter dem Hochaltar ein theatralischer Drachenkampf St. Georgs, von Andrea Sabatini von Salerno; im Querschiff rechts: Martyrium des hl. Placidus von Francesco de Mura; 3. Seitenaltar rechts: Der sel. Bernardo Tolomei heilt einen Besessenen, von Giovanni Francesco Romanelli; 2. Seitenaltar rechts: Tod des hl. Joseph von Nic. Piscopo.
S. Giorgio Maggiore (O-Seite der Via del Duomo, Ecke Via Vicaria Vecchia)
Der Bau wurde 1640 von Cos. Fanzago begonnen und im 19. Jh. einschneidend verändert (s. u.). Er nimmt die Stelle der alten Basilica Severiana ein, die von Bischof Severus (um 362-408) errichtet wurde und die erste Pfarrkirche (Catholica Maior) des antiken Neapel bildete. Urspr. wohl Christus und den Aposteln geweiht, nahm das Gebäude noch im Laufe des frühen Mittelalters den Titel einer benachbarten Georgskapelle an. Ein zweites Kultzentrum der Basilika war der Körper des hl. Severus, der im 9. Jh. aus seinem Katakombengrab (vgl. S. Severo alla Sanità) genommen und in S. Giorgio beigesetzt wurde; 1310 erhielt er eine prächtige Grabstätte unter dem damals neuerrichteten Hochaltar.
Die Apsis der alten Basilika bildet eine jener seltenen Reliquien frühchristl. Architektur in Neapel, die allen späteren Veränderungen und Zerstörungen standgehalten haben; sie fungiert heute als Eingangsvestibül des um 1800 gedrehten Barockbaus. Im Scheitel von 3 großen Säulenarkaden durchbrochen (die schönen korinthischen Marmorsäulen sind
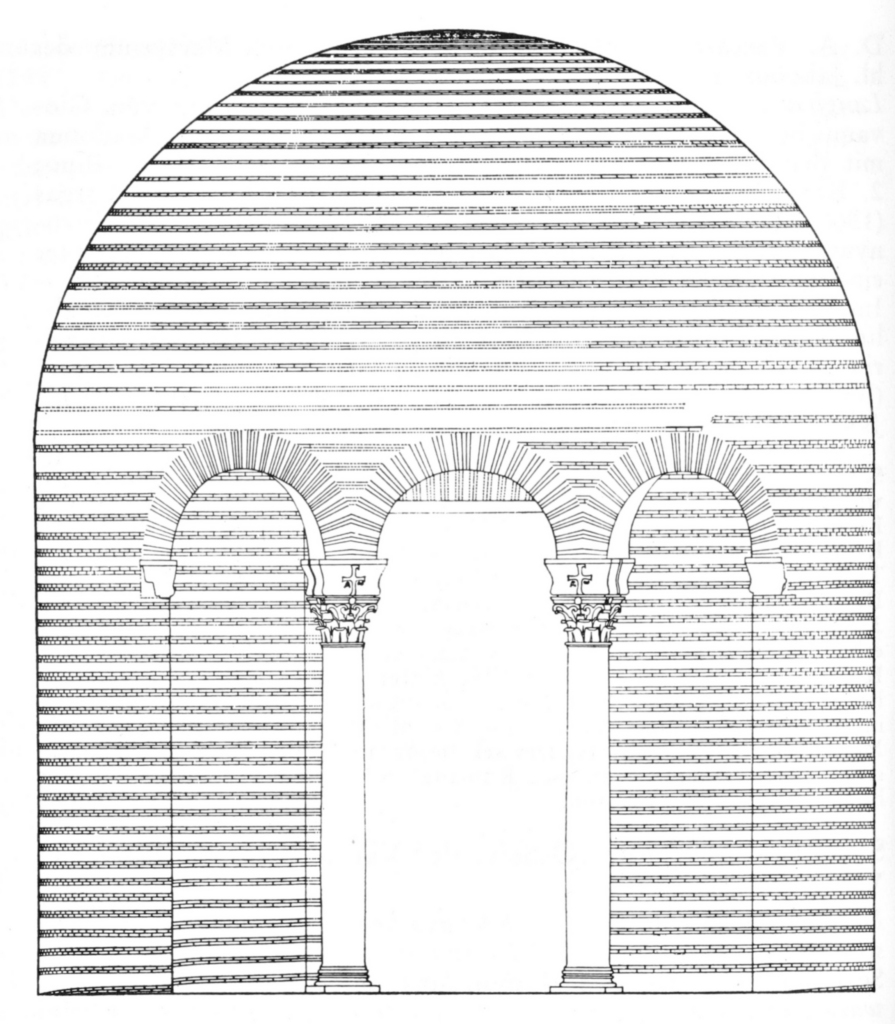 S. Giorgio Maggiore. Eingangsvestibül (Apsis der Basilica Severiana), Schnitt
S. Giorgio Maggiore. Eingangsvestibül (Apsis der Basilica Severiana), Schnitt
Spolien, die mit dem Monogramm Christi geschmückten Kämpfer dagegen gehören der Bauzeit der Kirche an), bildet die severianische Apsis das besterhaltene Beispiel einer spezifisch kampanischen Bautradition (vgl. S. Gennaro extra moenia, S. Giovanni Maggiore; außerdem Prata bei Avellino). Die gewölbte Kalotte, deren Mauerwerk heute freiliegt, trug urspr. ein Mosaik mit Christus im Kreise der Apostel und den 4 Propheten Jesaias, Jeremias, Daniel und Hesekiel. — Was jenseits dieser Apsisöffnung lag — ein Um-
gang, ein offenes Atrium oder der freie Straßenraum — ist nicht mehr auszumachen. Die Gestalt der Basilika selbst jedoch läßt sich auf Grund eines Visitationsberichtes von 1580 einigermaßen rekonstruieren. Die Abmessungen entsprachen ungefähr dem heutigen Bau. An die Apsis schloß sich ein leicht über die Schiffsbreite ausspringendes Querhaus, das durch Säulenstellungen in einen annähernd quadratischen vierungsähnlichen Mittelbau und 2 Seitenflügel unterteilt wurde; auch der Eingang der Apsis war (wie in S. Restituta, s. S. 113) durch einspringende Säulen abgeschnürt. Das Langhaus war 3schiffig mit je 11 Säulenarkaden; die Breite des Mittelschiffs entsprach dem Durchmesser der Apsis, die Seitenschiffe waren je halb so breit (einige Säulen heute in der Vorhalle von S. Maria degli Angioli alle Croci). Ein Atrium oder Portikus bildete den Eingang.
1640 fiel das schon stark baufällige, mehrfach reparierte Gebäude einem Brand zum Opfer. Der nach Fanzagos Entwurf sofort in Angriff genommene Neubau kam nur stockend voran; das 1. (nördl.) der 3 Joche des neuen Langhauses blieb schließlich ohne Gewölbe und bildete so eine Art offenes Atrium vor der mit einer provisorischen Eingangswand geschlossenen Kirche. Erst 1881 wurde dieser Teil des Baues hergestellt und die Apsis der alten Basilika, die inzwischen unter allerlei Anbauten verschwunden war, freigelegt und sachkundig restauriert; gleichzeitig aber faßte man den Entschluß, das rechte (westl.) Seitenschiff, das der geplanten Verbreiterung der Via del Duomo im Wege stand, kurzerhand abzubrechen. So entstand ein sonderbar asymmetrisches Raumgebilde, das beträchtliche Anforderungen an die ergänzende Phantasie des Betrachters stellt.
Das Schema des Grundrisses läßt sich entweder als 3 x 3 Joche umfassende Pfeilerbasilika interpretieren oder aber als ein in die Länge gezogener (und damit den Maßen der alten Basilika angepaßter) Kreuzkuppelbau vom Typus der Peterskirche, wie Fanzago ihn auch später gern verwandt hat (vgl. S. Maria Maggiore). Das Mittelschiff wird durch 3 aneinandergereihte quadratische Joche gebildet, von denen die beiden äußeren mit flachen Kappengewölben bedeckt sind, das mittlere aber eine hochaufsteigende fensterdurchbrochene Kalotte trägt. Das zentralisierende Moment wird verstärkt durch den Eindruck größerer räumlicher Weite des Mitteljoches, der allerdings nur durch die verschiedenartige Behandlung der Pfeilerecken zustande kommt: rechtwinklige Rücksprünge mit halbierten Pilastern in den Außenjochen,
 S. Giorgio Maggiore. Längsschnitt und Grundriß
S. Giorgio Maggiore. Längsschnitt und Grundriß
breite Schrägen — und damit zugleich verbreiterte Kuppelpendentifs — im Mittelraum (dieselbe Wirkung in S. Filippo Neri). Die flachbogige Apsis am südl. Ende des Langhauses ist in eine Säulenstellung aufgelöst, durch die man in den dahinterliegenden Mönchschor blickt: ein »Zitat« aus dem Vorgängerbau, das freilich auch durch Palladio (Venedig, Il Redentore) angeregt sein könnte. Die Seitenschiffe (bzw. das übriggebliebene linke) sind schmal und hoch; die Disposition im ganzen sowie auch manche Details (die seltsamen Binnenfenster über den Trennbögen) erinnern wohl nicht zufällig an die Seitenschiffe von Madernas St.-Peter-Langhaus in Rom. Die entscheidende Gemeinsamkeit liegt in dem Bestreben, dem Langhausbau wenigstens für das Auge kreuzförmige Grundgestalt zu verleihen, indem die mittlere der
3 Travéen durch seitliche Ausweitung dem Charakter eines Querarms angenähert wird. Die Dekoration, Kompositordnung und Blendrahmengliederung, wirkt eher streng; erst in der Gewölbezone ist dem Stukkateur etwas freiere Hand gelassen worden. Die glatte Zusammenziehung von Tambour und Gewölbeschale in der Hauptkuppel ist eine der für Fanzago charakteristischen Vorwegnahmen spätbarocker Motive.
In der 1. Seitenkapelle links eine Bekehrung des hl. Dismas von Francesco Peresi (1713); rechts gegenüber von dem gleichen Meister ein Tobias mit dem Engel. — Die letzte Seitenkapelle links enthält schwungvolle Fresken des jungen, noch ganz im Banne Giordanos stehenden Solimena und ein gutes Holzkruzifix des 18. Jh. — Der Hochaltar mit dem Grab des hl. Severus stammt von Camillo Lionti (1786), die Figuren schuf Francesco Pagano. Im Chor 2 große Bilder (St. Georg tötet den Drachen und Der hl. Severus weckt einen Toten auf) von Alessio d’Elia. — Die Sakristei enthält ein großes mittelalterl. Kruzifix von umstrittener Herkunft und Datierung, wahrscheinl. aus dem 12. Jh.; 1950 sorgfältig restaur., wobei die Reste der alten Bemalung freigelegt werden konnten. Der Körper Christi steht, symmetrisch aufgerichtet, mit beiden Beinen auf dem Suppedaneum; der Kopf ist leicht gegen die rechte Schulter geneigt. Am oberen Kreuzbalken zwischen 2 primitiven Engelchen die Inschrift »Jesus Nazarenus Rex Judaeorum«; in den Scheiben an den Enden des Querbalkens sind vermutl. die trauernden Maria und Johannes zu ergänzen.
S. Giovanni Battista (delle Monache, auch S. Giovanniello; Via S. Maria di Costantinopoli, beim Nationalmuseum)
Die Kirche wurde 1681 von F. A. Picchiatti erbaut; architektonisch bemerkenswert die von G. B. Nauclerio hinzugefügte Vorhallenfassade (1735 vollendet), gegliedert durch 2 Ordnungen frei vor der Wand stehender Säulen (merkwürdigerweise oben korinthisch, unten komposit) mit verkröpften Gebälken und krönendem Mittelgiebel, eingefaßt von pilastergeschmückten Eckpfosten; eine eigentümlich zwischen Manierismus und Klassizismus schwankende, an hellenistische Bühnenprospekte erinnernde Schauarchitektur, die in einem der für das 18. Jh. geläufigen Stilbegriffe unterzubringen nicht gelingen will.
Das Innere wird von einem selten anzutreffenden Kustoden behütet (Klingelknöpfchen am Pfeiler links vom Eingangsgitter).
Wer Geduld hat, wird belohnt durch den Anblick einer überaus schönen Marienkrönung von Massimo Stanzione (1649) am linken
Querschiffaltar. Scheinbar mühelos hat der 64jährige Meister die lang gesuchte Synthese zwischen seinem leuchtenden, in elementaren Kontrasten schwelgenden Kolorit und modellierender Schwarzmalerei im Sinne Riberas zustande gebracht; dabei ist die Zeichnung, im Reigen der Engel sowohl wie in Stellung und Gebärden der Hauptfiguren, von bestrickendem Einfallsreichtum, der Ausdruck der Gesichter von schönstem Ernst. — Am Hochaltar ein gleichfalls erstrangiger Luca Giordano, Predigt Johannes’ d. T.: der Redner mit weisend ausgestreckter Hand in gelassenem Kontrapost, ringsum unzählige Varianten lauschender Charaktertypen, ein dankbares Thema für den Pinsel Giordanos wie für den seines großen Vorbildes Veronese.
Im rechten Querschiff eine Rosenkranz-Madonna von Gius. Simonelli (1702). In der 1. Seitenkapelle links des Langhauses eine Schmerzensreiche Madonna von A. dell’Asta, 1707; 1. Kapelle rechts: schöne Verkündigung von A. Vaccaro und Immacolata von Bernardo Cavallino; 2. Kapelle rechts: Madonna vom hl. Lukas gemalt, von A. Vaccaro 1666, in atmosphärisch belebtes, warmes Helldunkel getaucht. An der Eingangswand über der Tür eine Maria Magdalena von Preti. — In einem Nebenraum zwischen der 1. und 2. Seitenkapelle rechts befindet sich ein Selbstporträt Luca Giordanos, in ganzer Figur, festlich gewandet und von einem gambespielenden Schutzengel akkompagniert.
S. Giovanni a Carbonara (S. Giovanni Battista; auf einer Anhöhe nördl. der alten Stadtmauer zwischen Porta S. Gennaro und Porta Capuana an der Strada Carbonara gelegen; Carbonara leitet sich von »copronarium« = Müllplatz her, aus dem griech. »kopros« = Kot, Schmutz)
S. Giovanni ist berühmt als Grabkirche König Ladislaus’ und vieler neapolitan. Adelsfamilien der Renaissance. Geschichte und Topographie des Carbonara-Hügels und seiner Bauten sind für den heutigen Besucher nicht leicht zu durchschauen; wir stellen daher der Besprechung der einzelnen Monumente eine kurze chronologisch-topographische Übersicht voran.
Die alte Johanneskirche, von der sich keine Spuren erhalten haben und über deren Gestalt und Lage nichts Sicheres auszumachen ist, ging auf eine private Stiftung zurück: Gualterio Galeota, Nobile del Sedil Capuano, schenkte 1339 den Augustinereremiten ein Grundstück zur Errichtung eines Konvents und einer dem Täufer geweihten Kirche, in der er selbst beigesetzt sein wollte. 1382 wurde die am Fuße des südl. Abhangs (Ecke Via Cirillo) gelegene Kirche S. Maria della Pietà gegründet; der Stifter, ein gewisser Frate Giorgio, wollte damit den blutigen, von Petrarca mit Abscheu geschilderten Kampfspielen ein Ende setzen, die die
Neapolitaner an dieser Stelle abzuhalten pflegten. Zu Beginn des 15. Jh. (vor 1414) begannen die Eremitaner-Fratres aufgrund einer Zuwendung König Ladislaus’ von Anjou‚-Durazzo den heute noch stehenden Neubau von S. Giovanni auf dem Rücken des Hügels zu errichten; wenig später (vor 1433) entstand die vom östl. Ende des Langhauses aus nach S vorspringende Cappella di S. Monica (urspr. SS. Filippo e Giacomo). Da die W-Front von S. Giovanni keine direkte Verbindung zur Straße besaß, fungierte ein Seitenportal in der südl. Längswand des Schiffes als Haupteingang; die davorliegende Terrasse erreichte man über eine lange, gerade Freitreppe, die (wie die heutige) von der Madonna della Pietà zur Monika-Kapelle hinaufführte; den westl. Abschluß jener Terrasse bildet die 1533 von Geronimo Seripando gestiftete Cappella del Crocefisso. 1620 entdeckte man in einer Tischlerwerkstatt unter der großen Freitreppe ein altes Madonnenfresko, das sich alsbald als wundertätig erwies; ein Edelmann namens Pirro Capece Galeota, der hier den von seinen Vorfahren gegründeten, bei der Errichtung der neuen Johannes-Kirche zerstörten Urbau von S. Giovanni gefunden zu haben glaubte, richtete 10 Jahre später die der Madonna Consolatrice geweihte Unterkirche ein. Zu Beginn des 18. Jh. entschloß man sich, dem vielbesuchten neuen Marienheiligtum zuliebe die alte Freitreppe abzutragen und durch eine aufwendige Anlage zu ersetzen, die eine würdige Gestaltung des Zugangs zur Unterkirche ermöglichte.
Diese neue Freitreppe, 1708 erb., ist ein Werk des 33jährigen Ferdinando Sanfelice, der hier zum ersten Male Gelegenheit erhielt, seine spezifische Begabung als Treppenbaumeister zu erproben. Mit der vertrackten Topographie des zur Verfügung stehenden Raumes ist er auf magistrale Weise fertig geworden; welch hoher szenographischer Reiz seiner Schöpfung innewohnt, wird der von der tristen Umgebung verstörte Beschauer würdigen können, wenn er sich klarmacht, daß man es hier mit einem unmittelbaren Vorläufer der »Spanischen Treppe« in Rom zu tun hat. Die Führung der Treppenläufe ist, dem Geist des Jahrhunderts entsprechend, auf größtmögliche »commodità« angelegt: ein weitgespanntes Geflecht sanft ansteigender, kreisförmig ausschwingender Rampenpaare, unterbrochen von schiefwinklig begrenzten Podesten (»riposi«), sorgt dafür, daß der beträchtliche Niveau-Unterschied (56 Stufen) nahezu spielend bewältigt wird.
Das rustizierte Portal in der Rückwand des unteren Treppenabsatzes vermittelt den Zugang zu einem zierlichen Achteck-Vestibül, das unter der links aufsteigenden Rampe Platz gefunden hat; von hier aus betritt man die Unterkirche (S. Maria Consolatrice degli afflitti, nach dem oben erwähnten, heute verschollenen Gnadenbild), einen niedrigen Kuppel-
raum mit 4 Kreuzarmen, deren flache Gewölbe als Stichkappen in die leicht querovale Kalotte des Mittelraums einschneiden (1735 restaur. oder umgebaut; die alte Ausstattung ist schon seit dem 19. Jh. verschwunden, bis auf einige Reliefs mit biblischen Szenen aus dem Umkreis des Giovanni da Nola, am 1. Altar links).
Die oberste Plattform der Treppe, von einer im Bogen vortretenden Futtermauer getragen, liegt vor dem spätgot.
Eingangsportal der Monika-Kapelle, die weiter unten behandelt werden soll; der rechte Lauf endet vor der Tür der alten Klosterapotheke, der linke führt zu einem Portal, durch das man endlich den Vorhof von S. Giovanni betritt. Ein spitzbogiges, mit Durazzo-Wappen geschmücktes Portal in der Mitte der Langhauswand führt ins Innere.
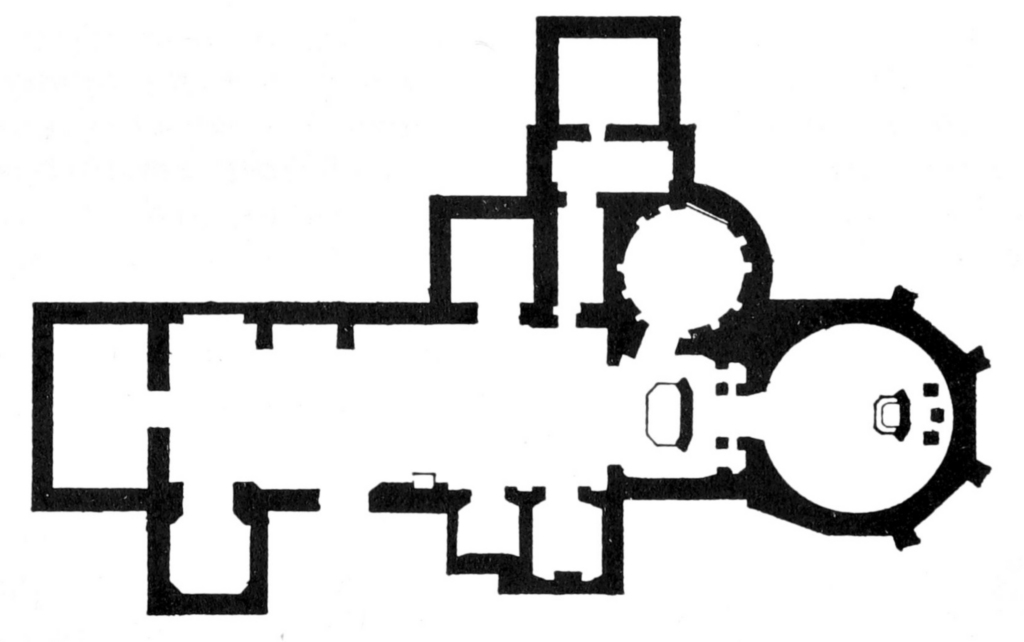 S. Giovanni a Carbonara. Grundriß
S. Giovanni a Carbonara. Grundriß
Das urspr. Bild der Bettelordenskirche vom Anfang des 15. Jh., eines Saalbaus mit Sparrendach, reich profiliertem Triumphbogen und kreuzrippengewölbtem quadratischem Chorjoch, läßt sich heute nur noch in groben Zügen erkennen. V. a. das Erdbeben von 1688 und die Säkularisation z. Z. der Franzosenherrschaft haben der Kirche manchen Schaden zugefügt. 1836 wurde sie nach durchgreifender Restaurierung neu geweiht; nachdem im August 1943 mehrere Fliegerbomben den Bau getroffen hatten, wurden umfassende Wiederherstellungsarbeiten eingeleitet, die nunmehr vor ihrem Abschluß stehen.
Die Ausstattung des Schiffes und seiner Anbauten soll in Form eines Rundgangs besprochen werden. An der Längswand zur Linken des Eingangs finden sich Reste eines Verkündigungsfreskos von Leonardo da Besozzo (Mitte 15. Jh.). — Die anschließende (westl.) Schmalwand des Schiffes trägt links einen prunkvollen
Marmoraltar von. Annibale Caccavello; rechts eine Madonnenfigur von Michelangelo Naccherino (1601); über ihr Skulpturenfragmente von Tommaso Malvito. An Stelle des ehem. W-Portals der Kirche öffnet sich in der Mitte der Wand ein bogenförmiger Durchgang, flankiert von den Statuen Johannes’ d. T. und des hl. Augustinus von Caccavello. Er führt in die 1553-66 von Giovanni Domenico d’Auria und Caccavello errichtete Cappella di Somma mit dem Grabmal des Scipione di Somma (Caccavello), einem Marmoraltar (Himmelfahrt Mariae von d’Auria) und freskiertem Tonnengewölbe (Propheten und Heilige, alt- und neutestamentliche Figuren, Trinität, von unbekannter Hand).
An der nördl. Langhauswand, schräg gegenüber dem Eingangsportal, steht das marmorne Grabmonument des Giovanni Miroballo, eines in den Adelsstand aufgestiegenen neapolitan. Kaufmanns des Quattrocento, und seiner Nachkommen. Der architektonische Aufbau, der Grab und Altar aus dem Kirchenschiff aussondert, ist dem Oberteil des Triumphbogens vom Castel Nuovo nachgebildet; der Stil der Nischenfiguren und der Reliefs (Heilige, Kirchenväter, Tugenden; am Altar der Schmerzensmann mit Maria, Johannes und Engeln; im Bogenfeld die Madonna mit den beiden Johannes und dem Stifterehepaar; im Tympanon des Bogens Christus als Salvator) weist auf den Kreis des Isaia da Pisa hin; der schöne Evangelist Johannes in der Mittelnische zeigt die Hand eines florentinisch geschulten Künstlers. Die inschriftlich bezeugte Restaurierung von. 1619 scheint sich auf die Balustrade beschränkt zu haben. — Die folgende Seitenkapelle (Cappella Ricco) beherbergte Reste einer hölzernen Weihnachtskrippe von Pietro e Giovanni Alamanno, 1478-84 (derzeit in Restaurierung). — Der rechts anschließende Altar der Madonna delle Grazie stammt von Michelangelo Naccherino (1578). — Es folgt der Korridor zur Sakristei; ein Zyklus von 18 Tafelbildern mit biblischen Szenen von Vasari und Cristoforo Gherardi aus Arezzo (1546), der dort seinen Platz hat, ist jetzt im Museum von S. Martino.
Nach Betreten der Chorkapelle findet man in der Seitenwand links Vom Hochaltar einen schrägen Durchgang; er führt in die Cappella Caracciolo di Vico, eine der besten Leistungen der Hochrenaissance auf neapolitan. Boden. Ihre Stiftung ist inschriftlich für d. J. 1516 bezeugt (am Eingang); bei der 1557 vorgenommenen Weihe war die Ausstattung noch nicht fertiggestellt. Als entwerfender Meister kommt am ehesten Giovanni Tommaso Malvito in Frage, der schon 1506 für Galeazzo Caracciolo tätig war.
Der architektonische Grundgedanke — ein kreisrunder Raum mit abwechselnd großen und kleinen Nischen in Haupt- und Diagonalachsen, rhythmisch gruppierter dorischer Wandordnung, Attika und Kassettenkuppel — könnte von Bramantes
»Tempietto« angeregt sein; jedoch sind die Proportionen hier stark in die Breite gedrückt (die Schildbögen der Kapellennischen unterhalbkreisförmig), das Wandsystem so weit vereinheitlicht, daß eine ringsumlaufende Folge von Triumphbögen (»rhythmischen Travéen«) zustande kommt.
Giovan Tommaso Malvito, Capella Caracciolo di Vico, San Giovanni a Carbonara, Neapel.
Die reiche plastische Durchbildung aller struktiven Formen (Kanneluren, Eierstabkapitelle, Bogen- und Gesimsprofile) und die dichte Füllung der Wandflächen mit Rahmungen, Girlanden und Relieffiguren (Viktorien in den Bogenzwickeln) gehen gut mit den röm. Stiltendenzen des 2. Jahrzehnts zusammen. Die Wahl der Halbsäulen und die dadurch bedingte starke Ausladung der Piedestale und des Gebälks verleihen dem Gliederapparat etwas übermäßig Massives; sehr auffällig ist die Form des Hauptgesimses mit der weit vorstoßenden Hängeplatte, wie sie sonst nur im Außenbau angewandt wird (Rom, Marcellus-Theater; vgl. auch A. da Sangallos d. J. Gebälk im Hof des Palazzo Farnese). Der wohlerhaltene Marmorboden bildet das Muster der Kuppel ab. Die Hauptelemente der dorischen Ordnung zeigt, mit zierlichem Detail, schon der 1517 datierte Altar. Ein zeitgenössischer Autor, Pietro Summonte, bezeichnet ihn als Werk der spanischen Bildhauer Bartolomeo Ordoñez und Diego de Siloe; die schöne Statue Johannes’ (1. T. in der linken Nische gilt nach einer Vasari-Notiz als Arbeit des Girolamo Santacroce. In der rechten Nische steht ein hl. Sebastian von umstrittener Zuschreibung; als Werk der beiden Spanier gelten die überaus fein gearbeiteten Reliefs: im Zentrum die Anbetung der Könige mit prächtig bewegtem Beiwerk im Hintergrund, der feiste König zur Linken viell. ein Bildnis Ferrantes II.; darunter ‘St. Georgs Drachenkampf; an den Ecken die 4 Evangelisten, oben Christus als Salvator, unten am Altar der tote Heiland; die Piedestale der Säulen haben Adler, die im Schnabel eine Brille, das Wappensymbol der Familie Caracciolo, tragen; dazwischen alttestamentliche Opferszenen.
Andrea di Onofrio, Grabmal des Giovanni Caracciolo, 1441, Neapel, S. Giovanni a Carbonara, Capella Caracciolo del Sole.
Als Werk des Ordoñez gilt auch das Grabmal des Galeazzo Caracciolo in der linken Seitennische der Kapelle mit der sehr bedeutenden Porträtstatue des Stifters. Rechts gegenüber das Grab des Sohnes und Vollenders der Kapelle, Nicolantonio, eine schwächere Nachbildung des Galeazzo-Grabes von Giovanni Domenico d’Auria; an den Sockeln Hermen mit kolossalen Brillen. — In die Apostelfiguren der Diagonalnischen teilen sich Ordoñez (Jakobus), Santacroce (Paulus), Giovanni da Nola (Petrus) und Caccavello (Andreas — die übrigen 8 Apostel in der Attika zwischen den Fenstern); von den recht unglücklich zu ebener Erde plazierten weiteren Caracciolo-Statuen und -Büsten gehört nur der vollbärtige
Marcello noch dem 16. Jh. an (unter dem Petrus zur Linken des Altars, von Girolamo d’Auria 1573); die sehr feine Figur rechts vom Altar, wahrscheinl. Carlo Maria Caracciolo, wird dem Giuliano Finelli zugeschrieben.
Zurück in den Chor: Hinter dem Altar erhebt sich das über 18 m hohe Grabmonument des Königs Ladislaus von Anjou-Durazzo, nach dessen Tode (1414) von der Schwester und Thronerbin Johanna II. errichtet — ein letzter, zu dinosaurierhafter Größe ausgewachsener Sproß der 100 Jahre zuvor von Tino di Camaino begründeten Familie der got. Herrschergräber Neapels. Einen der beteiligten Bildhauer, Andrea di Nofri (di Onofrio), kennen wir aus der Künstlerinschrift eines 1428 datierten Grabmals in S. Francesco della Scala in Ancona: »Andreas de Florentia qui etiam sepulchrum Regis Ladilai excudit«; der malerische Schmuck stammt von Leonardo da Besozzo oder Bisucchio bei Mailand (lt. Signatur unter dem hl. Augustinus im rechten Seitenfeld). Der architektonische Aufbau zeigt das got. System in seiner spätesten Entwicklungsphase: Die einzelnen Elemente des Baldachingrabes — Pfeiler, Bogen, Sarkophag und Totenkammer — sind zu einem einzigen, von durchlaufenden Horizontalen gegliederten Rahmengerüst zusammengewachsen, das schirmartig flach zwischen die Wände der Chorapsis ausgespannt ist. Im Stil des Figurenschmucks v. a. der unteren Zonen werden erste Reflexe der neuen Florentiner Richtung (Donatello, Nanni di Banco) erkennbar; allein das Darstellungsprogramm repetiert noch immer die trecentesken Schemata. Neu hinzugekommen ist die von Sannazzaro besungene Reiterstatue des »Divus Ladislaus« auf der Spitze des Mittelgiebels, wohl eine Reminiszenz an die Scaligergräber in Verona. An der Bahre des Königs, der aus politischen Gründen zeitweilig mit dem Kirchenbann belegt worden war, hält ein Bischof mit 2 Ministranten die Totenmesse. Das darunterliegende Hauptgeschoß öffnet sich zu einer 3bogigen kreuzgewölbten Halle; in ihr sitzt das königliche Geschwisterpaar im großen Krönungsornat, flankiert von. »Glaube«‚ »Liebe«, »Hoffnung« und einer mit Zepter und Reichsapfel geschmückten »Herrschertugend«. Die 4 Kardinaltugenden (an die Stelle der »Justitia« ist bezeichnenderweise die »Magnanimitas« getreten) figurieren wie üblich als Pfeilerstatuen im Untergeschoß. An den Stirnseiten der Pfeiler und zwischen den Wimpergen stehen Apostel, Heilige, Könige, in den bekrönenden Tabernakeln eine Verkündigung; was an Flächen übrigblieb, ist mit Durazzo-Wappen und Lilien gefüllt. Die Inschriften ziehen sich unscheinbar, noch in got. Lettern, hinter den Karyatiden und am Sims des Hauptgeschosses entlang; ihr Text jedoch bezeugt in feierlichen Hexametern den Geist des neuen Saeculums: dieser Grabstein deckt einen Toten, dessen freier Sinn auf den gestirnten Olymp gerichtet war.
Ein Durchgang im Untergeschoß des Grabmals führt in die
um 1427 von dem königlichen Groß-Seneschall Sergianni Caracciolo del Sole gestiftete Cappella della Natività della Beata Vergine, die nach Art hochgot. Marienkapellen in der Hauptachse hinter dem Scheitel des Chores liegt. Es ist ein weiter und hoher, im Grundriß kreisrunder Raum mit leicht zugespitzter Kalotte, erhellt von reich profilierten Spitzbogenfenstern; ein käfigartiges Innengerüst von Diensten und Rippen zerlegt die übrigens völlig glatte Wand in 8 vertikale Bahnen. (Im Außenbau tritt die Kapelle als monumental behandeltes Oktogon hervor; die 4 Kanten des Baus sind mit massiven Strebepfeilern besetzt, über denen sich frei stehende Kolossalfiguren erheben; man erkennt Moses, Elias und eine Porträtstatue des Sergianni Caracciolo.)
Marco da Firenze, Grabmal des Königs Ladislaus (gest. 1414), 1428, Neapel, S. Giovanni a Carbonara.
Marco da Firenze, Grabmal des Königs Ladislaus (gest. 1414), 1428, Neapel, S. Giovanni a Carbonara.
Marco da Firenze, Grabmal des Königs Ladislaus (gest. 1414), 1428, Neapel, S. Giovanni a Carbonara.
Das Grabmal des mächtigen Günstlings und Liebhabers der Königin Johanna II., dem nach Meinung vieler Zeitgenossen »zum König nur mehr der Titel fehlte«‚ steht gegenüber dem Eingang.
‚Am 19. August 1432 war Sergianni, wohl mit Wissen seiner königlichen Geliebten, auf einer Hochzeitsfeier im Castel Capuano ermordet worden; noch im gleichen Jahr gab sein Sohn Trajano das Monument in Auftrag. Die Meisterfrage ist ungeklärt; dafür kennt man den Autor des über dem Sarkophag eingemeißelten Grabspruchs: Es ist der große Renaissance-Humanist Lorenzo Valla. Formen wie Inhalt zeigen, von unten nach oben fortschreitend, die got. Tradition im Übergang zur (halbverstandenen) Frührenaissance. Als Pfeilerfiguren im Untergeschoß fungieren anstelle der üblichen Virtus-Karyatiden 5 mit den Attributen kriegerisch-herrscherlicher Tugenden ausgerüstete Männer (Parallelbeispiele in Oberitalien, etwa an den Borromeo-Grabmälern auf der »Isola Bella«); die Stirnseite des Sarkophages ist nach florentinischer Art mit wappenhaltenden Genien geschmückt. Der Oberbau ist unausgeführt geblieben; die von 2 Löwen flankierte, recht kümmerlich ausgefallene Figur des Sergianni (wohl für die Spitze des Grabmals bestimmt) steht einigermaßen verloren zwischen den auf halber Höhe endenden Baldachinpfeilern.
Die Wände der Kapelle tragen einen umfangreichen Freskenzyklus mit Darstellungen aus dem Marienleben, das Hauptwerk des schon am Ladislaus-Grab bezeugten Mailänders Leonardo da Besozzo (Inschrift unter der Mariengeburt zur Rechten des Eingangs), der einen Abglanz des neuen norditalien. Realismus (Pisanello) nach Neapel bringt; wohl erst gegen die Mitte des Jahrhunderts zu datieren. Besonders prächtig die große Marienkrönung an der Eingangswand. Der Sockelstreifen mit anmutig erzählten Szenen aus dem Dasein der Augustinereremiten trägt die Signatur des Perrinetto da Benevento. — Aus der gleichen Zeit stammen die Reste des prachtvollen, vermutl. in Toskana gefertigten Majolika-
fußbodens mit Büsten, Tieren, Pflanzen und Wappenemblemen in quadratischen und sechseckigen Feldern.
Ins Schiff der Kirche zurückgekehrt, findet man in der 2. Kapelle der rechten (südl.) Längsseite das Grabmal des 1730 verstorbenen Rechtsgelehrten Gaetano Argento von Francesco Pagano nach einem Entwurf des Ferdinando Sanfelice. Das Altarbild der Kapelle, die hl. Ursula im Kreise der Gefährtinnen, stammt von Giovanni Vincenzo Forli (Anfang 17. Jh.). — Der folgende Wandaltar (Madonna mit den hll. Matthäus und Bartholomäus) ist ein Werk des Decio Tramontano (1556).
2 gesonderte, nur von außen zugängliche Kapellenanbauten flankieren den Vorhof der Kirche (Schlüssel beim Pfarrer). Im W, zur Linken des Haupteingangs, liegt die Cappella del Crocefisso, 1533 von dem großen Theologen und Diplomaten Geronimo Seripando gegr.; sie enthält das Grabmonument des Humanisten Antonio Seripando und seiner Lehrer und Studiengenossen Francesco Pucci und Giano Parrasio (1539), bemerkenswert durch das Fehlen jedes Hinweises auf die christl. Religion, und ein dem Giorgio Vasari zugeschriebenes Kreuzigungsbild.
Östl. des Hofes, in der Achse der großen Freitreppe, liegt das Oratorio di S. Monica (eigentlich SS. Filippo e Giacomo), die Familienkapelle der Fürsten Sanseverino von Bisignano, gestiftet von dem 1433 verstorbenen Ruggiero Sanseverino. Das reich dekorierte Eingangsportal enthält 8 Nischenfiguren (Verkündigung und weibliche Heilige) sowie 3 bekrönende Statuen (Maria, Johannes d. T. und hl. Augustinus), im Tympanon ein Relief (Christus in der Mandorla von 2 Engeln getragen) und darunter ein im 17. Jh. erneuertes Fresko (Himmelfahrt Mariae); der Aufbau im ganzen rein gotisch, das Detail hier und da (Muschelnischen) schon von der Frührenaissance beeinflußt. — Im Inneren, mit 2 quadratischen Kreuzgewölbejochen (im 19. Jh. durchgreifend restaur.), befindet sich das Grabmal des Ruggiero Sanseverino, ein durch 2 Inschriften (am Sarkophag und am Dachgesims) bezeugtes Werk jenes Andrea da Firenze, der auch am Ladislaus-Monument tätig war. Wohl unter dem Eindruck seiner großen Landsleute Donatello und Michelozzo (S. Angelo a Nilo) hat Andrea sich hier bemüht, das traditionelle Baldachinschema pedantisch-korrekt in die Sprache der Frührenaissance zu übersetzen. Die einzelnen Architekturelemente sind wieder klar voneinander gesondert, sogar der zwischen Kapitell und Bogen eingeschobene Kämpferblock wird getreulich nachgebildet. Auch Gewandung und Pose der 3 Säulenfiguren unter dem Sarg (»Glaube«, »Hoffnung« und »Liebe«) scheinen vom Brancaccio-Grab angeregt. Das übrige Figurenwerk wirkt konventionell und hausbacken; vereinzelte Farb- und Vergoldungsspuren deuten an, in welcher Richtung man sich den heutigen Eindruck ergänzen muß.
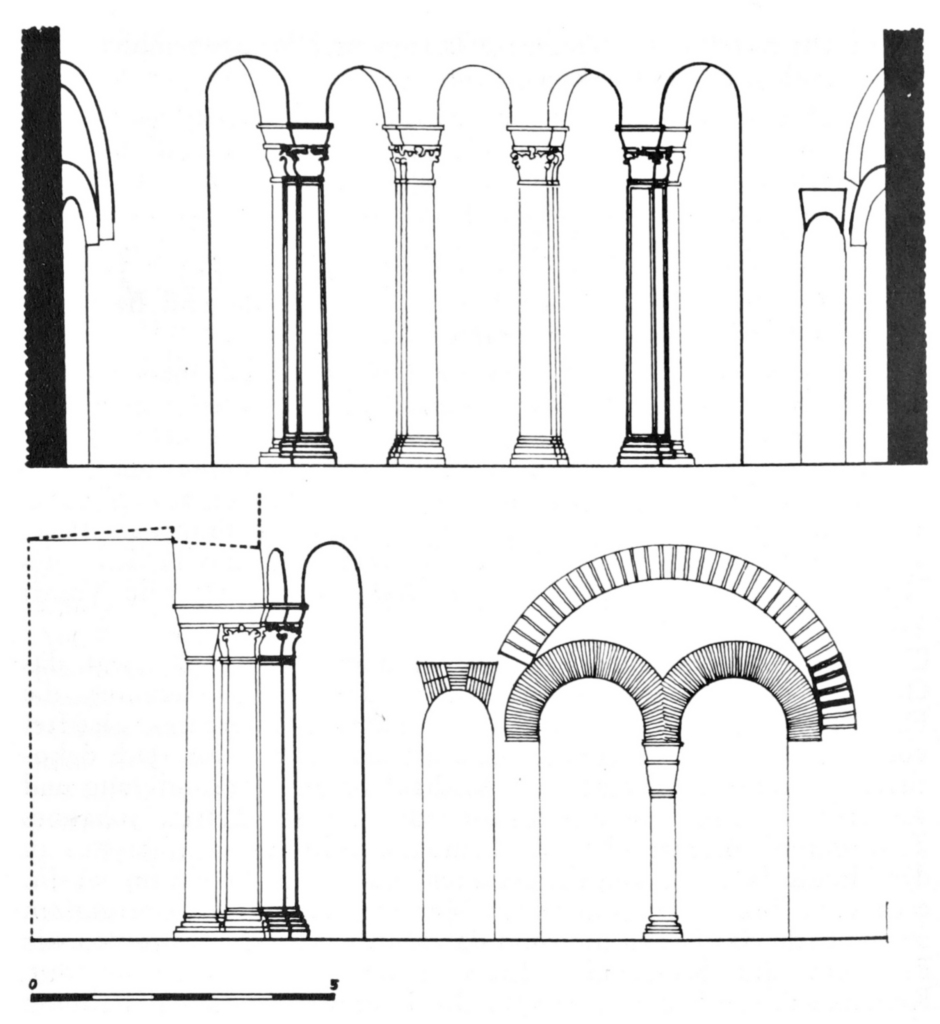 S. Giovanni Maggiore. Schnitte durch die Apsis und die Bogenstellung im Umgang
S. Giovanni Maggiore. Schnitte durch die Apsis und die Bogenstellung im Umgang
S. Giovanni Maggiore (im Zentrum des alten Hafenquartiers, zwischen Via Mezzocannone und Via Sedile di Porto)
Im 6. Jh. anstelle eines Antinous- oder Herkules-Tempels errichtet, 1685 von Dionisio Lazzari gründlich restaur. und 1872-87, nach dem Einsturz der barocken Gewölbe, vollständig erneuert.
Die alte Basilika wird als eine der prächtigsten Kirchen der Stadt geschildert, mit zahlreichen Mosaiken, einem Silberaltar und anderen kostbaren Ausstattungsstücken. Erhalten hat sich von ihr — außer dem 3schiffigen Grundplan — nur die im Mauerwerk freigelegte, leider durch den barocken
Hochaltar und das Chorgestühl verdeckte Apsis. Sie zeigt das für die frühchristl. Architektur Neapels charakteristische Motiv der offenen Säulenarkaden (vgl. S. Giorgio Maggiore, S. Gennaro extra moenia) in seiner reichsten Ausprägung: im Mittelteil 5 hohe Bögen auf radial gestellten Stützenpaaren (außen korinthische Säulen, innen reich ornamentierte Vierkantpfeiler mit eigenen korinthischen Kapitellen), die jeweils einen gemeinsamen Kämpfer tragen; die seitlichen Abschnitte der Apsisrundung enthalten weitere Bogenstellungen von rhythmisch wechselnder Höhe; 2 große antike Säulen mit Kämpfern des 6. Jh. stehen an den modernen Vierungspfeilern zu seiten der Apsis.
Im Mittelschiff, zwischen dem 2. und 3. Pfeiler links, befinden sich Fragmente zweier ungewöhnlich schöner alter Schrankenplatten. Der graziöse Schwan mit dem Christus-Monogramm hat seine nächsten Verwandten in der oberitalien., v. a. ravennatischen Plastik des 6./7. Jh.; das große Relief mit Hirsch, Flügelroß und anderen Tieren in vielfältig verschlungenem Rankenwerk scheint gegen Ende des 12. Jh. entstanden zu sein und ist ein hervorragendes Beispiel jener in Kampanien so häufig anzutreffenden dekorativen Plastik, deren Motive sich durch die Vermittlung byzantin. Seidenstoffe bis in die sassanidische Kunst des 4. Jh. zurückverfolgen lassen. — Ein weiteres Bildwerk des 12. oder 13. Jh., ein hölzernes Kruzifix mit Maria und Johannes, wird in einem Oratorium neben dem linken Querschiff verwahrt (derzeit nicht zugänglich).
Das Fresko der Eingangswand, die Predigt des Johannes, stammt von Gius. de Vivo (1730). Am Beginn des linken Seitenschiffes hängt eine Verkündigung von Fr. Salviati; in der 3. Seitenkapelle links ein schönes marmornes Altarretabel (Kreuzigung und Taufe Christi mit den hll. Francesco da Paola und Giacomo della Marca) aus dem Umkreis des Giovanni da Nola; die 5. Seitenkapelle links enthält ein 1550 datiertes Relief (Martyrium des hl. Hadrian) und eine Grablegung von Leonardo da Pistoia; im Querschiff links ein großer Kreuzigungsaltar mit Statuen des Konstantin und der Helena von Lor. Vaccaro.
S. Giovanni a Mare (im Hafenviertel, ein Stück westl. von S. Eligio, dessen Pfarrei heute hier verwaltet wird; den Eingang bildet das Portal Via S. Giovanni a Mare 8 mit der Aufschrift »Parocchia di S. Eligio Maggiore«)
Als Kirche eines Johanniterhospitals wird S. Giovanni 1186 erstmals genannt; am diese Zeit dürfte auch der Kernbau der heutigen Anlage entstanden sein, den die kürzlich abgeschlossene Restaurierung wieder freigelegt hat.
Er zeigt charakteristische Elemente der vorgot. Architektur
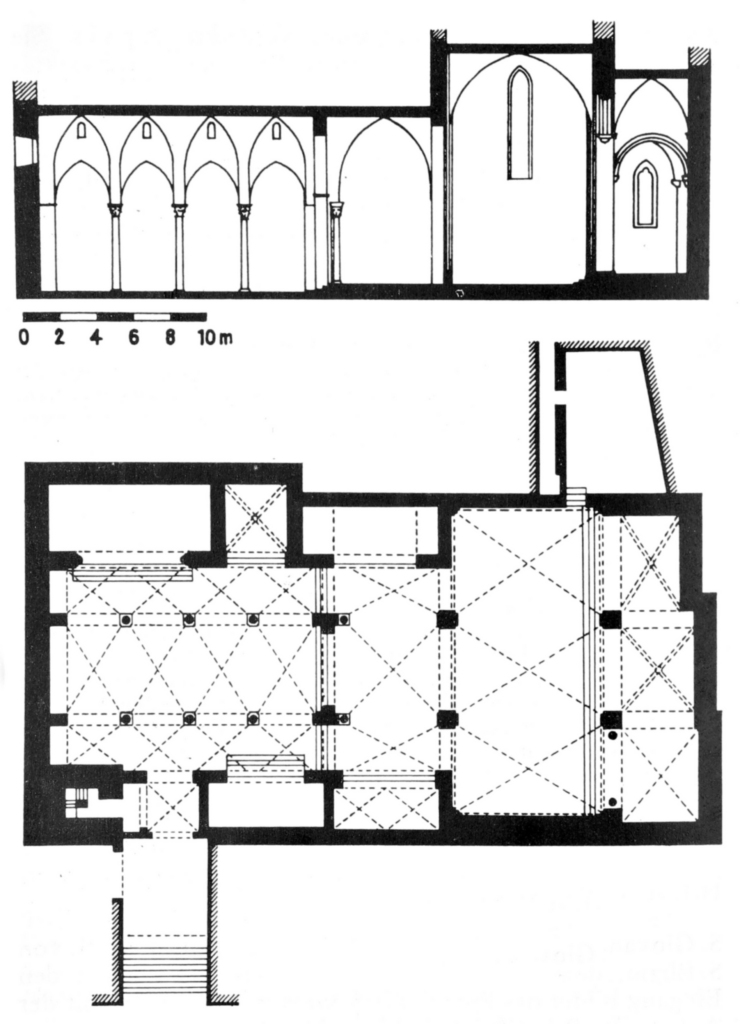 S. Giovanni a Mare. Längsschnitt und Grundriß
S. Giovanni a Mare. Längsschnitt und Grundriß
Kampaniens und bildet das einzige in Neapel erhaltene Denkmal dieser Epoche. 6 antike Säulen verschiedenster Größe und Herkunft teilen das Langhaus in 4 Traveen mit quadratischen Seiten- und querrechteckigen Mittelschiffjochen; über ihnen erheben sich
scharfkantige Kreuzgratgewölbe mit horizontal durchlaufenden Spitzbogenscheiteln, wie man sie aus gleichzeitigen Bauten des amalfitanischen Küstengebiets kennt (Amalfi, Scala, Badia di Cava). Das Mittelschiff ist leicht überhöht, so daß zwischen Arkaden und Gewölbeschildbögen lünettenförmige Wandfelder entstehen, deren jedes ein scheitelrecht sitzendes, schmales Schlitzfenster aufweist; flache Wandvorlagen, von den Deckplatten der Säulen aufsteigend, markieren die Jochgrenzen und gehen ohne Absatz ins Gewölbe über. Am östl. Ende des Mittelschiffs ist ein massiver 4kantiger Gurtbogen eingezogen. Das Querschiff besitzt 3 Joche (quadratische Vierung, längsrechteckige Abseiten) mit Kreuzgratgewölben von gleichem Schnitt, in der Scheitelhöhe des Mittelschiffs; an den westl. Vierungspfeilern stehen noch 2 schöne Spoliensäulen. — Einem Erweiterungsbau der aragonesischen Epoche gehört das folgende 2. Querschiff an, mit ähnlichen Wölbungsformen (restaur.?), aber höherem Scheitel; daran schließen sich 3 miteinander kommunizierende kreuzrippengewölbte Chorkapellen mit plattem Schluß; der Schildbogen der rechten Kapelle sitzt wiederum auf Spoliensäulen, die der beiden anderen auf prismatischen Konsolen. Gleichfalls aragonesisch sind die unregelmäßig angesetzten Seitenkapellen des Langhauses.
S. Giovanni dei Pappacoda (am Largo S. Giovanni Maggiore)
Eine Gründung des 1433 verstorbenen Artusio Pappacoda, Grafen von Pappasidero und Abatemarco, der unter König Ladislaus und seiner Nachfolgerin Johanna II. die höchsten Hofämter bekleidete.
Die Kirche ist berühmt wegen ihres reich skulptierten Eingangsportals, das zu den letzten Manifestationen der neapolitan. Gotik zählt (inschriftlich dat. 1415). Die Zuschreibung an Antonio Baboccio beruht auf der weitgehenden Übereinstimmung mit dem Mittelportal des Domes (s. S. 114). — Das Obergeschoß des Campanile zeigt eine bizarre Mischung von spätgot.-durazzesken Zierformen und eingemauerten antiken Büsten, Masken und Sarkophagfragmenten. — Das Innere des sonst schmucklosen Baues (1772 restaur.) enthält die Grabmäler zweier Bischöfe des 16. Jh., Angelo und Sigismondo Pappacoda.
SS. Giovanni e Teresa (oder S. Teresa all’Arco Mirelli; die obere der beiden Kirchen an der Via dell’Arco Mirelli in Mergellina, zwischen Riviera di Chiaia und Corso Vittorio Emanuele; zu keiner anderen Zeit als morgens von 6 bis 8 Uhr geöffnet)
Es handelt sich um eine Klosterkirche der Theresianerinnen (Carmelitane Scalze), von Angelo Carasale, Gehilfe oder Bauführer D. A. Vaccaros, am die Mitte des 18. Jh. errichtet, 1757 fertiggestellt.
Die Fassade ist nach dem Vorbild Borrominis (S. Agnese in Piazza Navona in Rom) aus der Straßenflucht zurückgesetzt und von 2 rechtwinklig vorspringenden Flügeln mit konkav ausgerundeten Ecken gerahmt; eine durchlaufende rhythmisch bewegte Pilasterordnung mit Nischen und Blendfenstern faßt das Ganze zu einem Prospekt von festlicher Wirkung zusammen.
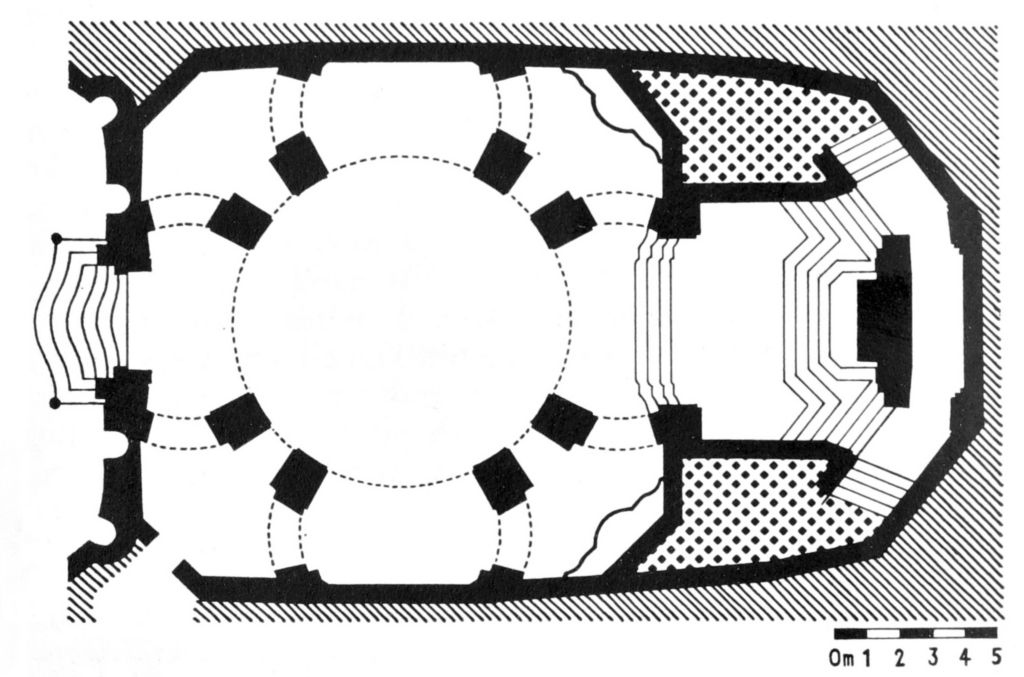 SS. Giovanni e Teresa. Grundriß
SS. Giovanni e Teresa. Grundriß
Der Grundriß des Innenraums gibt eine rokokohaft gefällige Abwandlung von Vaccaros Chiesa della Concezione. Innerhalb der kreuzförmigen, vollkommen zentralsymmetrischen Anlage dominiert der zylindrische Kuppelraum von sehr hohen, steilen Proportionen. Die Kreuzarme werden vom Kuppelkreis angeschnitten und auch seitlich von konvex ausbiegenden (»windschiefen«) Bögen begrenzt; erst die geradlinig geführten Außenwände bringen den schwingenden Rhythmus der Räume zum Halten. Die Eckpfeiler sind wie in der »Concezione« von Nebenräumen und Coretti durchbrochen. Im Kuppeltambour wechseln breite und schmale Fensteröffnungen, wobei die Hauptfenster, wie-
der in Anlehnung an die Kuppel des Vaccaro-Baus, nicht der Krümmung der Tambourwände folgen, sondern in der Ebene liegen, sodaß das Rund in dieser Zone sich andeutungsweise zum Quadrat mit abgerundeten Ecken verformt. Der ganze Chorteil, mit weit ausladender Apsis und Treppenanlagen, scheint neueren Datums. Die Stuckdekoration, mit weißem Gliederwerk auf grauem Grund, ist von magerer Eleganz und höchst geistreich im Detail (Doppelverkröpfung über den großen Pilasterpaaren, die erst im Gesims zu einem einzigen Vorsprung zusammengefaßt werden; Lisenen mit Blattvoluten im Tambour).
Die Bilder der Seitenaltäre, Hl. Familie mit den hll. Johannes, Joachim und Anna (rechts) und Kalvarienberg (links), sind von Gius. Bonito.
S. Giuseppe a Chiaia (Riviera di Chiaia)
Als Kirche eines Jesuitennoviziats 1666-73 von dem sonst unbekannten Jesuitenarchitekten Tommaso Carrarese errichtet.
Hinter der schmucklosen Fassade vom Anfang des 19. Jh. verbirgt sich ein sehr reizvoller Innenraum, dessen Architektur- und Dekorationsformen stark von Fanzago beeinflußt scheinen. Man betritt zunächst eine 3bogige Vorhalle mit Kreuzgewölben zwischen breiten Doppelgurten und einem schönen marmornen Eingangsportal; über ihr liegt im Innern eine Orgeltribüne (vgl. die Anordnung der Nonnenchöre in S. Gregorio Armeno, S. Maria Regina Coeli und anderen neapolitan. Klosterkirchen des 17. Jh.). Das Schiff ist rechteckig und hat eine durch 2 große Stichkappen angeschnittene Tonnenwölbung. Innerhalb einer rahmenden Hauptordnung aus gekuppelten korinthischen Pilastern sind die Längswände in offene Säulenstellungen nach Art des »Palladio-Motivs« aufgelöst: Über je 2 prächtigen grauen Marmorsäulen mit frei variierten ionischen Kapitellen Wölbt sich ein Mittelbogen, flankiert von architravierten Seitenöffnungen. Unter den Bögen — in der Querachse des Raumes — liegen große Altäre; die Nebenabschnitte sind 2geschossig unterteilt, so daß die von der Jesuitenregel geforderten »coretti« über den Architraven Platz finden.
Phantasievolle Stuckdekorationen mit Ranken, Rosetten, Putten, Karyatiden und Heiligenbüsten in der Art Fanzagos schmücken die Wände und Decken. Die quadratische Chorkapelle hat einen Hochaltar mit gekuppelten Säulen und
vielfach gekröpftem Segmentgiebel über konkav gekrümmtem Grundriß; in den Seitenwänden nochmals Coretti.
Das Hochaltarbild (Hl. Familie) ist von Francesco de Maria, die Bilder der Seitenwände des Chores (Ankündigung der Reise nach Ägypten und Josephs Tod) malte Giac. Farelli. Am linken Seitenaltar ein schöner hl. Ignatius von Luca Giordano, daneben die hll. Franz Xaver und Francesco Borgia, aus dem Umkreis des Meisters; am rechten Altar Anna, Joachim und die kleine Maria, von N. Malinconico; an der Eingangswand Verkündigung und Traum Josephs, von Antonio Sarnelli.
S. Giuseppe dei Nudi (in der gleichnamigen Straße zwischen Museo Nazionale und Via Salvator Rosa; das Innere von 8 bis 9.30 Uhr geöffnet). Die Kirche wurde im 18. Jh. von einer Kaufmannsbruderschaft gegründet, die sich das barmherzige Werk der »Kleidung der Nackten« Zur Aufgabe ‚gemacht hatte und alljährlich am Josephstag Kleidungsstücke an die Armen verteilte. Als Architekt wird ein sonst unbekannter Giovanni del Sarto genannt. — Die Fassade, mit halb vermauerter Vorhalle, zeigt hübsche Stuckdekorationen. Das Innere, ein harmonisch proportionierter Zentralkuppelbau mit kurzen Kreuzarmen und flachen Apsiden, ist gleichfalls ausstuckiert und einheitlich weiß und hellorange verputzt. Das Hochaltarbild (von Melchiore de Gregorio, 1786) illustriert den frommen Zweck der Stiftung.
S. Giuseppe dei Ruffo (an der Ecke der gleichnamigen Straße mit der Via del Duomo)
Seine Entstehung verdankt der Bau 2 vornehmen Neapolitanerinnen, Caterina und Ippolita Ruffo, die i. J. 1604 beschlossen, sich von der Welt zurückzuziehen und im Verein mit gleichgesinnten Freundinnen religiösen Übungen hinzugehen. Für das daraus hervorgegangene Augustinerinnenkloster wurde 1682 die heutige Kirche errichtet. Architekt war der im Umkreis Cos. Fanzagos tätige Dionisio Lazzari; die Eingangsfront wurde von Marcello Guglielmelli hinzugefügt, viell. auch nur in ihren oberen Partien von ihm zu Ende geführt (1724 im Bau).
Das Untergeschoß der Fassade besteht aus einer 3fach geöffneten Pfeilerhalle, die nach dem Vorbild Fanzagos (S. Maria della Sapienza, S. Giuseppe delle Scalze) eine zum Niveau des Schiffes hinaufführende Treppenanlage enthält.
Die beiden seitlich aufsteigenden Läufe vereinigen sich zu einer Plattform, deren nach außen vorspringender Balkon den Mittelbogen der Vorhalle ausfüllt. Im Aufriß ist die ganze Treppenzone als Sockel behandelt; ein kräftiges Basament markiert die Fußlinie des darüber aufgehenden Hauptgeschosses, dessen Pfeilerstirnen durch korinthische Pflaster wirksam gegliedert werden. In die Laibungen eingestellte dorische Säulen schaffen zusätzliche plastische Akzente: Sie
tragen die Architrave des zwischen die Pfeiler eingespannten »Palladio-Motivs« (Mittelbogen zwischen gerade geschlossenen Seitenöffnungen). Als unerwarteter Temperamentsausbruch, der die trockene Würde des Ganzen ernstlich in Frage stellt, erscheinen über den Architraven der Treppenaufgänge 2 fröhlich ausschweifende Dreipaßfenster im »barocchetto«-Stil. Das sehr viel freier wirkende Obergeschoß bringt, zwischen Schneckenvoluten, eine vielfach gebündelte Kompositordnung; der kompliziert geschwungene Giebel ist Borrominis SS.-Apostoli-Altar nachempfunden.
Das Innere überrascht zunächst durch seine bescheidenen Abmessungen, die, nach dem pompösen Auftakt der Vorhallenfront, einen beinahe intimen Eindruck hervorrufen. Das geläufige Schema des kreuzförmigen Saales mit Kapellen und Vierungskuppel erscheint durch Beschränkung der Seitenkapellen auf die 2 mittleren Langhausjoche rhythmisch abgewandelt. Die von Guglielmelli geschaffene oder übergangene Dekoration entspricht in der Verschmelzung von tektonischen mit rein flächenrahmenden Elementen bereits dem Geschmack des Settecento. Ein instruktives Beispiel für die im neapolitan. Spätbarock wirksame »manieristische« Grundhaltung zeigt sich im Kuppeltambour: Fuß- und Kranzgesims sind in hin und her springendem Wechselrhythmus verkröpft, das eine unterhalb der Fenstersockel, das andere aber über den Wandabschnitten zwischen den Fenstern, wo gerahmte und mit Figuren ausgemalte Felder die Stelle der traditionellen Pilasterordnung vertreten.
Hauptstück der Ausstattung ist die Trinità von Luca Giordano im Querschiff links, in kolossaler Rahmenarchitektur mit den Marmorstatuen des Petrus und Paulus von Bartolomeo und Pietro Ghetti; gegenüber eine Hl. Familie von Pomarancio; in der 2. Langhauskapelle links ein Gekreuzigter von Giacinto Diana (1785).
S. Giuseppe delle Scalze (an der Salita Pontecorvo, die oberhalb der Piazza Dante am Abhang des Vomero hinaufführt)
Als Kirche eines Theresianerinnenkonvents 1643-60 von Fanzago erbaut.
Den Niveau-Unterschied zwischen Straße und Kirchenschiff überwindet eine große 2armige Treppenanlage im Innern der Vorhalle (vgl. dazu S. Giuseppe dei Ruffo, Gesù delle Monache, Madonna del Rosariello). Die Fassade hat
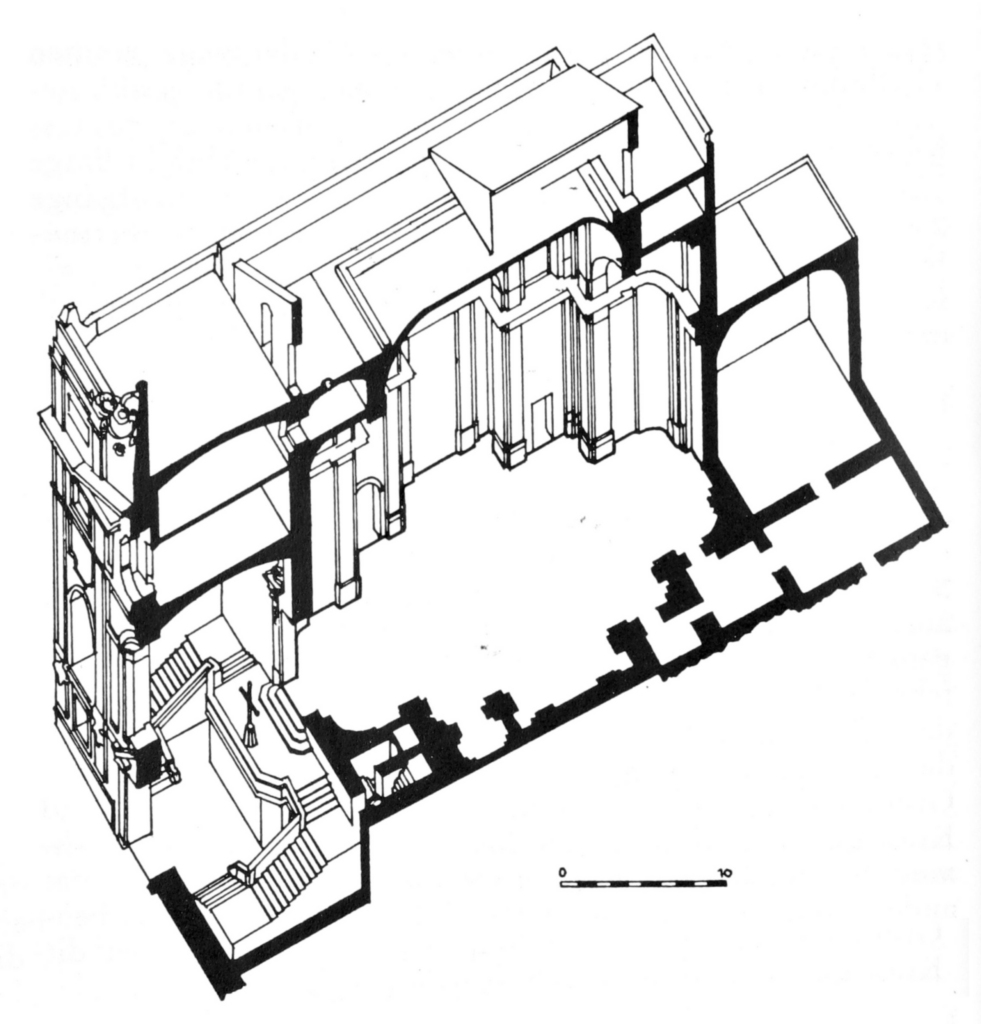 S. Giuseppe delle Scalze. Schnitt
S. Giuseppe delle Scalze. Schnitt
3 offene Bögen mit frei stehenden Statuen (hl. Therese von Avila, Joseph, Petrus von Alcantara), darüber Relief-Tondi mit Büsten weiterer Heiliger, alles von Fanzagos Hand. Figürliche Plastik und Rahmenornamente bilden ein dichtes und reiches Flächenmuster, in dem auch die Fragmente der architektonischen »Ordnung« — Pflaster, »Palladio-Motiv«, Dreiecksgiebel — mit aufgehen. Das Rocaillewerk der Attika über dem Giebel ist wohl erst im 18. Jh. hinzugefügt worden. — Das Innere, durch eine Restaurierung des 19. Jh. verunziert, zeigt die für Fanzago charakteristische Form eines »Längszentralbaus«. Ein muldengewölbter Rechtecksaal wird von 4 Kreuzarmen angeschnitten; die seitlichen bilden weite und flache Nebenkapellen, die der Längsachse abgeplattete Apsiden (Eingangs- und Altarraum). — Am
Hochaltar ein Luca Giordano (der hl. Joseph mit Christus und Gottvater), sonst nichts Bedeutendes.
S. Giuseppe dei Vecchi (Via Salvatore Tommasi, Parallelstraße zur Via S. Giuseppe dei Nudi, oberhalb von S. Potito) Die Kirche gilt als Frühwerk Fanzagos und soll 1617 begonnen, aber erst 1669 beendet worden sein. Seit dem Bau der unterirdischen Eisenbahnlinie Napoli-Pozzuoli, die direkt unter der Kirche hindurchführt, ist sie einsturzgefährdet und mußte durch allenthalben eingezogene Stützmauern gesichert werden. Das Innere, heute unzugänglich, zeigt den für Fanzago charakteristischen Zentralkuppelraum über griech. Kreuz.
S. Gregorio Armeno (auch S. Ligorio, neapolitanisch S. Liguoro; in der gleichnamigen Straße zwischen Via dei Tribunali und Via S. Biagio dei Librai)
Die Kirche ist sehenswert wegen ihrer reichen, unversehrt auf uns gekommenen barocken Innenausstattung.
Wahrscheinl. im 8. Jh., z. Z. des Bilderstreits, landete eine kleine Schar griech. Nonnen, den Schädel des Armenierbischofs Gregor mit sich führend, in Neapel. Das von ihnen gegründete Kloster, das im Laufe der Zeit eine bedeutende Ausdehnung annahm, wird 930 zum ersten Mal erwähnt. Nach den Beschlüssen des Tridentiner Konzils wurde den bis dahin recht freizügig lebenden Damen i. J. 1570 strengste Klausur auferlegt. Dies gab den Anlaß zum Bau einer neuen, zweckmäßiger eingerichteten Kirche (1572-80) durch den Architekten Giambattista Cavagna; an der Dekoration wurde bis zur Mitte des 18. Jh. gearbeitet.
Die Via S. Gregorio Armeno, die noch immer eines der heitersten neapolitan. Straßenbilder bietet, wird beherrscht von dem leuchtend gelb-rot verputzten Campanile der Kirche (18. Jh.); er erhebt sich über einem gewölbten Straßendurchgang, der die 2 Teile des alten Konvents miteinander verbindet. Cavagnas Kirchenfassade dagegen wirkt eher düster: Die schwer vergitterten Türen und Fenster sowie die Wahl der Ordnung (Rustika, Dorika) bringen drastisch die Strenge der neuen Klosterregel zum Ausdruck.
Die Arkaden des Untergeschosses führen in eine 3 x 3 Joche tiefe Vorhalle mit Kreuzgewölben auf quadratischen Pfeilern ; über ihr liegt der nach innen geöffnete Nonnenchor — eine an den Trecento-Bau von S. Maria di Donnaregina anknüpfende Disposition, die alsbald an anderen Nonnenklosterkirchen der Stadt nachgeahmt wurde (vgl. etwa S. Maria Regina Coeli, S. Potito, S. Sebastiano) und bis ins 18. Jh. (S. Caterina da Siena) für Neapel charakteristisch blieb. Erst im 18. Jh. wurde das 3. Fassadengeschoß hinzu-
gefügt; dahinter verbirgt sich ein weiterer Chorraum, dessen Insassinnen, vom Kirchenschiff aus nicht sichtbar, nur durch Öffnungen im Rahmen des 2. Ovalbildes der Kirchendecke die am Altar zelebrierte Messe verfolgen können.
Das Innere ist noch heute, nachdem der Glanz des Goldes erblindet, die Farben verblaßt sind, von atemberauben-g der Pracht; ein Autor des 18. Jh. schreibt, die Kirche habe an Festtagen einer »stanza di paradiso in terra« geglichen. Dabei ist die Grundform des Raumes von äußerster Einfachheit: ein flachgedeckter Rechtecksaal mit hohem Fenstergaden, je 5 Seitenkapellen und überkuppeltem Presbyterium. Wohl schon seit der 2. Hälfte des 17. Jh. (genaue Daten sind nicht bekannt) überzogen Marmorari und Stukkateure, Kunstschmiede, Holzschnitzer und Vergolder Wände und Öffnungen mit einem Netzwerk erlesenster Dekorationen, an denen man die Entwicklung des von Fanzago inaugurierten Ornamentstils studieren kann; besondere Prunkstücke bilden die Brüstung der über dem Eingang gelegenen Nonnenempore, die phantastischen Marmor- und Bronzegitter der Seitenkapellen und die beiden Sänger- und Orgeltribünen am Ende des Langhauses. Am Triumphbogen schwebt eine von Wolken und Engeln umgebene Wappenkartusche mit einer Taube; sie findet, für den Blick vom Eingang her, ihre Fortsetzung in der Marienglorie über dem Hochaltar.
Luca Giordano, Freskenzyklus: Der heilige Gregor der Erleuchter in der Glorie, 1678, San Gregorio Armeno (Kuppel) in Neapel.
Luca Giordano, Freskenzyklus: Der heilige Gregor der Erleuchter in der Glorie, 1678, San Gregorio Armeno (Kuppel) in Neapel.
Luca Giordano, Szenen aus dem Leben des heiligen Benedikt: Die Bekehrung des Königs Totila, 1678, San Gregorio Armeno (Chor)
in Neapel.
Ausstattung. Noch aus der Bauzeit der Kirche (1580) stammt die mit üppig vergoldetem Schnitzwerk prunkende Holzdecke; in die ovalen Rahmen der Mittelachse sind 4 Leinwandbilder jenes »Teodoro Fiammingo« eingelassen, der auch in S. Maria Donnaromita tätig war: Mariae Himmelfahrt (über der Nonnenempore), der hl. Benedikt mit seinen Ordensbrüdern Maurus und Placidus, der hl. Gregor von Armenien und die Enthauptung Johannes’ d. T.
100 Jahre später, 1678/79, schuf Luca Giordano den rings um die Wände laufenden Freskenzyklus; er bildet, unbeschadet der mangelhaften Erhaltung, eines der herrlichsten Zeugnisse seines heute beinahe verschollenen Malerruhms. In gutem Zustand sind die 3 Bilder der Eingangswand unter dem Nonnenchor (bes. wirksam im Fernblick vom Hochaltar her; bestes Licht am frühen Nachmittag). Sie schildern die Vorgeschichte der Klostergründung: links die Ausfahrt des Flüchtlingsschiffes aus einer idyllisch begrünten, von sonnigem Nebel erfüllten Meeresbucht; im Mittelbild ziehen die Nonnen, in Neapel gelandet, mit ihrem Reliquienschrein den Strand herauf (im Hintergrund Castel dell’Ovo); St. Gregor,
der ihre Fahrt beschirmt hat, schwebt mit wehendem Mantel und Bischofsstab über sie hin, das Volk von Neapel ist andächtig in die Knie gesunken; rechts wird die Äbtissin vor Castel Nuevo willkommen geheißen. Ein sanfter Rhythmus geht durch Figuren und Landschaftsgründe und bindet die Episoden zur Einheit zusammen. Der Erzählton ist episch gelassen; das Wunderbare ereignet sich ganz human und manierlich, ohne jede auftrumpfende Dramatik. Die Pinselführung wirkt breit bis zur Flüchtigkeit, gebietet aber über alle nur denkbaren malerischen Nuancen; das gelegentlich Krude und Grobkörnige des Vorbilds Cortona hat sich zur hohen Kunst der Andeutung geläutert. — Das ereignisreiche Leben des hl. Gregor wird an den Hochwänden zwischen den Fenstern erzählt, eine Bildfolge, in der Giordanos gloriose Leichtigkeit der Erfindung, die natürliche Grazie seiner Figuren und die klaren, lichten Farbtöne seiner Palette höchste Triumphe feiern. Im Nonnenchor setzt sich der Zyklus mit Szenen aus der Vita St. Benedikts fort. Gleichfalls von Giordano stammen die Fresken der Kuppel — ein (weitgehend zerstörtes) »Paradiso«, zwischen den Tambourfenstern hl. Benediktinerinnen, in den Zwickeln Tugenden, in den Lünetten Moses, Josua, Melchisedek und Ruth — und an der linken Seitenwand des Presbyteriums ein gewaltiges Leinwandbild, »Moses schlägt Wasser aus dem Felsen«.
Seitenkapellen links: 1. Geburt Christi von Ippolito Borghese (um 1612). Die 2. Kapelle enthält ein lebensgroßes Holzkruzifix aus der 2. Hälfte des 15. Jh., einen der seltenen Höhepunkte der süditalien. Quattrocento-Plastik (urspr. wohl polychrom, heute braun übermalt). Der pathetisch gesteigerte Ausdruck des Leidens, der den überaus fein modellierten Körper wie auch das Antlitz Christi beseelt, läßt an einen sizilianischen (hispano-flämisch beeinflußten) Meister denken; ein Gegenstück findet sich im Museo Nazionale zu Messina. 3. Enthauptung Johannes’ d. T. von Silvestro Buono. 4. Ein sehr schöner hl. Benedikt, wohl von Fracanzano, dem Ribera sehr nahestehend. — Rechte Seite: 1. Verkündigung von Paceco di Rosa. 2. S. Donato, eine Statue von Sarnelli, mit einer älteren (wundertätigen) Hand. In der 3. Kapelle 3 sehr beachtliche Werke des Ribera-Schülers Francesco Fracanzano (1635); am Altar St. Gregor, links und rechts 2 Szenen aus seinem Leben (er wird aus einem See gezogen; er gibt dem Armenierkönig Tiridates, der wegen seines wüsten Lebenswandels in ein Schwein verwandelt worden war, seine menschliche Gestalt zurück). 4. Madonna del Rosario von Malinconico. — Den mit feinsten Marmorintarsien gezierten Hochaltar entwarf Dionisio Lazzari; das Bild (Himmelfahrt) stammt von Giovanni Bernardo Lama. — Die Sakristei (Zugang von der letzten Seitenkapelle links) hat ein Deckenfresko (Anbetung des hl. Sakraments) von Paolo de Matteis.
Francesco del Vecchio, Holzkruzifix, 1460, Neapel, S. Gregorio Armeno.
Die ausgedehnten Konventsgebäude wurden 1572-74 von Vincenzo della Monica errichtet und von F. A. Picchiatti (1644) und Dionisio Lazzari (1682) erweitert und umgebaut. Sie werden im allgemeinen streng ver-
schlossen gehalten; Damen mögen trotzdem ihr Glück versuchen. Der Eingang befindet sich an der NO-Ecke des Konvents (Via Giuseppe Maffei). Ein großes Rustika-Portal führt zunächst in eine hohe und schmale Eingangshalle mit flach ansteigender Rampentreppe; an den Wänden illusionistische Scheinarchitekturen, belebt von spielenden Kätzchen und Hunden, von Giacomo del Pò. — Der große Kreuzgang (Rundbogenarkaden auf quadratischen Pfeilern, darüber ein Terrassenumgang, an dem die Klosterzellen liegen) stammt von Vincenzo della Monica (2. Hälfte 16. Jh.). Im Zentrum des Gartens eine marmorne Brunnenanlage mit Masken, Delphinen und Hippokampen, daneben zu ebener Erde 2 Statuen von Matteo Bottiglieri (um 1730), die nach Art eines lebenden Bildes die Begegnung Christi mit der Samariterin am Brunnen darstellen. — Im Inneren sieht man u. a. die 1712 erneuerte Cappella di S. Maria dell’Idria (Hodegetria, eine byzantin. Marientafel) mit 18 Bildern aus dem Marienleben von Paolo de Matteis, eine trecenteske Holzmadonna und 2 vorzügliche Kruzifixe des späteren 15. Jh.; außerdem eine Reliquie mit dem Blut der hl. Patrizia, das sich unter der Wirkung andächtiger Gebete verflüssigt, und eine fabelhafte Kollektion moderner Ex-voto-Bilder.
Chiesa dell’Immacolata Concezione di Suor Orsola (Salita Suor Orsola‚ oberhalb des Corso Vittorio Emanuele, in der Nähe der Piazzetta Cariati)
Die sel. Orsola Benincasa starb nach einem Leben von aufsehenerregender Frömmigkeit zu Neapel i. J. 1618. Auf dem Totenbett versprach sie den Abgesandten der Sedili, sich fortan stets für die Stadt verwenden zu wollen; darauf wurde ihr die Gründung eines Konvents zugesagt, der ihren Namen tragen und an einem Ort liegen sollte, den die Selige schon als 7jähriges Kind für diesen Zweck ausgesucht hatte. Während der Pest von 1656 wurde Suor Orsola offiziell zur Schutzpatronin der Stadt erklärt. 1633 wurde der Bau des Konvents begonnen, 1670 zogen die Nonnen ein und nahmen eine von den Theatinern ausgearbeitete Regel von äußerster Strenge an, die ihnen den Zunamen »le sepolte vive« (die lebendig Begrabenen) eintrug.
Die stark veränderten Gebäude gehören heute dem Pädagogischen Institut der Universität (Istituto Suor Orsola Benincasa). Nach Überwindung des Pförtners (nach »Segretaria« fragen) erreicht man durch ein Treppenhaus einen zauberhaften Garten, den ehem. Kreuzgang des Klosters mit Portiken des 17. Jh. — Die Kirche ist ein kurzer Saalbau mit je 3 Seitenkapellen und querelliptischer Kuppel; die Eingangsfassade hat (nach dem Vorbild von S. Gregorio Armeno) eine 2 x 3 Joche messende Vorhalle, darüber der nach innen geöffnete Nonnenchor. Sehr hübsche und vollständig erhaltene Ausstattung aus der Mitte des 18. Jh.; Fresken und Altarbilder von Fed. Fischetti.
Immacolata Concezione a Pizzofalcone (Via S. Maria Egiziaca) wurde 1856-59 von dem Architekten Francesco Jaoul errichtet, nach Bombenschäden 1946 erneuert. Der Innenraum wirkt erfreulich dank der reinen Durchführung des Kreuzkuppelschemas (Zentralkuppel auf 4 Freipfeilern, 4 Nebenkuppeln in den Eckräumen zwischen den Kreuzarmen).
S. Lorenzo Maggiore, Neapels schönste got. Kirche, liegt im Herzen des Altstadtgebiets (Piazza Gaetano, Via dei Tribunali).
Der Laurentius-Titel ist von dem Vorgängerbau übernommen, einer von Bischof Johannes II. (533-555) errichteten und prächtig ausgeschmückten Basilika. 1234 in den Besitz der Franziskaner gelangt, mußte das wohl ebenso baufällige wie ehrwürdige Gebäude alsbald dem heute stehenden Neubau Platz machen. Dessen Gründungsdatum dürfte um 1270 anzusetzen sein; im 3. Jahrzehnt des 14. Jh. wurde die durch wiederholte Stiftungen des Königshauses geförderte Kirche fertiggestellt. Erdbeben und barocke Restaurierungen dezimierten die urspr. Ausstattung des Gebäudes; die Bausubstanz jedoch hat sich so weit erhalten, daß man 1882 eine durchgreifende Wiederherstellung des got. Zustands einleiten konnte. Die seitdem immer wieder unterbrochenen Arbeiten stehen nunmehr vor ihrem Abschluß.
Vom got. Außenbau ist das strebebogenumstellte Chorobergeschoß zwar wohlerhalten, aber durch die umliegenden Bauten für den Blick verdeckt. Die massive Barockfassade der Eingangswand (von Ferdinando Sanfelice, 1743) umschließt das alte Spitzbogenportal mit der 1325 datierten Holztür (meist verschlossen: Zutritt zur Kirche durch die Seitenpforte in der Via dei Tribunali). Ein feines Quattrocento-Portal zur Rechten führt in den Franziskanerkonvent, wo die Regenten der mittelalterl. Stadtbezirke (»Sedili«)‚
deren Wappen im darüberliegenden Wandfeld angebracht sind, sich zu gemeinsamer Beratung versammelten (s. S. 20). Der benachbarte Campanile, 1487-1507 erb., diente zugleich als Rathausturm.
Das Innere von S. Lorenzo (Tafel S. 145) gehört auch in seinem gegenwärtigen, eher einer Baustelle ähnelnden Zustand zu den großen architektonischen Eindrücken der Stadt. Ein breiter und hoher Saal mit offenem Dachstuhl und je 9 Seitenkapellen bildet das Langhaus; auf den weitgespannten Triumphbogen, von korbbogenartigem Zuschnitt, folgen das gleichfalls holzgedeckte Querhaus und eine 3schiffige Choranlage mit polygonal gebrochener, aus 7 Seiten des Zwölfecks gebildeter Apsis, Umgang und Kapellenkranz.
Eingehende Grabungen im Bereich von Langhaus und Querschiff, ein willkommenes Nebenergebnis der jüngsten Restaurierungsarbeiten, haben die Entstehungsgeschichte dieses eigenartigen Komplexes wesentlich klären geholfen. Zuunterst stieß man, wie erwartet — die Piazza S. Gaetano liegt über der Agora der antiken Neapolis (s. S. 18) —, auf Spuren großer öffentlicher Gebäude, deren älteste bis ins 5. Jh. v. Chr. zurückreichen; demnach hätten die Institutionen der mittelalterl. Stadtregierung, die hier ihren Sitz hatten, den seltenen Ruhm beanspruchen dürfen, in unmittelbarer Nachfolge der griech. Polis-Demokratie zu stehen.
Über den antiken Mauerzügen liegen die Fundamente der alten Laurentius-Kirche, einer 3schiffigen Basilika mit geschlossenem Narthex, je 9 Säulenarkaden und halbrunder, von rechteckigen Nebenräumen (Pastophorien) flankierter Apsis. Ihre Mittelachse stimmt mit der des got. Baues überein; Narthex und Langhaus umfaßten das Areal des heutigen Hauptschiffs, die Apsis ragte bis etwa zur Mitte des Querschiffs vor. Die Lage der Pastophorien ist noch erkennbar an 2 freigelegten (z. Z. mit Brettern zugedeckten) marmornen Fußbodenmosaiken, kostbaren Exemplaren einer nicht häufig erhaltenen Gattung frühchristl. Dekorationskunst (vgl. Aquileia, Grado, Parenzo): zur Linken (Prothesis) ein Netz von Stern- und Achteckfeldern mit Vögeln, Blumen, Kreuzen, Brotkörben (Eucharistie?) und geometrischen Mustern; rechts (Diakonikon — leider nur fragmentarisch erhalten) ein hochkompliziertes Bandgeflecht mit gegenständigen Pfauenpaaren, Vasen, Fischen und Vögeln.
Nach Übernahme des Baues durch die Franziskaner war die Errichtung eines neuen, geräumigen Chores für den Mönchsgottesdienst das erste Erfordernis; übrigens konnte man diesen Teil des Neubaus in Angriff nehmen, ohne die alte Basilika. anzutasten. Bemerkenswerterweise stimmen die Grundmaße des Umgangschores mit den ergrabenen Fluchten des alten Langhauses genau überein; man scheint also zunächst erwogen zu haben, dieses soweit als möglich zu erhalten bzw. in Form einer got. Gewölbebasilika (etwa nach Art des gleichfalls von Karl I. begünstigten S. Eligio) zu restaurieren.
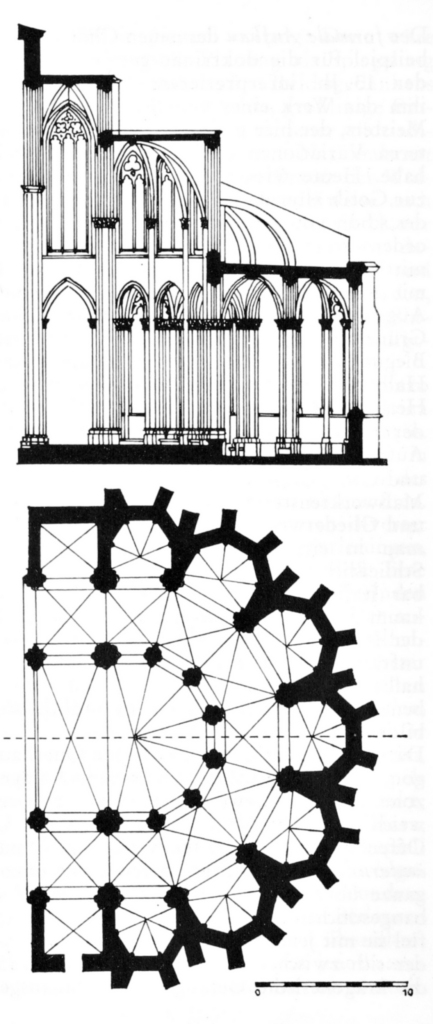 S. Lorenzo Maggiore. Chor, Längsschnitt und Grundriß
S. Lorenzo Maggiore. Chor, Längsschnitt und Grundriß
Der formale Aufbau des neuen Chores läßt sich als ein Schulbeispiel für die doktrinär gereinigte Gotik des ausgehenden 13. Jh. interpretieren. Die ältere Forschung sah in ihm das Werk eines vom König aus Frankreich gerufenen Meisters, der hier gleichsam das französ. Thema für die späteren Variationen der neapolitan. Trecento-Gotik geliefert habe. Heute wissen wir, daß die Beziehungen Süditaliens zur Gotik älter und auch vielfältiger waren; v. a. den Bauten des schon von den Hohenstaufen protegierten Zisterzienserordens scheint hier wie anderwärts eine bedeutsame Vermittlerrolle zuzukommen. Auch ist die Übereinstimmung mit französ. Mustern nicht so vollkommen, wie der erste Augenschein vermuten läßt. Entschieden italienisch wirkt die Grundform der Umgangspfeiler: quadratischer (bzw., in der Biegung des Polygons, trapezoidaler) Kern mit kräftigen Halbrundvorlagen, die, verglichen mit got. Diensten, ihre Herkunft von den antikisierenden Halbsäulengliederungen der italien. Romanik nicht verleugnen. Auch das 2geschossige Aufrißsystem (Fehlen eines »Triforiums« zwischen Arkaden und Obergaden) und die verhältnismäßig geringe Höhe der Maßwerkfenster tragen dazu bei, dem plastischen Mauer- und Gliederwerk der Wand mehr Gewicht zu verleihen, als man in einem rein französ. Bauwerk erwarten würde. Schließlich sprechen die Raumproportionen eine unverkennbar italien. Sprache: Die Scheitelhöhe der Apsis beträgt kaum mehr als das Doppelte ihrer Weite (in Frankreich in der Regel das Zweieinhalb- bis Dreifache); auch das ganz unfranzös. Aufsteigen der Arkadenöffnungen bis über die halbe Höhe der aufgehenden Wand zeugt von dem Bestreben, got. Enge und Steilheit ins Südlich-Weiträumige umzuwandeln.
Das Vorjoch des Chores, zwischen Querhaus und Apsispolygon, zeigt eine deutlich verschiedene Anlage: höhere Fensterzone, steilerer Gewölbequerschnitt, anderes Maßwerk, abweichender Grundriß der zugehörigen Umgangskapellen. Offenbar hat hier, im Weiterbau von O nach W, eine Planänderung stattgefunden, deren Konsequenzen sich auf das ganze übrige Gebäude erstreckten. Ihr Zeitpunkt läßt sich baugeschichtlich nicht sicher bestimmen; möglicherweise aber fiel sie mit jenem Wechsel des politischen Klimas zusammen, der sich zwischen dem Tode Karls I. (1285) und der durch die aragonesische Gefangenschaft hinausgezögerten Thron-
besteigung Karls II. (1289) in Neapel vollzog: Dann wäre der »kathedrale« Typus der ersten Planung als Spiegelung des noch hochmittelalterl.-universalistischen Reichsgedankens Karls I. zu verstehen, während der schlichte, großlinige Einheitsraum des neuen Langhauses den Aufstieg jener städtisch-bürgerlichen Kräfte repräsentierte, die den Nationalstaat Karls II. mitzutragen bestimmt waren. Der Ersatz der Wölbung durch ein Holzdach kommt bezeichnenderweise auch in anderen, noch basilikal angelegten Bauten Karls II. vor (Dom, S. Domenico, S. Pietro a Maiella); die Saalform dagegen (Verzicht auf Mehrschiffigkeit wie auf Querhaus und »Travéen«) war ein Spezifikum der italien. Bettelorden, v. a. der Franziskaner, in dem sich das Pathos urchristl. Einfachheit mit neuen funktionellen Erfordernissen (Predigtgottesdienst) verband.
Als unmittelbares Vorbild für das Langhaus von S. Lorenzo scheint die 1254 gegründete Franziskanerkirche von Messina in Frage zu kommen; wie weit außerdem mit südfranzös. Einflüssen gerechnet werden muß, an welche etwa die in Italien vordem nicht zu beobachtende Korbbogenform des Triumphbogens denken läßt, wäre genauer zu untersuchen. Die Struktur der Längswände zeigt noch Spuren diverser Planwechsel und auch eingreifender älterer Restaurierungen, die wohl durch Erdbebenschäden veranlaßt wurden. Eine fortlaufende Blendarkatur mit unregelmäßig wechselnden Bogenmaßen bildet den Rahmen für die etwas niedriger angesetzten, in einer zweiten Wandschicht liegenden Kapellenöffnungen (vgl. dazu S. Pietro a Maiella). Als Stützen dieser Arkadenreihe fungieren in den 4 östl. Jochen der rechten Wand massive Rechteckvorlagen, i. ü. antike Spoliensäulen, die möglicherweise der alten Basilika entstammen; dahinter sitzen breite Pfeilerkerne mit seitlichen Halbrundvorlagen, die die Kapellenbögen bedienen. — Für die Baukunst Neapels bedeutet das Langhaus von S. Lorenzo einen Wendepunkt; keiner der kirchlichen Großbauten des 14. Jh. (S. Chiara, S. Maria del Carmine, S. Pietro Martire) hat sich prinzipiell von dem hier eingeschlagenen Weg entfernt. Wer das organisch belebte Gliederwerk der nordischen Gotik bewundern gelernt hat, wird diese Entwicklung nicht ohne Bedauern verfolgen; auf der anderen Seite darf man nicht übersehen, daß erst mit unserem Bau der neapolitan. Gotik jene besondere Macht des Räumlichen zuwächst, die der mittelalterl.
Baukunst Süditaliens von jeher eigentümlich war. Daß es sich hier um bewußt kalkulierte Wirkungen handelt, zeigt die Gestaltung jener Nahtstelle zwischen Apsis und Querhaus, an welcher der Planwechsel zuerst in Erscheinung tritt.
Durch die Aufhöhung des Gewölbescheitels im Chorjoch ist über der Bogenöffnung der Apsis ein sichelförmiges Wandfeld entstanden; in ihm steht ein großes Rundfenster, das, für den Blick vom Eingang her, mit den seitlich angeordneten Okuli der Querschiffswand eine rein optisch wirksame Trias bildet. Dementsprechend hat auch der Umgangschor, nun im »Querschnitt« erscheinend und damit gleichsam zur 3-Apsiden-Gruppe umgedeutet, seinen urspr. Tiefenzug verloren; strukturell isoliert, wird er zum Teil einer Flächenkomposition, die dem Beschauer sogleich beim Betreten des Langhauses gegenübersteht und so den Raum auf neue, bildhafte Weise zusammenhält. So könnte, wie unlängst vermutet wurde, Arnolfo di Cambio diesen Raum gesehen und von ihm die Anregung zum Bau der großen Franziskanerkirche von Florenz, S. Croce, empfangen haben: schöpferischer Nachvollzug jener Befreiung vom Systemzwang der Gotik, die in S. Lorenzo halb zufällig aus der historischen Konstellation der Jahrhundertwende hervorging.
Das bedeutendste Stück der Ausstattung ist das Grabmal der Katharina von Österreich zwischen den ersten beiden Pfeilern des Chorumgangs rechts. Die 1295 geborene Habsburger Prinzessin war 1313 zur 2. Gemahlin des deutschen Kaisers Heinrich VII. von Luxemburg ausersehen werden, der jedoch starb, während der Brautzug noch unterwegs war. Wenig später wurde sie mit Herzog Karl von Kalabrien vermählt, dessen Vater Robert von Anjou den Bestand seines süditalien. Reiches durch die Allianz mit Österreich zu sichern trachtete. Nach 7jähriger kinderloser Ehe starb sie 1323. Im gleichen Jahr trat der sienesische Bildhauer und Giovanni-Pisano-Schüler Tino di Camaino, aus dessen Werkstatt das große, nur fragmentarisch erhaltene Grabmal Heinrichs VII. im Camposanto zu Pisa hervorgegangen war, in den Dienst des Hauses Anjou; und vieles spricht dafür, daß wir es hier mit der ersten neapolitan. Arbeit des Künstlers zu tun haben. Der architektonische Aufbau des Grabes freilich zeigt einen entschiedenen Bruch mit seinen toskanischen Werken. Handelt es sich dort um Wandgräber, bei denen der Sarkophag mit seinen Aufbauten und Figuren auf Mauerkonsolen ruhte, so sehen wir hier einen frei stehenden, von 4 Spiralsäulen auf Löwenpostamenten getragenen Baldachin; der Sarkophag wird von 2 Pfeilern mit als Tragefiguren ausgebildeten Tugendallegorien (»Hoffnung« und »Mildtätigkeit«) gestützt. Der
Gedanke des Freibaldachins ist hier möglicherweise von süditalien. röm. Traditionen beeinflußt (Königsgräber in der Kathedrale von Palermo, Fieschi-Grab in S. Lorenzo fuori le Mura). Vorbilder für die Tugendkaryatiden unter dem Sarg sucht man in nicht mehr erhaltenen neapolitan. Gräbern vom Ende des 13. Jh.; auch das Motiv der Heiligenfiguren, die paarweise zu Häupten und zu Füßen der Toten stehen, dürfte dort seinen Ursprung haben. Einzelheiten wie die gedrehten Säulen und die Verwendung von Mosaikornament lassen sich mit der röm. Cosmatenkunst in Verbindung bringen; die architektonischen Zierformen des Baldachins wiederum scheinen unmittelbar von der französ. Gotik beeinflußt. Um so reiner offenbart Tinos eigener Stil sich in den Figuren, v. a. in der weich vermittelnden Oberflächenbehandlung, dem sanften Linienfluß der Gewänder und der feinfühligen Organik der sparsam verteilten Bewegungsmotive (bes. kunstvoll die Ponderation der Caritas-Gruppe unter dem Fußende des Sarkophags).
Die mit Krone und Brokatmantel bekleidete Tote liegt starr ausgestreckt auf dem Leichentuch; einzig die Dreiviertelwendung des Kopfes mit der in feinem Bogen sich rundenden Halslinie setzt einen leisen Bewegungsakzent und erlaubt dem Betrachter einen Blick in das ebenmäßige, jugendlich-ausdruckslose Antlitz der noch nicht 30jährigen Herzogin. Die Langseiten des Sarkophags sind mit Halbfigurenreliefs geschmückt (Christus zwischen Maria und Johannes, Franziskus zwischen Dominikus und Klara). Weitere Reliefs befinden sich im Bogenfeld des Baldachins (außen: Der hl. Franz empfängt die Wundmale — ein in Plastik übersetztes Landschaftsbild, das an Giottos Formulierung des gleichen Stoffes in der Bardi-Kapelle von S. Croce in Florenz anknüpft; innen: Die Verstorbene kniet vor Christus dem Weltenrichter). Diese Tympanonreliefs sind für die Geschichte ihrer Kunstgattung von nicht zu überschätzender Bedeutung: In ihnen gelangt Tino zu einer neuen malerischen Synthese von Plastik und Mosaik (vorbereitet durch Niccolò und Giovanni Pisanos Versuche mit farbigem Glas in den Hintergründen ihrer Kanzelreliefs in Pisa, Siena und Pistoia).
Indem die Umrisse der Relieffiguren unmittelbar mit dem einheitlich mosaizierten Grunde zusammenstoßen, nimmt dieser räumlich-atmosphärische Bedeutung an; so wird aus dem gegenstandslosen Flächenornament (wie es noch an den Schauseiten des Sarkophags auftritt) »Himmel« im landschaftlichen wie auch im spirituellen Sinne (Außen- und Innenseite).
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Gesamtansicht von Süden, 1323, San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Sarkophag und Gisant, 1323, San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Außenseite: Agnus Dei und Stigmatisation des hl. Franziskus, 1323,
San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Tragefigur des Sarkophages, 1323, San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Tragefigur des Sarkophages, 1323, San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Katharina von Österreich, Kapitell, 1323, San Lorenzo Maggiore (Chor) in Neapel.
Etwa um die Mitte des 14. Jh. dürfte das lebensgroße hölzerne Kruzifix entstanden sein, das derzeit rechts neben dem Eingang der Kirche Aufstellung gefunden hat. Es handelt sich um das Werk eines kampanischen Meisters, das einen in der 1. Jahrhunderthälfte geprägten Typus wiederholt und durch eine verfeinerte Technik der Oberflächenbehandlung (V. a. in der Modellierung des Gesichtes) neu belebt. Die stellenweise recht grobe farbige Fassung ist modern. — Die neapolitan. Quattrocento-Plastik ist in erster Linie
durch den im Chorhaupt frei stehenden marmornen Hochaltar von Giovanni da Nola vertreten. Er enthält im Obergeschoß 3 in Nischen stehende Heiligenstatuen (Laurentius, Antonius und Franziskus); darunter feine Sockelreliefs, Marter- und Wunderszenen aus dem Leben der Patrone mit interessanten Neapel-Panoramen im Hintergrund. — Zu erwähnen sind ferner ein hübscher Terrakotta-Altar vom Anfang des 16. Jh. (Madonna mit Heiligen, darüber Pietà) in der 4. Langhauskapelle rechts und das Grabmal des Aniello Arcamone von Antonio de Marco (1513) in der 1. Chorumgangskapelle rechts.
Von den Werken der Freskomalerei, mit denen Querhaus und Chorkapellen im 14. Jh. geschmückt wurden, ist leider nur Fragmentarisches auf uns gekommen. Die 4. Umgangskapelle von links enthält, über 2 Trecento-Gräbern, einen Zyklus mit Darstellungen des Marienlebens, aus dem Umkreis der Incoronata-Fresken (vgl. S. 206), mit deutlichen Erinnerungen an Giottos Paduaner Werke (v. a. in den Hintergrundarchitekturen). In der Nachbarkapelle links steht auf dem Altar ein abgelöstes Fresko (urspr. in einer Seitenkapelle des Langhauses angebracht), die »Madonna della Greca«, von einem sienesisch beeinflußten Meister vom Ende des Trecento. — Aus dem Umkreis des Pietro Cavallini stammen 2 leider stark verschmutzte Freskenfragmente im rechten Querschiffarm, darstellend Geburt (rechts) und Tod (links) der Maria. In den intakt gebliebenen Partien v. a. des linken Bildes zeigt sich ein malerisches Können (man beachte den Reichtum an Schattentönen innerhalb einer Grundfarbe), das über den Durchschnitt der zeitgenössischen Produktion weit hinausragt; auch die grandios gezeichneten Köpfe der Maria wie der über sie gebeugten Jünger sind geeignet, die neuerdings versuchte Zuschreibung dieses Freskos an Cavallini selber zu stützen.
Der linke Querarm wurde 1638-49 von Cos. Fanzago zu einer prunkvollen Marmorkapelle mit hoher, schlanker Mittelkuppel umgebaut; auf dem Altar, in spätmanieristisch verschachteltem Rahmengehäuse, eine 1438 datierte Goldgrundtafel mit dem von Engeln umgebenen hl. Antonius, offenbar eine spätere Nachbildung des verlorenen Originals. — Von der 1. Umgangskapelle rechts gelangt man in die Sakristei, mit einem stark restaurierten Gewölbefresko (Glorie des hl. Franz) von L. Rodriguez (Anfang 17. Jh.); auf dem Altar eine vorzügliche Madonna Immacolata von dem Ribera-Nachfolger Cesare Fracanzano.
Von den anschließenden Konventsgebäuden kann derzeit nur der prächtige Settecento- Kreuzgang besichtigt werden (kuppelgewölbte Pfeilerloggien, darüber ein Fenstergeschoß — Zugang durch die letzte Seitenkapelle rechts des Kirchenschiffes). In der Lünette über der Eingangstür befindet sich ein Fresko, Madonna mit Stifter, sienesisch, 14. Jh. In der folgenden Wand ein got. Portal mit Lünettenfresko, Erteilung der Ordensregel an Franziskaner und Klarissen durch den hl. Franz, Ende 14. Jh. Dahinter der Kapitelsaal mit Kreuzgewölbe auf antiken Spoliensäulen, weitere Konventsräume und schließlich das Refektorium (nach-
mals Sitz des königlichen Parlaments), alle von dem Sizilianer Luigi Rodriguez ausgemalt (Anfang 17. Jh.).
San Lorenzo Maggiore, Innenansicht nach Osten, Neapel.
San Lorenzo Maggiore, Nordquerhaus, Kapelle des heiligen Antonius, Neapel.
San Lorenzo MAggiore, Chorraum von Südwesten, Neapel.
S. Lucia a Mare (in der gleichnamigen Straße zu Füßen des Pizzofalcone), der Legende nach bis in die Zeit Konstantins d. Gr. zurückgehend, hat dem berühmten Fischerviertel seinen Namen gegeben. Die älteste sicher belegte Nachricht stammt aus dem 9. Jh.; damals lag die Kirche direkt am Meer. Der heutige Bau enthält keine Spuren älterer Architektur: Zweimal von Grund auf erneuert (1599 und 1845), wurde die den Neapolitanern teure Kirche 1943 von Bomben zerstört und nach dem Kriege in den Formen des 19. Jh. wiederaufgebaut und modern ausgestattet. — Über der Sängertribüne ein stark restauriertes Rosenkranzbild von Francesco Curia; am Hochaltar eine Holzfigur der S. Lucia, Anfang 18. Jh.
Madonna del Rosariello (il Rosario al Largo delle Pigne; an der N-Seite der Piazza Cavour, schräg gegenüber dem U-Bahn-Eingang) wurde zu Ende des 17. Jh. von Arcangelo Guglielmelli erbaut. Die ionische Doppelpilasterordnung der Fassade liefert den betont nüchternen Rahmen für das neapolitan.-barocke Mittelmotiv: eine von Putten umspielte Rosenkranz-Madonna steht frei vor dem dunklen Hintergrund einer rundbogigen Öffnung, durch die man von außen her in das Gewölbe der Vorhalle blickt (ähnliche Lösungen schon an den Kirchen Gesù delle Monache und S. Giuseppe dei Ruffo). 2 leicht geschwungene steile Treppenläufe im Innern der Eingangshalle führen in das (höher am Berghang gelegene) Kirchenschiff hinauf. Die Raumform ist komplizierter, als der erste Augenschein erkennen läßt. Zugrunde liegt das griech. Kreuz mit Vierungskuppel; allein hier wie anderwärts (vgl. etwa Vaccaros Chiesa della Concezione a Monte Calvario) geht das Bestreben des Architekten dahin, innerhalb des gewählten Zentralschemas unmerklich die Längsachse zu betonen. So sind die Querarme nicht nur kürzer (so daß in ihren Seitenwänden anstelle der Nebenkapellen nur noch kleine Mauernischen Platz finden), sondern auch enger als die Längsarme. Die Einziehung wird verschleiert durch in die Pfeilerecken eingestellte Vollsäulen, die nicht, wie man zunächst erwarten würde, die Kuppelpendentifs, sondern den einspringenden Gurtbogen des Querarms tragen. Der gleiche durch Säulen vermittelte Übergang findet zwischen dem Chorarm und der anschließenden, etwas eingezogenen Rechteckapsis statt. Dies gibt dem Bild des Innenraums eine reiche Staffelung, »malerische« Auflockerung des strengen Kreuzkuppelschemas — im Effekt wie in den Mitteln ein spätbarock gedämpfter Nachklang von C. Rainaldis S. Maria in Campitelli in Rom.
SS. Marcellino e Festo (Largo S. Marcellino, gegenüber von SS. Severino e Sossio)
Die Kirche eines im 8. Jh. gegründeten Benediktinerklosters S. Festo, das im 16. Jh. mit dem benachbarten Konvent von SS. Marcellino e Pietro zusammengelegt wurde. Der heutige Ban, entworfen von Giovanni Giacomo Conforto, entstand 1626-45 und wurde im 18. Jh. mehrfach restauriert, a. a. (von Vanvitelli, dessen Hand sich in den ionischen »Michelangelo«-Kapitellen der sehr reizvollen Vorhalle verrät. Leider wurde der Bau im Kriege so schwer beschädigt, daß er heute nicht betreten werden kann.
Die Guiden rühmen die prächtige Marmorausstattung (1759-67); die
Holzdecke mit Leinwandbildern von Stanzione (1630-43) und Azzolino; Kuppel- und Gewölbefresken von Corenzio (1630-40); Bilder von Caracciolo, Simonelli, Starace; den marmornen Hochaltar mit den Statuen der Titelheiligen von Dionisio Lazzari (1666). Die Sängerempore über der Vorhalle hat eine herrliche durchbrochene Brüstung des 18. Jh.
Die Geschichte des zugehörigen Basilianerklosters SS. Marcellino e Pietro (Eingang Largo S. Marcellino 10), das den röm. Märtyrern Marcellinus und Petrus geweiht war, läßt sich gleichfalls bis ins 13. Jh. zurückverfolgen. Es wurde 1808 säkularisiert und bildet heute den Sitz des Geographisch-Geologischen Instituts der Universität. Aus dem Ende des 16. Jh. stammt der Kreuzgang, eine höchst malerische Gartenanlage, an 3 Seiten umgeben von einer Pfeilerloggia mit weiten, luftigen Arkaden und Terrassendach; im O erscheint die in allen Farben leuchtende Majolikakuppel von SS. Marcellino e Festo.
Das südl. angrenzende Oratorio della Scala Santa von Vanvitelli (1772) ist leider dem Neubau der Universitätsaula zum Opfer gefallen; erhalten hat sich nur der Vorhof mit schmucklosen Pfeilerarkaden in 3 Geschossen. Seine Rückwand ist als große flachbogige Exedra ausgebildet und umschließt eine hübsche Freitreppenanlage, alles in einfachster Putzgliederung: ein merkwürdiges Beispiel für den strengen Spätstil des Meisters.
S. Maria dell’Aiuto (in der gleichnamigen Gasse beim Palazzo Penna, zwischen S. Giovanni Maggiore und S. Maria la Nova) ist einem seit 1635 verehrten Marienbild gewidmet.
Der Bau wurde vor 1673 von Dionisio Lazzari errichtet, 1792 restauriert: ein überraschend schöner Zentralraum vom Typus der Gennaro-Kapelle des Domes, die 8 tragenden Pfeilerkanten mit korinthischen Freisäulen besetzt (vgl. dazu die Lösung des 16. Jh. in S. Maria della Vittoria); der Eingangsarm ist etwas verlängert und durch eine weitere Säulenstellung ausgezeichnet; die Ecken des gegenüberliegenden Apsisarms sind polygonal gebrochen; durch 2 weitere Säulen hinter dem Hochaltar blickt man in den Chor. Die tambourlose Kuppel und die Tonnen der kurzen Kreuzarme haben klassizist. Kassettendekoration (wohl 1792). Im Eingangsarm 3 vorzügliche Bilder von Gaspare Traversi, 1749 (Geburt, Verkündigung und Himmelfahrt Mariae).
S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone (an der gleichnamigen Piazza am Ponte di Chiaia, s. u. — von der Via Chiaia aus auch per Aufzug erreichbar)
Die Kirche, eines der wichtigsten Werke des Theatinerarchitekten Francesco Grimaldi, wurde i. J. 1600 begonnen und 1610 im Rohbau vollendet; die Ausführung der Dekoration nahm noch längere Zeit in Anspruch. Erst 1684/85 wurde die einfache, noch von frühbarocken Motiven (Zu-
rückstufung der Seitenfelder) bestimmte Zwei-Ordnungs-Fassade hinzugefügt. — Das klar und weiträumig proportionierte Innere ist eine 3schiffige Pfeilerbasilika mit flachen Seitenkapellen, Kuppelvierung und quadratischer Chorapsis. Hauptschiff und Kreuzarm haben Tonnengewölbe mit großen Stichkappenfenstern; die Seitenschiffe sind, nach neapolitan. Herkommen (S. Giacomo degli Spagnuoli, S. Filippo Neri) mit Kuppeln bedeckt. Das Gliederungssystem des Mittelschiffs erinnert in seinen Hauptmotiven an die röm. Theatinerkirche S. Andrea della Valle, deren Entwurf gleichfalls auf Grimaldi zurückgeht. Hier wie dort sind Wand-und Gewölbevorlagen (Pilasterbündel und abgetreppte Gurten) als zusammenhängendes Gerüst behandelt; die Horizontale des Hauptgebälkes wird über jedem Pfeiler von energisch markierten Verkröpfungen unterbrochen, die Gelenkstellen (Vierungspfeiler) durch eine besonders gedrängte Gliederung artikuliert (vgl. auch Grimaldis Spätwerk SS. Apostoli und die Schatzkapelle des Domes).
Die Gewölbefresken (Marienleben, Evangelisten, »Paradiso«) malte G. B. Beinaschi (1672/73). — Die 2. Kapelle links enthält eines der schönsten Madonnenbilder (Immacolata) des Massimo Stanzione; in der 1. Kapelle rechts Grabmonumente der Familie Serra von Tito Angelini; 3. Kapelle rechts: Hl. Familie von Luca Giordano. — Im Querschiff und Chor große Leinwandbilder von Francesco Caselli (Geburt Christi und Epiphanie, Judith, Esther und Maria degli Angeli); schönes Chorgestühl.
Vom Vorplatz der Kirche zweigt rechts der Ponte di Chiaia ab, eine Straßenbrücke, die den Pizzofalcone mit den am S-Hang des Vomero (alle Mortelle) liegenden Stadtteilen verbindet. Die auf der Talsohle entlangführende Via Chiaia war 1539 von Don Pedro di Toledo reguliert worden; von ihr stieg man an der Stelle der heutigen Brücke über den Pendino di Chiaia zum Pizzofalcone hinauf. 1636 ließ der Vizekönig zum Nutzen (und auf Kosten) der anwohnenden Hausbesitzer hier die erste Brücke errichten. Ihre heutige Gestalt verdankt sie einer Restaurierung von 1834 (Architekt Orazio Angelini, Reliefs von Tito Angelini, Gennaro Cali und Tommaso Arnaud); damals wurde auch die unbequeme Rampe des Pendino durch die Treppenanlage ersetzt.
S. Maria degli Angioli alle Croci (oberhalb des Botanischen Gartens am Ende der Via Michele Tenore)
Ein vorzüglich erhaltenes Werk des Cosimo Fanzago (1639 ff.). — Über einem quergelagerten Treppenpodest erhebt sich die wuchtige Eingangsfassade der Kirche und des dazugehörigen Franziskanerkonvents, ein Komplex von son-
derbar profanem Charakter, dessen architektonische Hauptmotive — Risalitbildung, Kolossalpilaster, Fenster im Obergeschoß, horizontale Dachbalustrade statt Giebel — eher an einen (spätbarocken!) Schloßbau als an eine Bettelordenskirche denken lassen (vgl. die Fassade von S. Maria della Sapienza). Das spannungsreiche, von Licht und Schatten malerisch belebte Wandrelief, in dem der Apparat der »Ordnungen ins freie Linienspiel der Feld-und Rahmenornamente eingeschmolzen scheint, zeigt den Meister auf dem Wege zu einer neuen dekorativen Synthese der hergebrachten Architekturformen. Die Fensternische über dem Portal enthält eine von Fanzago selbst gearbeitete Statue des hl. Franziskus.
Durch den darunter sich öffnenden Eingangsbogen betritt man zunächst ein geräumiges Atrium, mit 2 x 3 kreuzgewölbten Jochen auf schlanken toskanischen Säulen, deren Schäfte aus der 1640 von Fanzago abgebrochenen Basilika von S. Giorgio Maggiore stammen sollen. Das Innere besteht aus einem langgestreckten, flachgedeckten Saalraum mit seitlichen Kapellenreihen; es folgt ein wenig ausladendes Querschiff, gleichfalls mit Flachdecke; erst der quadratische, durch ein großes Thermenfenster erhellte Chorraum trägt die Kuppel. Die Coretti-artigen Öffnungen in den Oberwänden von Querschiff und Chor dienen keinem anderen Zweck, als einen perspektivisch reizvollen Durchblick in die Gewölbe der Nebenräume zu gewähren. I. ü. jedoch ist alles Spielerische ausgeschaltet, die Gesamtwirkung des Raumes auf einen Ton von strenger, ja trockener Eleganz herabgestimmt, in dem der Geist des Minoritenordens sein Genüge finden mochte. Dabei hat Fanzago auf architektonische Ordnungen hier überhaupt verzichtet: Das Dekorationssystem, in sich völlig homogen, besteht allein aus flachen Rahmungen und Arabesken in weißem und grauem Marmor; kräftigere Akzente setzen die überaus schöne Kanzel, mit Fanzagos geliebten »rosoni« geschmückt, und der reich ausgestattete Hochaltar. — Der Liegende Christus unter der Altarmensa gilt als Werk des Sohnes Carlo Fanzago.
S. Maria delle Anime al Purgatorio (Via dei Tribunali, Ecke Vico del Purgatorio)
Das Oratorium einer 1600 gegründeten Bruderschaft, die sich zur Aufgabe gesetzt hatte, Messen für die armen Seelen im Fegefeuer
lesen zu lassen. Der Bau entstand am die Mitte des 17. [h. und wurde 1717 restauriert.
Die bescheidene Saalkirche hat eine 2geschossige Fassade. Architektur und plastischer Schmuck (besonders prächtig die polychrome Marmor- und Stuckdekoration des Presbyteriums) stammen von Cos. Fanzago, dem sich hier reichlich Gelegenheit bot, seiner Vorliebe für Totenschädel (vgl. den Kartäuserfriedhof in S. Martino) zu frönen. — Am Hochaltar eine sehr schöne, an Guido Reni anklingende Armesünder-Madonna von Massimo Stanzione; darüber 8. Anna und Maria zu Füßen Gottvaters, von Giac. Farelli; zur Linken das Grabmal des Giulio Mastilli von A. Falcone. In der 3. Seitenkapelle links: A. Vaccaro, Tod des hl. Joseph; gegenüber ein beachtlicher Luca Giordano, Tod des hl. Alexias (vgl. dazu Cortonas Bild in S. Filippo Neri, aber auch Tizians Verkündigung in S. Domenico Maggiore).
S. Maria Apparente (oder »a parete«; Corso Vittorio Emanuele)
Die Kirche verdankt ihren Namen einem an der Felswand erschienenen wundertätigen Madonnenbilde, das seit 1581 von einem Konventualenkloster betreut wurde. Wann und von wem der heute stehende Bau des 18. Jh. errichtet wurde, ist nirgends überliefert.
Eine große Freitreppenanlage steigt vom Niveau des Corso zu der schmucklosen, nur von Lisenen gegliederten Eingangsfassade empor. Dahinter verbirgt sich ein äußerst reizvoller Kreuzkuppelbau von gedrungenen Proportionen mit stark erweitertem Mittelraum und gerade geschlossenen kurzen Kreuzarmen; die Vierung ist von einer tambourlosen Flachkuppel mit schrägliegenden Okuli bedeckt; die 4 quadratischen Eckräume tragen böhmische Kappen. Über dem Eingang liegt eine Sängertribüne mit schönem Orgelprospekt. Eine komposite Pilasterordnung zieht sich an den vielfach gestaffelten Pfeilern und Wänden entlang; weiße und cremefarbene Stuckdekorationen bilden ein kompliziertes Netzwerk von Gesims-und Rahmenprofilen; in der Gewölbezone tritt graziös geschwungenes Voluten-und Blattwerk hinzu.
Cappella di S. Maria Assunta (Largo Corpo di Napoli, gegenüber von S. Angelo a Nilo), die Familienkapelle der Pignatelli, wahrscheinl. von dem 1348 gestorbenen Abate Pietro Pignatelli gegründet und 1736 renoviert, wobei eine hübsche Rokokostuckfassade entstand. — Das heute wegen Baufälligkeit unzugängliche Innere mit kreuzgewölbtem Hauptraum und hoher Querovalkuppel über dem Altar enthält das Grabmal des 1476 verstorbenen Carlo Pignatelli von G. B. del Moro, Fresken von Fidele Fischetti (1772) und ein Altarbild (Maria Assunta) des gleichen Meisters.
S. Maria Avvocata al Mercatello (am Ende der gleichnamigen Straße, die von der Via Pessina (Piazza Dante) gegen Pontecorvo aufsteigt) wurde im 16. Jh. gegründet und erhielt im 18. Jh. eine der hübschesten Stuckfassaden des neapolitan. »barocchetto«. Das Innere ist ein flachgedeckter Saal mit Kuppelvierung. Am Hochaltar eine Assunta und 2 Heiligenstatuen des 18. Jh.; die übrige Ausstattung in fingierten Marmorintarsien stammt aus dem 19. Jh.
S. Maria a Cappella Vecchia (am westl. Abhang des Pizzofalcone, erreichbar durch ein von der Piazza dei Martiri aufsteigendes Gäßchen [Vico di S. Maria])
Von dem bereits im 12. Jh. erwähnten Kloster (urspr. Basilianer, seit dem. 15. Jh. Benediktiner) ist nur noch das Marmorportal von 1506 übrig; der dahinter sich öffnende Platz entspricht dem alten Klosterhof. Die linker Hand liegende Kirche (nur Sonntag vormittags geöffnet) enthält 3 vorzügliche Marmorstatuen von Girolamo Santacroce (Madonna, St. Benedikt mit dem Raben, der ihm das Brot brachte, und Johannes d. T.), wohl Teile eines Wandnischenaltars in der Art von S. Anna dei Lombardi (vgl. S. 43).
Das Kloster wurde gegen Ende des 18. Jh. säkularisiert und ging in den Besitz des Marchese von Sessa über; in den herrlich gelegenen Räumen der beiden Obergeschosse richtete sich der englische Gesandte Sir W. Hamilton eine Wohnung ein — »ein Mann von allgemeinem Geschmack und, nachdem er alle Reiche der Schöpfung durchwandert, an ein schönes Weib, das Meisterstück des großen Künstlers, gelangt«, wie Goethe sich nach einem Besuch notierte. (Das Meisterstück war Miss Emma Lyon alias Harte, die 1791 Lady Hamilton und wenig später Nelsons Geliebte wurde.) — Unter dem Dach befand sich ein oktogonales Eckzimmer, dessen äußere Hälfte von einem Balkon umgeben war, von dem aus man einen der berühmtesten Rundblicke über Stadt und Golf genoß. Die innere Hälfte des Raumes war ganz mit Spiegeln ausgekleidet, die das Bild der Landschaft zurückwarfen; der Besucher fühlte sich, nach einer Schilderung Wilhelm Tischbeins, »wie auf einer Felsenkuppe« über Meer und Land hinausgehoben, ohne dabei der Bequemlichkeit eines ringsumlaufenden Sitzpolsters entraten Zu müssen. Auf Bitten eines Freundes ließ Hamilton durch den Landschaftszeichner Don Tito Lusieri die ganze Aussicht aufnehmen, woraus die frühesten, kurz darauf in London erschienenen Panoramen hervorgingen. — Das Untergeschoß enthielt ein, lt. Goethe, »geheimes Kunst- und Gerümpelgewölbe«, wo der Lord seine oft auf nicht ganz legalen Wegen erworbenen Kunstschätze mehr versteckt hielt als zeigte, deren Spannweite von der berühmten, später von Tischbein publizierten griech. Vasensammlung bis zu modernem Haus- und Kirchengerät reichte, »Geschnitztes, Gemaltes und was er nur Zufällig zusammenkaufte, sogar ein Kapellchen«.
S. Maria di Caravaggio (am Beginn der Via Pessina, NW-Ecke der Piazza Dante)
Errichtet von G. B. Nauclerio in der J. Hälfte des 18. Jh., die Kirche einer 1627 gegründeten Klosterschule der Piaristen.
Die feine Rokoko-Fassade hat 2 Pilasterordnungen, getäfelte Felder und freie, großformige Stuckdekoration. — Das Innere, ein längsovaler Kapellensaal, zeigt Nauclerio (den Meister der interessanten Fassade von S. Giovanni Battista) einmal mehr als ebenso ideenreichen wie eigenwilligen Architekten. Als erstes fällt die bedeutende Höhenentwicklung des Raumes ins Auge: Auf die große Doppelpilasterordnung des Hauptgeschosses folgt noch eine attikaähnlich proportionierte Fensterzone mit einer Z., kleineren Ordnung; darüber spannt sich ein flaches Muldengewölbe mit Stichkappen. Zum zweiten wird, durch die Disposition der Nebenräume, die vom Eingang zum Hochaltar führende Tiefenachse betont; dabei sind der Rhythmus der Öffnungen und der Pilasterstellung so kunstvoll ineinander verschränkt, daß — bei einem Grundplan von elementarer Einfachheit — ein staunenswert reiches Raumbild entsteht. Die Längswände haben je 2 flache Kapellennischen, die auf die Höhe des Untergeschosses beschränkt bleiben; zwischen ihnen (also in der Querachse des Ovals) kommt so jeweils nur eine Pflastergruppe zu Stehen. Dafür reichen die Öffnungen in der Längsachse — Eingangs- und Altarraum — bis in die Attika-Zone hinauf; die große Ordnung biegt in sie ein und läuft ungebrochen in ihnen fort, wodurch die betreffenden Raumabschnitte sich im Grunde als Teile des Mittelraums zu erkennen geben: Der Ovalplan wird gleichsam als Längsraum mit seitlich ausschwingenden Wänden interpretiert; erst die halbrunde Chorapsis ist dem Hauptgebälk wieder untergeordnet.
Die Ausstattung (Fresken und Altargemälde) stammt überwiegend aus dem 19. und 20. Jh.; um so erfreuter begrüßt man in der 1. Kapelle rechts ein exzellentes Bild Solimenas, Tod des hl. Joseph (Lichtschalter links).
Von den 1. Seitenkapellen rechts und links führen Treppen in eine räumlich höchst eindrucksvolle Unterkirche hinab, die den Bau in seiner ganzen Ausdehnung unterfängt.
Vestibül und Chorkapelle entsprechen in etwa dem Oberbau; in den Ovalraum ist eine massive Pfeilerstellung eingezogen, die das flachbogige Stichkappengewölbe trägt und
nach außen hin einen Umgang mit Seitenkapellen entstehen läßt.
S. Maria del Carmine (an der Piazza del Carmine im Hafenviertel)
Die Kirche führt ihren Zunamen auf eine Niederlassung der Karmeliter zurück, die im 12. Jh. in dieser Gegend eine Kirche oder Kapelle mit einem wundertätigen alten Marienbilde (S. Maria la Bruna) besaßen. — 1270 schenkte König Karl I. den Mönchen Grund für einen Neubau am »Campo Moricino« (vgl. S. 20); die Mittel zur Errichtung des zwischen 1283 und 1301 begonnenen Gebäudes stifteten Karls 2. Frau Margarethe von Burgund und Elisabeth von Bayern, Witwe Kaiser Konrads IV., die hier eine Erinnerungsstätte für ihren 1268 auf dem Platz vor der Kirche hingerichteten Sohn Konradin (s. S. 90) zu schaffen gedachte. Es entstand eine langgestreckte Saalkirche mit hölzernem Sparrendach; an den Längswänden je 10 Seitenkapellen, darüber Lichtgaden mit hohen Lanzettfenstern; am O-Ende ein kurzes Querschiff mit polygonaler Apsis; darunter scheint sich eine Krypta befunden zu haben, wahrscheinl. ein Überrest der alten Karmeliterkapelle mit dem Gnadenbild. Im 15. und 16. Jh. erfuhr der von Erdbeben und anderen Schäden betroffene Bau mancherlei Änderungen; eine Vorhalle mit darüberliegendem Mönchschor wurde eingebaut, die Apsis umgestaltet und die Krypta beseitigt; im 17. Jh. wurde eine vergoldete Holzdecke eingezogen (im 2. Weltkrieg beschädigt und modern erneuert). 1755-66 erhielt das Innere nach Entwürfen des neapolitan. Architekten Niccolò Tagliacozzi-Canale seine heutige Form; die Fassade stammt von Giovanni del Gaizo (1766).
Zu den Wahrzeichen der Stadt gehört der vom Meer weithin sichtbare, 75m hohe Glockenturm. Sein Vorgänger, von dessen Gestalt und Entstehungszeit wir nichts wissen, stürzte beim Erdbeben von 1456 zusammen, wurde 1458 wieder aufgebaut und versah bis zum Beginn des 17. Jh. seinen Dienst. 1615 beschloß man die Errichtung eines »gran campanile« nach einem Entwurf von Giacomo Confortos. Die 4 Hauptgeschosse (in der klassischen Abfolge Rustika — dorisch — ionisch — korinthisch) waren 1620 fertiggestellt; 1622 wurde das 1. Oktogon aufgesetzt; dessen Obergeschoß und die zwiebelförmige, mit Majolikaziegeln gedeckte Dachspitze, von Fra Nuvolo entworfen, wurden 1631 vollendet; die Konstruktion war solide genug, alle folgenden Erdstöße zu überdauern.
Das Innere der Kirche verdankt sein heutiges Aussehen der Umgestaltung von 1755. Eine prachtvolle polychrome
Marmorverkleidung, mit 2 Doppelpilasterordnungen und üppigen Engelkartuschen über den Kapellenbögen, bedeckt die Wände; die got. Fenster sind zu breiten, kurvig begrenzten Lichtöffnungen erweitert worden. In Querschiff und Apsis zeichnet sich noch die Gewölbestruktur des Trecento-Baues ab.
Ausstattung. Im Langhaus zwischen der 4. und 5. Kapelle links steht auf hohem Sockel eine von Maximilian von Bayern gestiftete, 1847 enthüllte Statue Konradins von Hohenstaufen, nach einem Modell Thorwaldsens (1836) in Marmor ausgeführt von Peter Schöpf; in seiner Einfachheit eines der sympathischsten Denkmäler der Epoche. In den beiden folgenden Seitenkapellen Altarbilder von Paolo de Matteis (hl. Anna) und Solimena (Elias und Elisa, 1696). In der 2. Kapelle rechts der hl. Simon Stock, der sel. Franco und Maria, von Mattia Preti (1684 aus Malta geschickt). — Die hübsche Kanzel des 18. Jh. steht an Stelle einer älteren, von der Masaniello, der Anführer des gescheiterten Volksaufstandes von 1647, seine letzte Ansprache an die Menge hielt; wenig später wurde er im benachbarten Karmeliterkonvent niedergemacht (vgl. S. 90). — Auf einer hölzernen Galerie unter dem Triumphbogen steht ein prunkvolles Holztabernakel, bekrönt von einem Bilde Gottvaters von Luca Giordano; das dahinter herabhängende Velum verhüllt bedauerlicherweise ein etwa lebensgroßes bemaltes Holzkruzifix von stärkster expressiver Kraft, wohl gegen Ende des 14. Jh. entstanden und möglicherweise spanisch beeinflußt; das tief auf die rechte Schulter geneigte Haupt hat zu der Legende Anlaß gegeben, der Gekreuzigte sei auf diese Weise bei der Beschießung Neapels von 1438 einer durch die Kirche fliegenden Kanonenkugel ausgewichen. — In der linken Querschiffskapelle Fresken von Solimena; rechts gegenüber eine sehr schöne Assunta desselben Meisters. — Die Marmorverkleidung der Apsis stammt von Gius. Mozzetti (1671). Hinter dem Hochaltar, in einer marmornen Ädikula des 16. Jh., das Bildnis der »Madonna la Bruna«, eine spätbyzantin. Marienikone, unter der sich viell. das im 12. Jh. erwähnte Gnadenbild verbirgt. — Im Querschiff rechts der Zugang zur Sakristei, mit schöner Holz- und Stuckdekoration aus der Mitte des 18. Jh.; die Fresken (im Gewölbe das Opfer des Elias, an der Wand Elisa, der die Stadt Samaria von der Hungersnot befreit) stammen von Filippo Falciati (1741, restaur. 1937); anschließend ein Kapellchen mit Marmorreliefs und Fresken vom Anfang des 16. Jh.
Durch die Torfahrt im Sockelgeschoß des Campanile tritt man in den Kreuzgang des Karmeliterkonvents, von dessen got. Architektur leider nichts übriggeblieben ist. An den Wänden und Gewölben des ringsumlaufenden Portikus findet sich ein um 1600 entstandener Freskenzyklus mit den Taten der Propheten Elias und Elisa sowie Szenen aus der Geschichte des Karmeliterordens.
S. Maria della Catena (Via S. Lucia), eine der populärsten Kirchen des alten Fischerviertels, führt ihren Namen nach einer Madonnenfigur, die einst 3 unschuldig verurteilte Palermitaner aus ihren Ketten befreit haben soll und seitdem von den Angehörigen von Strafgefangenen um Hilfe ersucht wird. Der anspruchslose Bau wurde 1576 errichtet und um die Mitte des 19. Jh. renoviert; dieser Zeit gehört auch die schlichte 2-Turm-Fassade an. — Im Querschiff links ein Kenotaph für den 1799 auf Befehl Lord Nelsons gehenkten neapolitan. Admiral Francesco Caracciolo, der sich nach der Flucht König Ferdinands IV. auf die Seite der Republikaner geschlagen hatte.
S. Maria della Colonna (Piazza dei Gerolomini, gegenüber von S. Filippo Neri)
1715 von Antonio Guidetti errichtet; aus dem zugehörigen, 1589 gegründeten Waisenhaus, dessen Zöglingen der Erzbischof eine musikalische Ausbildung zuteil werden ließ, ist u. a. Giov. Battista Pergolesi hervorgegangen.
Schöne 2geschossige Fassade mit Phantasie-Ordnungen und Putzfeldern, die Mittelpilaster schräg auswärts gedreht; das Innere ein Zentralraum über griech. Kreuz mit leicht verkürzten Querarmen und hochragender Vierungskuppel; sparsame Stuckdekorationen; Altarbilder von Paolo de Matteis.
S. Maria della Concordia (an der gleichnamigen Piazzetta am oberen Ende des Vico Conti di Mola, zwischen Toledo und Corso Vittorio Emanuele; Inneres stets verschlossen) wurde 1556 gegründet und 1718 von Giov. Battista Nauclerio neu erbaut. Hübsche Fassade mit leicht schräg eingeknickten Flügeln, großer Doppelpilasterordnung, darüber frei schwingendes Volutenwerk. Das Innere 1858 restaur.; Bilder von de Matteis und Lama.
S. Maria della Consolazione a Villanova (Via Manzoni, auf dem Rücken des Posillipo)
Sie ist die Kirche eines heute von Neubauvierteln eingeschlossenen Dörfchens. Der erste Bau wurde 1488 bis 1491 errichtet; von ihm stammt das hübsche, 1510 datierte Alabasterrelief über dem Lavabo der Sakristei (Madonna mit dem Täufer und Petrus). Die heute stehende Kirche ist ein Werk F. Sanfelices von 1737; die
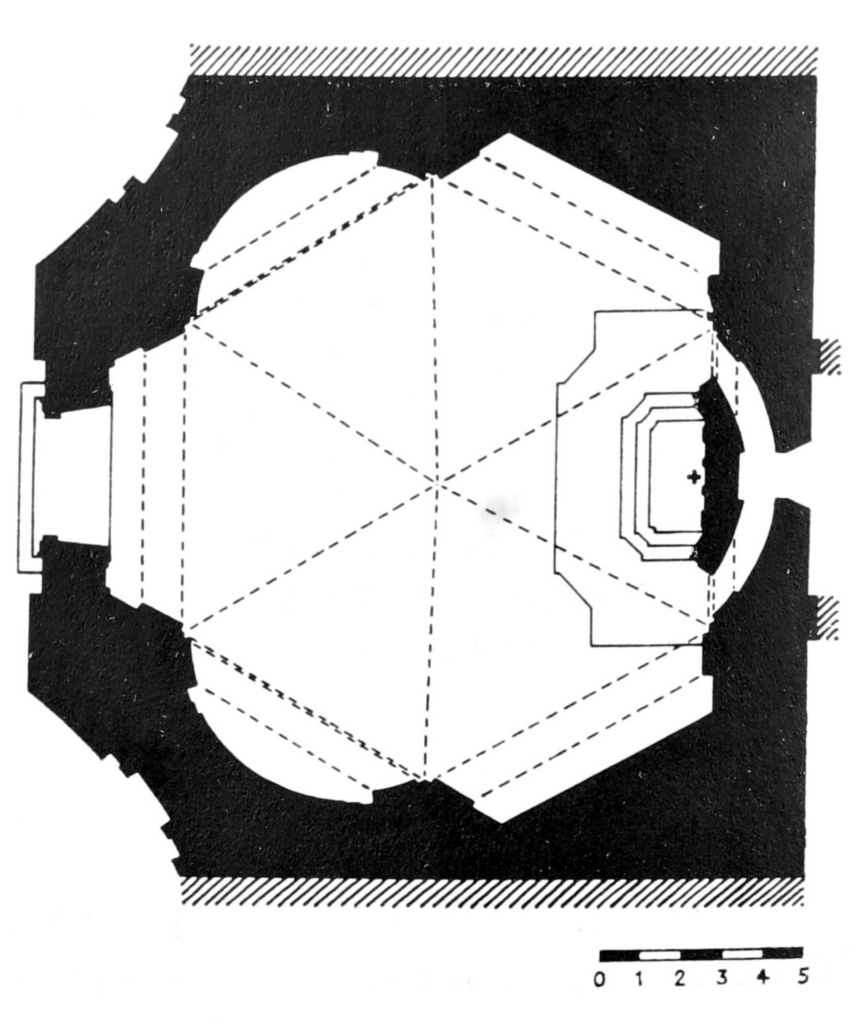 S. Maria d. Consolazione a Villanova. Grundriß
S. Maria d. Consolazione a Villanova. Grundriß
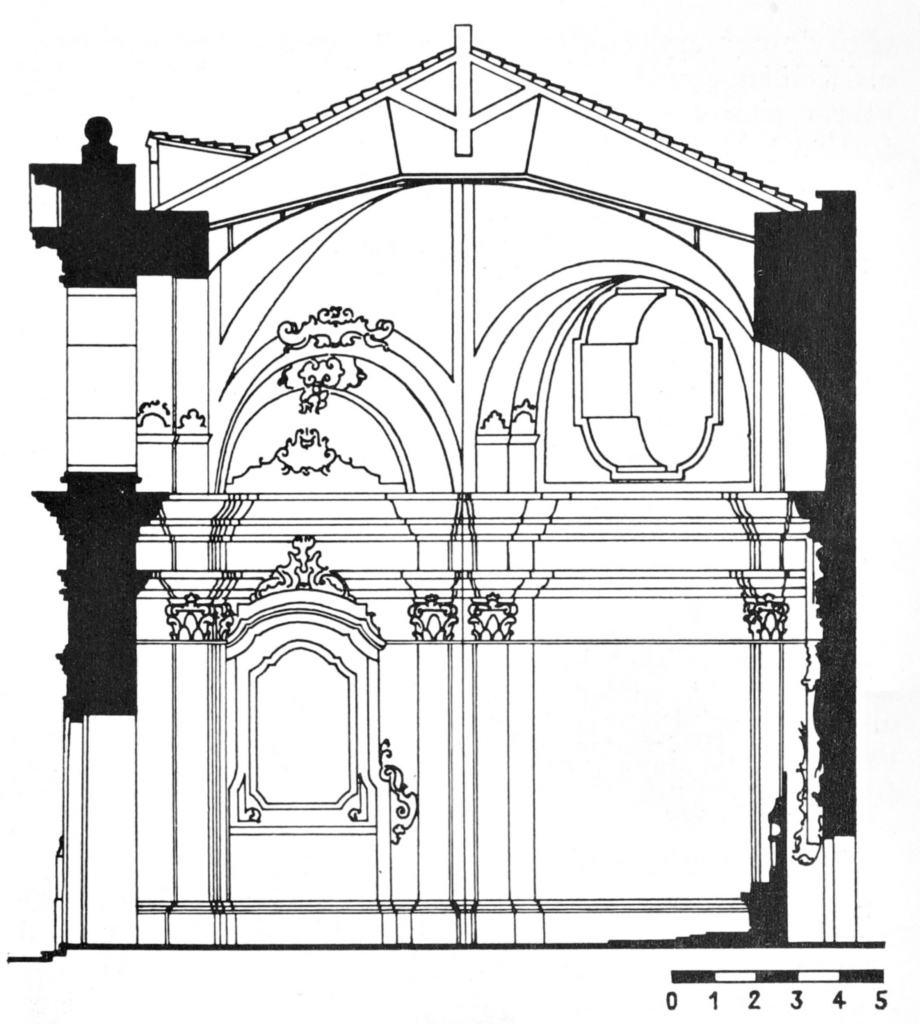 S. Maria della Consolazione a Villanova. Schnitt
S. Maria della Consolazione a Villanova. Schnitt
Fassade wurde im 19. Jh. verändert, das Innere unerfreulich restauriert.
Von Borrominis röm. Universitätskirche S. Ivo angeregt, hat Sanfelice dem Bau die Form eines unregelmäßigen Sechsecks gegeben: 3 lange und 3 etwas kürzere Seiten wechseln miteinander ab. Die Langseiten sind als Nebenkapellen von trapezoidaler Grundgestalt ausgebildet, die kurzen als flache Rundnischen; die dadurch entstehende Grundrißfigur suggeriert das Bild zweier übereinandergelegter Dreiecke, das eine mit abgeplatteten, das andere mit abgerundeten Ecken. Die 6 Ecken des Hauptraumes, an denen die Nebenräume unmit-
telbar aufeinandertreffen, erscheinen dementsprechend nicht als Kehlen, sondern als vorspringende Kanten; sie sind mit Pilasterpaaren besetzt, die ein durch die Kapellen und Nischen fortlaufendes Gebälk tragen. Über den 3 großen Abseiten öffnen sich Fensterstichkappen; die Nischen enden in flachen Apsiskalotten. Darüber spannt sich ein 6teiliges Schirmgewölbe. Seine Gurtbänder laufen im Scheitel in einer Stuckkartusche zusammen, die vermittels einer komplizierten Durchdringung von Vier- und Sechspaßelementen das Hexagon zur Längsform umdeutet. Elegante Rokoko-Ornamente umspielen Wand- und Gewölbefelder.
S. Maria di Costantinopoli (an der gleichnamigen Straße in der Nähe des Nationalmuseums) wurde 1575 von Fra Nuvolo erbaut. Die Fassade 2geschossig, pilastergerahmt, mit manieristisch verschnörkeltem Zierat an Fenstern und Portalen. — Das Innere ist ein konventioneller Saalbau mit Flachdecke über hohem Fenstergaden, Kuppelvierung und polygonal gebrochenen Kreuzarmen, stuckiert und teilweise erneuert im 18. Jh.; die bunte Majolikakuppel, eine Spezialität des Fra Nuvolo, ist vom Eingang des Nationalmuseums gut zu sehen. — Das Gnadenbild der Madonna von Konstantinopel, ein Fresko vom Anfang des 16. Jh., dem eine pestheilende Wirkung zugetraut wurde, schloß Fanzago in ein kolossales Marmortabernakel über dem Hauptaltar ein. Vom gleichen Künstler das Grabmal des Gerolamo Flerio, zwischen der 3. und 4. Kapelle links, mit dem vorzüglichen Bildnis des Verstorbenen. In den Gewölben der Kreuzarme Fresken von Corenzio.
S. Maria del Divino Amore (Via S. Biagio dei Librai, Schlüssel: Vico Paparelle al Pendino 32) ist ein symmetrischer Kreuzbau mit verlängertem Eingangsarm, 1709 von Giovanni Battista Manno errichtet, 1851 restaur. Am Hochaltar Himmelfahrt Mariae von Andrea Mattei (1791); in einem Zimmer neben der Sakristei ein schöner Francesco de Mura (Immacolata).
S. Maria Donnalbina (oder di Don Albino; in der gleichnamigen Straße östl. der Via Montoliveto; Inneres wegen Baufälligkeit unzugänglich) heißt angebl. nach einem Edelmann des 14. Jh., der dem ganzen Viertel seinen Namen gegeben haben soll. Die Gründung der Kirche geht ins 11. Jh. zurück; sie wurde im 16. Jh. neu errichtet und in neuerer Zeit mehrfach umgebaut und restauriert. Das Innere enthält größtenteils zerstörte Kuppelfresken und 6 Leinwandbilder von Solimena, ein Bild von D. A. Vaccaro und das Grab des Komponisten Giovanni Paisiello.
S. Maria di Donnaregina (Largo Donnaregina, nördl. des Domes)
Für mehr als ein Jahrtausend gehörte S. Maria di Donnaregina zu den ersten Frauenklöstern der Stadt. Ein Basilianerinnenkonvent von S. Pietro »in Monte Reina«, der die Tochter des neapolitan. Herzogs Johannes wie auch des oström. Kaisers Anastasius
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S. Maria di Donnaregina Grab der Maria von Ungarn: Kopf der Königin (Tino di Camaino)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S. Maria di Donnaregina. Eingangswand: Das Jüngste Gericht (P. Cavallini und Werkstatt)
zu seinen Insassinnen zählte, wird schon im 8. Jh. erwähnt. Im 11. Jh. übernahmen die Nonnen die Benediktinerregel und weihten ihre Kirche der Maria; von der 2. Hälfte des 13. Jh. bis zur Aufhebung des Klosters i. J. 1861 gehörten sie dem Klarissenorden an.
Die frühbarocke Fassade an der N-Seite des Platzes ist ein Teil der neuen Klosterkirche (Donnaregina Nuova)‚ die 1620-49 errichtet wurde. Architekt war der Theatiner Giovanni Guarini, ein Schüler des Padre Francesco Grimaldi.
Der Bau wurde im 2. Weltkrieg schwer beschädigt und ist bis auf weiteres unzugänglich; die vielgerühmte Ausstattung umfaßte Fresken und Altarbilder von Luca Giordano, Paolo de Matteis, Solimena, Santolo Cirillo u. a. — Durch den Vico Donnaregina an der rechten Längswand der Kirche erreicht man den Eingang zum alten Konvent (falls verschlossen, klingeln; ein wohlinformierter und nicht leicht zum Schweigen zu bringender Kustode führt). Im Vorhof rechts exquisite polychrome Marmordekorationen von Ferdinando Sanfelice.
Die Chiesa trecentesca, deren hohe und schmale Eingangsfassade zur Linken aufragt, ist ein Hauptwerk der Gotik in Neapel und würde, vollständig erhalten, zu den wichtigsten Denkmälern des italien. Trecento gezählt werden.
Ihre Entstehung ist mit dem Namen Marias von Ungarn, der Tochter König Stephans V. verknüpft. 1270 mit Karl II. vermählt, wurde die ungarische Prinzessin zur Magna Mater des Hauses Anjou, die 8 Söhnen und 5 Töchtern das Leben schenkte. Nach dem Tode ihres Gatten (1309) trat die ebenso fromme wie energische und kluge Dame dem Klarissenorden bei und nahm im Kloster von Donnaregina Wohnung. Dieses war beim Erdbeben von 1293 schwer beschädigt worden. Schon 1298 erhielten die Nonnen dank einer Zuwendung der königlichen Stifterin ein neues Dormitorium; der Bau der Kirche wurde 1307 begonnen und scheint 1318 im wesentlichen beendet gewesen zu sein. Erste einschneidende Veränderungen brachte die Errichtung der Donnaregina Nuova zu Beginn des 17. Jh.; ein Teil der alten got. Apsis wurde zerstört, das Untergeschoß durch Zwischenwände aufgeteilt und fortan als Magazin benutzt; das Obergeschoß blieb als Nonnenchor in Gebrauch. Nach der Säkularisation des Klosters (1861) dienten die Räume der Kirche verschiedenen Zwecken; die alten Konventsgebäude wurden bis auf geringe Spuren beseitigt. Erst 1928-34 ging man daran, die erhaltenen Reste der Kirche freizulegen und soweit als möglich den alten Zustand zu rekonstruieren.
Das 1schiffige Langhaus ist zu etwa 2 Dritteln seiner Länge in 2 Geschosse aufgeteilt — ein Typus, der sich bei
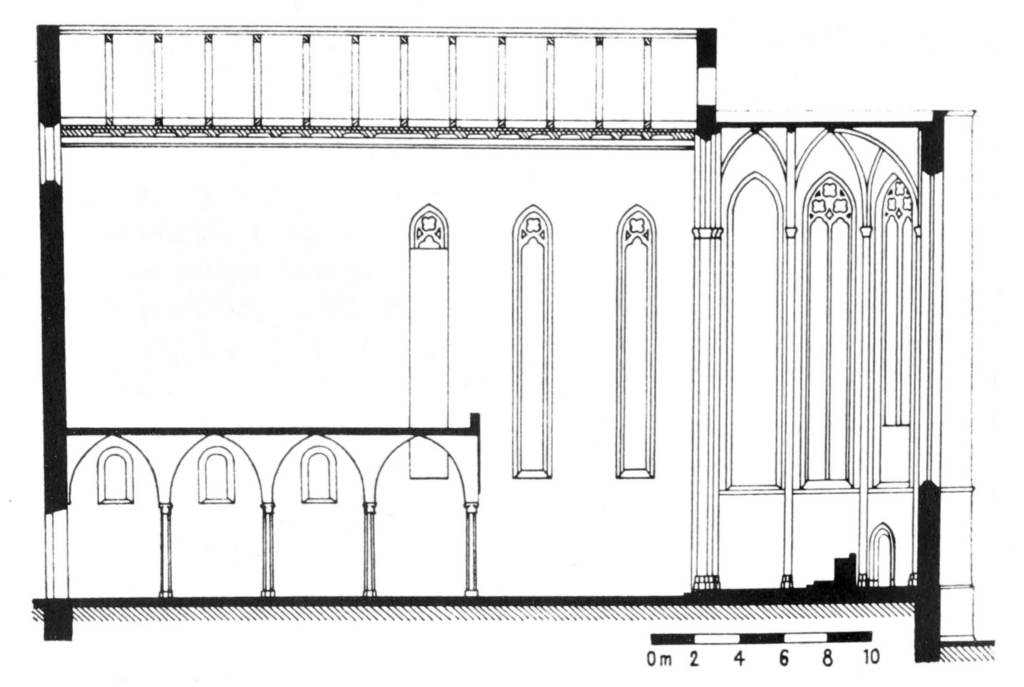 S. Maria di Donnaregina. Längsschnitt
S. Maria di Donnaregina. Längsschnitt
Zisterzienserinnenklöstern des 13. Jh. in Deutschland häufig findet und in Neapel im späteren 16. Jh. Wiederaufgenommen wurde (vgl. S. Gregorio Armeno). Man betritt zunächst eine niedrige, 3 x 4 Joche tiefe Halle mit Kreuzgratgewölben auf 8eckigen Pfeilern und Konsolen; darüber liegt eine Tribüne, von der aus die zu strenger Klausur verpflichteten Nonnen am Gottesdienst teilnehmen konnten. Wie das vermauerte Fenster der linken Seitenwand zeigt, ist die letzte Travée der Chorempore erst nachträglich angesetzt worden;
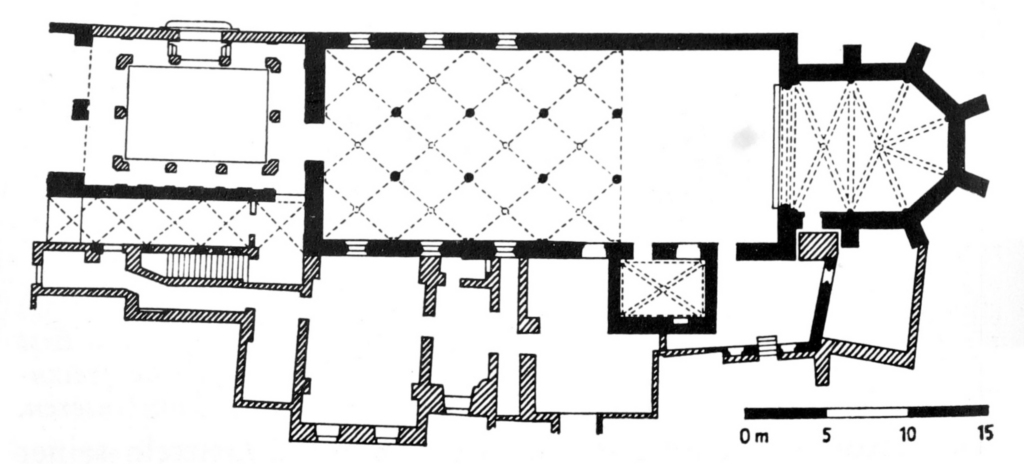 S. Maria di Donnaregina. Grundriß
S. Maria di Donnaregina. Grundriß
der urspr. Plan sah eine hälftige Unterteilung des Langhauses vor, so daß der Chorteil mit seinen 33 Jochen und der eigentliche Schiffsraum mit den 3 hohen, schmalen Lanzettfenstern einander die Waage gehalten hätten. — Von bedeutender Wirkung ist der Blick aus der dämmrigen, nur von 3 kleinen Seitenfenstern erhellten Eingangshalle in die hohe und lichte Apsis. Während im Schiff die Proportion 1 : 2 vorherrscht (Breite zu Länge wie auch zur Höhe bis etwa zum Dachfirst), ist die Öffnung des Presbyteriums so weit eingezogen, daß ein Höhenverhältnis von 1 :3 zustande kommt. An das querrechteckige Vorjoch schließt sich ein polygonales Haupt aus 5 Seiten des Achtecks mit schlanken Diensten und Kreuzrippengewölben von beinahe rundbogigem Stich; die 3 Polygonseiten haben große 2bahnige Maßwerkfenster (die rechte Hälfte der Apsis beim Bau der Barockkirche zerst. und 1928 ff. neu aufgeführt).
Wenige Jahre nach Vollendung der Kirche, 1323, starb die Stifterin Maria von Ungarn; 1325/26 schuf Tino di Camaino ihr Grabmal (Tafel S. 192), 1727 in einen Nebenraum der barocken Kirche überführt und nach 1928 an seinen vermutl. originalen Aufstellungsort an der linken Schiffswand zurückgebracht.
Obwohl angesichts der kurzen Entstehungszeit des Monumentes ein reichlicher Anteil von Gehilfenarbeit angenommen werden muß, bezeichnet es einen Höhepunkt in Tinos Werk. Der architektonische Aufbau, von klassischer Klarheit und Festigkeit, knüpft an den Typus des Baldachinwandgrabes an, wie ihn im 13. Jh. v. a. Arnolfo di Cambio entwickelt hatte (Orvieto, Viterbo). Doch sind die einzelnen Elemente im Sinne der Hochgotik gestrafft und zusammengefaßt: Den Baldachin tragen nicht mehr Säulen, sondern schlanke Bündelpfeiler mit diagonal gestellten, fialenbekrönten Eckpfosten; feines Maßwerk belebt das Bogenprofil; dafür tritt die musivische Dekoration — die bei Arnolfo und den Cosmaten noch große, flächenfüllende Ornamente bildet — hier nur noch als kleinteilig funkelnder Schmuck des Gliederwerks auf.
Die beherrschende Rolle spielt die figurale Plastik. Den Sarkophag tragen die 4 Kardinaltugenden: die »Klugheit« mit Schlange und Buch, die »Mäßigkeit« (ein von der Linken niedergehaltener unruhiger Vogel erscheint als Symbol der gezähmten Begierde), die »Gerechtigkeit« (die Linke hält das Schwert, in der Rechten ist eine Waage zu ergänzen) und die »Stärke« mit dem Nemeischen Löwen. Anders als ihre Vorgängerinnen am Katharinengrab in S. Lorenzo Maggiore, sind sie nicht mehr tragende Karyatiden und mit ihren Pfeilern fest verbunden, sondern stehen statuarisch frei vor den Achteckstützen (während später, in den Gräbern in S. Chiara, die Rückbildung zur Säulenfigur einsetzt). Ein durch-
gehender kontrapostischer Rhythmus hält die Vierergruppe zusammen; die blockhaft geschlossenen Körperkonturen, von den gewaltigen, bis zur Erde herabreichenden Flügelpaaren hinterfangen, bieten Spielraum genug für eine Fülle plastischer Einzelmotive, die den Typus abwandeln. Mit Sicherheit eigenhändig sind die beiden rechten Figuren, in deren Gesichtern und Händen (die Schwerthand der »Justitia«!) Tinos Stil seine ganze Anmut entfaltet.
An der Frontseite des Sarkophags sitzen unter mosaizierten Spitzbogenarkaden die 7 erwachsenen Söhne der Königin (der 8., Johann Tristan, starb noch als Kind): ganz links Peter Tempesta, Graf von Eboli, der 1315 als einer der Führer der Guelfenpartei in der Schlacht von Montecatini fiel; dann Philipp, Fürst von Tarent (+ 1331); es folgt mit Krone und erhobenem Zepter Robert d. Weise (1278-1343), seit 1309 als Nachfolger seines Vaters König von Neapel; im Zentrum sitzt der 1297 verstorbene, 1317 heiliggesprochene Ludwig, Bischof von Toulouse; rechts daneben mit herabhängendem Zepter der liebenswürdige Karl Martell von Ungarn (1272-96), von Robert aus der Thronfolge verdrängt, weshalb seine Nachkommen später einen langen und zerstörerischen Kampf gegen das neapolitan. Herrscherhaus führten (Dante, der ihn 1295 in Florenz kennengelernt hatte, hält mit ihm im 8. Gesang des »Paradieses« ein langes Gespräch); es folgen Johann von Durazzo (+ 1335), und schließlich Raimond Berengar, Graf von Andria (+ 1307). — Die als Nonne gekleidete tote Königin, auf dem Deckel des Sarkophags bequem zur Ruhe gebettet, scheint mit alterslos-entspanntem Antlitz in tiefem Schlaf zu liegen: »Before this serene worldly art«, sagt W. R. Valentiner, »even death must lose its terror.« Hinter ihr stehen als Zeichen der erteilten Absolution 2 Ministranten mit Weihrauchfaß, Wedel und Weihwasserkessel; 2 Engel ziehen den Vorhang der Totenkammer beiseite.
Auf dem Dach der Kammer eine Sitzmadonna, deren hoheitsvolle Haltung anmutig gemildert wird durch ein strampelndes Kinderfüßchen, das die Linke der Mutter zärtlich stützt; der Engel zur Linken empfiehlt die betende Königin, der rechte trägt ein Modell der von ihr gestifteten Kirche. — Am Giebelfeld ein Dreipaß mit der Halbfigur des segnenden Christus; darüber ein hl. Michael.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, liegende Figur der Königin Maria von Ungarn, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina
Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, Liegefigur der Königin Maria von Ungarn - Sicht von oben, 1325-1326, Santa
Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, Grabkammer mit Sarkophag und Kardinaltugenden, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina
Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, Prudentia, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, linker Engel, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
Tino da Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, rechter Engel, 1325-1326, Santa Maria Donnaregina Vecchia in Neapel.
In der rechten Längswand öffnet sich die Cappella Lofredo, mit Resten von Wandmalerei aus der Mitte des 14. Jh. Über dem Eingang eine ikonographisch interessante Darstellung der Apokalypse; innen ein großer Kalvarienberg; Verkündigung Mariae und Thronende Madonna; 2 Szenen aus dem Leben des hl. Franz (Predigt an die Vögel und Empfang der Stigmata, nach dem Vorbild der Franz-Legende in Assisi); Geschichten Johannes’ d. Ev. nach der Legenda Aurea (er weckt die Drusiana auf, trinkt unversehrt den Giftbecher, erweckt 2 durch das Gift Getötete, tauft den Diana-Priester Aristodemus und wird in Öl gesotten); im Gewölbe die Apostel Petrus und Paulus.
Von größter Bedeutung ist der Freskenzyklus des
Nonnenchors. Der Restaurierungsbefund geht dahin, daß urspr. der ganze Raum ausgemalt war; doch ist im Verlauf der Jahrhunderte vieles verlorengegangen, anderes irreparabel beschädigt worden. Der Stil der erhaltenen Partien zeigt engste Zusammenhänge mit der Kunst Pietro Cavallinis, des großen Erneuerers der röm. Malerei um die Wende des 13. Jh., dessen Aufenthalt in Neapel für d. J. 1308 urkundlich bezeugt ist. Dies gilt v. a. für die machtvolle Komposition des Weltgerichtsbildes, aber auch für die perspektivisch gesehenen Rahmen- und Bildarchitekturen der Seitenwände. Cavallinis eigene Hand meint man in den Einzelfiguren zwischen den Fenstern der linken Langhauswand zu erkennen, deren großliniger Klassizismus, verbunden mit einer überaus reichen und kraftvollen Modellierung, stark an die Fresken von S. Cecilia in Rom erinnert. Auch die oberen Zonen des Weltgerichts sind reich an Einzelheiten, die des röm. Meisters würdig wären. Die Ausführung der übrigen Bilder, die sich wohl über einige Jahrzehnte hinzog, scheint in den Händen von Werkstattgenossen verschiedener Herkunft (Siena, Assisi) gelegen zu haben.
Das Jüngste Gericht (Tafel S. 193) an der W-Wand des Nonnenchors wird durch die Fenster in 3 Bahnen zerlegt. Im Zentrum thront zuoberst Christus in der Mandorla auf einem Regenbogen, flankiert von den Fürbittern Maria und Johannes, über ihnen links ein ganz renaissancemäßig anmutender gewappneter Cherub, rechts die 3 Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Darunter die Anbetung des Kreuzes; links David, Seth, der gute Schächer und eine weitere Person mit Schriftrolle, rechts ein Posaunenengel.
Darunter Judith, Malachias, Daniel, Joel und weitere Engel, die die Toten auferwecken. Die Seitenfelder zeigen oben die himmlischen Heerscharen, dann 2 Reihen Beisitzer (12 Propheten, 12 Apostel mit Schriftrollen und Büchern). Auf der linken Seite der Zug der Seligen, die geführt von Christus und Maria ins himmlische Jerusalem eingehen. Unter dessen Tor (links unten) ruhen die Seelen in Jakobs, Isaaks und Abrahams Schoß; an der Spitze des Zuges (rechts unten) Kinder und von Engeln gestützte Greise; es folgt (2. Reihe von unten) eine Schar Nonnen, unter ihnen wohl Maria von Ungarn und in der linken Gruppe vermutl. Karl II.; in der Reihe darüber erscheint eine Auswahl von Heiligen — von Stephanus und Laurentius über Benedikt, Franziskus und Dominikus bis zu Marias Sohn Ludwig von Toulouse —, in der letzten Reihe endlich die Seligen des Alten Testaments. Dagegen herrscht in der rechten Hälfte Heulen und Zähneklappern: Engel jagen und stürzen die Leiber der Verdammten in den Orkus; links waltet Michael seines Amtes als Seelenwäger, darunter der Höllenkreis. Zuunterst eine Reihe von 8 Heiligenbüsten, wahrscheinl. die Schutzpatrone der Stadt.
An der linken Längswand des Nonnenchors ist in den 3 oberen Streifen die Leidensgeschichte Christi dargestellt, eine Erzählung von einzigartiger Vielfalt und Dichte, die in vielen Einzelheiten
den »Meditationes Vitae Christi« des sog. Pseudo-Bonaventura, eines toskanischen Franziskaners aus der 2. Hälfte des 13. Jh., folgt. Das I. Register (durch die im 16. Jh. eingezogene Holzdecke beschädigt) zeigt 1. und 2. zwei Abendmahlszenen (P), 3. die Fußwaschung, 4. Christus am Ölberg und 5. Judaskuß und Gefangennahme. — In den ersten 3 Bildern des II. Registers sieht man den Prozeß Christi: 1. Christus wird gegeißelt und von Soldaten mißhandelt, die Magd fragt Petrus aus (Hahn auf dem Dach). 2. Der Palast des Pilatus: Christus wird von links hereingeführt, tritt in der Belvedere-Loggia vor den Statthalter, wird dann hinausgeleitet und zu Herodes gebracht, vor dem er auf der Terrasse des Rundbaus im Hintergrund rechts erscheint. 3. Nochmals der Pilatus-Palast: Ecce homo und Kreuztragung. Es folgt 4. der in aller Breite geschilderte Vorgang der Kreuzigung; links vom wird Christus entkleidet, Maria legt dem Sohn das Lendentuch um, rechts daneben Mariae Ohnmacht unter dem Kreuz. 5. Christi Kreuzestod: Longinus hält seine Lanze, Maria ist am Fuß des Kreuzes zusammengebrochen; rechts vom würfeln die Kriegsknechte um Jesu Kleider; die Seelen der Schächer fahren gen Himmel und Hölle. — Im III. Register: 1. Kreuzabnahme, Beweinung und Grablegung. 2. Auferstehung und Abstieg zum Limbus. 3. Vom die 3 Frauen am Grabe und Noli me tangere; darüber Erscheinungen Christi vor dem eingekerkerten Joseph von Arimathia und der Maria. 4. Weitere Erscheinungen des auferstandenen Heilands: vorn in Emmaus und vor den Jüngern, im Hintergrund vor den 3 Frauen, die vom Grabe kommen, vor Jakobus Minor, vor Petrus und vor den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus. 5. Der Ungläubige Thomas und weitere nicht mehr erkennbare Erscheinungswunder. — Auf dem rechts anschließenden vermauerten Fenster Himmelfahrt, Pfingstwunder und die 3 Heiligen des ungarischen Königshauses: Ladislaus, Stephan, Elisabeth. — Das IV. Register erzählt die Geschichte der hl. Elisabeth nach der Legenda Aurea: Auf dem 1. Bild ist nur noch die großartig umständliche Architektur zu erkennen. Das 2. Bild zeigt oben Jugendepisoden, unten die Vermählung mit dem Landgrafen Ludwig. 3. Szenen aus dem häuslichen Leben der Heiligen; rechts Aufbruch des Landgrafen zum Kreuzzug. 4. Elisabeth die Wohltäterin verteilt Kleidungsstücke und Nahrungsmittel; links oben ihr Gelübde, rechts ihre Christus-Vision. 5. Elisabeth wird von Heinrich von Thüringen aus der Wartburg gejagt; sie findet zunächst in einem Schweinestall Unterschlupf, dann bei den Franziskanern; unten links die Heilige als Krankenpflegerin im Hospital zu Gotha, rechts ihr Tod.
Pietro Cavallini, Jüngstes Gericht, Santa Maria Donnaregina Vecchia (Chor) in Neapel.
Pietro Cavallini, Jüngstes Gericht - Szene aus dem Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen (Blumenwunder), Santa Maria
Donnaregina Vecchia (Chor) in Neapel.
Pietro Cavallini, Jüngstes Gericht - Szene aus dem Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen (Hochzeit und Jugend), Santa
Maria Donnaregina Vecchia (Chor) in Neapel.
Pietro Cavallini, Jüngstes Gericht - Szene aus dem Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen (Frömmigkeit und Almosen), Santa
Maria Donnaregina Vecchia (Chor) in Neapel.
Die gegenüberliegende Wand enthält 2 weitere Heiligenviten nach Jacopo de Voragine (Legenda Aurea): Oben Katharina von Alexandrien (sie weigert sich, auf Geheiß des Kaisers Maxentius eine Schlange anzubeten; disputiert mit Schriftgelehrten; wird auf Befehl des Kaisers verhaftet; Martertod der von Katharina be-
kehrten Doktoren). Darunter die hl. Agnes (sie sitzt als Kind in der Schule; der Sohn des Präfekten erklärt ihr seine Liebe; nach ihrer Weigerung wird sie nackt ins Freudenhaus geführt, doch hüllt ihr wunderbar gewachsenes Haupthaar sie ein; ihr Tod; Costanza, die Tochter Konstantins d. Gr., betet am Sarg der Heiligen, die ihr erscheint und Heilung vom Aussatz verheißt; die Kaisertochter stiftet daraufhin die Kirche S. Agnese fuori le mura in Rom, neben dem Rundbau von S. Costanza, der hier links im Bilde dargestellt ist).
Von der Dekoration der Schiffswände haben sich nur Bruchstücke erhalten: Man erkennt (zwischen den Fenstern der linken Wand) überlebensgroße Standfiguren, Gestalten des Alten und Neuen Testaments paarweise einander zugeordnet, dazwischen jeweils eine Palme. Am Triumphbogen links das Fragment einer Engelshierarchie (im 16. Jh. teilweise übermalt). — Ein weiteres sehr bedeutendes Fresko der Cavallini-Werkstatt befindet sich im Tympanon der W-Wand des Nonnenchors über dem Weltgericht (oberhalb der cinquecentesken Holzdecke); es zeigt im Zentrum eine stehende Maria mit im Orantengestus erhobenen Händen, vor dem Leib einen Clipeus mit dem Kopf des Christkindes: ein byzantin. Motiv (Maria Platytera), das viell. ein damals im Kloster befindliches Gnadenbild reproduziert. Links daneben die Erzengel Michael (mit dem Drachen) und Gabriel (?), dazu noch ein Kreuz und ein Sarkophag.
In der vom Nonnenchor aus zugänglichen Wohnung der Äbtissin befinden sich derzeit 3 Teile des berühmten Freskenzyklus, mit dem der junge Solimena den Chor der Donnaregina Nuova ausgeschmückt hatte; sie wurden während der Restaurierung von 1928 abgenommen und hierher verbracht. — Das Kuppelfresko (Marienkrönung) in der anschließenden kleinen Privatkapelle gilt als Werk des Mattia Preti.
S. Maria Donnaromita (von der griech. Marienanrufung »Kyria romata« = mächtige Herrin; Via Giovanni Paladino bei der Universität) wird schon im 11. Jh. als Nonnenkloster erwähnt. Der gegenwärtige Bau, mit bescheidener Zwei-Ordnungs-Fassade in der Art von SS. Severino e Sossio, stammt von 1535 und wird dem G. Fr. di Palma zugeschrieben. — Das derzeit unzugängliche Innere ist berühmt wegen seiner geschnitzten und vergoldeten Holzdecke, von einem flämischen Meister »Teodoro d’Errico«. Fresken von Giordano und Simonelli, Bilder von De Mura, Micco Spadaro u. a.; marmorner Hochaltar der Brüder Ghetti (1685).
S. Maria Egiziaca a Forcella (Corso Umberto I., Ecke Via Pietro Collella)
1342 durch die Königin Sancha gegr. und später mehrfach verändert; der heutige Ban stammt von Dionisio Lazzari (1684).
Die originelle, aus der Ecksituation entwickelte Fassade hat unten einen 3bogigen Portikus über trapezförmigem
Grundriß, darüber 2 Fenstergeschosse mit Pilasterordnungen. — Das Innere besteht aus einem langgestreckten Ovalraum und einem quadratischen Presbyterium mit Tambourkuppel, alles in Marmor und Stuck dekoriert, mit 4 überaus prächtigen goldenen Orgelprospekten und einer Sängertribüne über dem Eingang; Fußboden und Gewölbe leider modern erneuert.
Am Hochaltar eins der besten Bilder Andrea Vaccaros: die Kommunion der hl. Maria Aegyptiaca. Der bärtige Mönch Zosimo reicht der nach 48jährigem Einsiedlerleben vom Tode gezeichneten Büßerin das letzte Abendmahl; betende und kerzenhaltende Engel umstehen still die nächtliche Szene; im spärlich erhellten Himmel erscheint die Madonna. Seitlich davon die Bekehrung der Heiligen (links) und ihre Flucht in die Wüste (rechts), 2 brillante Nachtstücke von Luca Giordano. — In den Seitenkapellen des Hauptraums weitere Werke der neapolitan. Schule des 17. Jh. 2. Kapelle links: Rosenkranz-Madonna, gerahmt mit Passionsbildern, von Fabrizio Santafede; 3. Kapelle links: am Altar die Madonna mit dem hl. Augustinus und seiner Mutter Monika, von Solimena, seitlich die hll. Tommaso da Villanova und Liborio,-von P. de Matteis und Ferrante Amendola. 2. Kapelle rechts: am Altar S. Anna, von Luca Giordano, seitlich Immacolata und Dreifaltigkeit, von Amendola und de Matteis; 3. Kapelle rechts: Madonna mit Heiligen und, seitlich, die hll. Franziskus und Cajetan, von Solimena (1696).
S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone (in der gleichnamigen Straße oberhalb von S. Lucia)
In ihrer echt neapolitan. Mischung von Größe und genußfroher Eleganz bildet die 1657 begonnene, aber erst 1717 vollendete Kirche einen Höhepunkt im Schaffen des Cosimo Fanzago, dessen Rolle als Baumeister, Bildhauer und Dekorateur im Neapel des 17. Jh. nur mit derjenigen Berninis in Rom zu vergleichen ist.
Ein wuchtiges Rustika-Portal führt von der Straße her in den Vorhof der Kirche. Die Fassade besteht aus einem offenen Portikus (barocke Abwandlung des »Palladio-Motivs« mit neben die Säulen gesetzten Rustika-Pfeilern), der sich über konvex ausladendem Grundriß dem Eintretenden entgegenwölbt; eine Kaskade geschwungener Treppenstufen ergießt sich vom Mitteljoch in den Hof hinab. — Das Innere zählt zu den glücklichsten Erfindungen Fanzagos. Ein wahrhaft befreiender Eindruck geht von der riesigen Kuppelkalotte aus, die durch 8 Stichkappenfenster in hellstes Licht getaucht wird. Der Grundtypus des Raumes
 S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone. Längsschnitt
S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone. Längsschnitt
- griech. Kreuz mit oktogonal ausgeweiteter Vierung, 8 kuppeltragende Säulen — ist von Borrominis röm. Agnese-Kirche (Piazza Navona) abgeleitet; allein die (im Grundrißbild kaum bemerkbare) Umdeutung der Kreuzarme
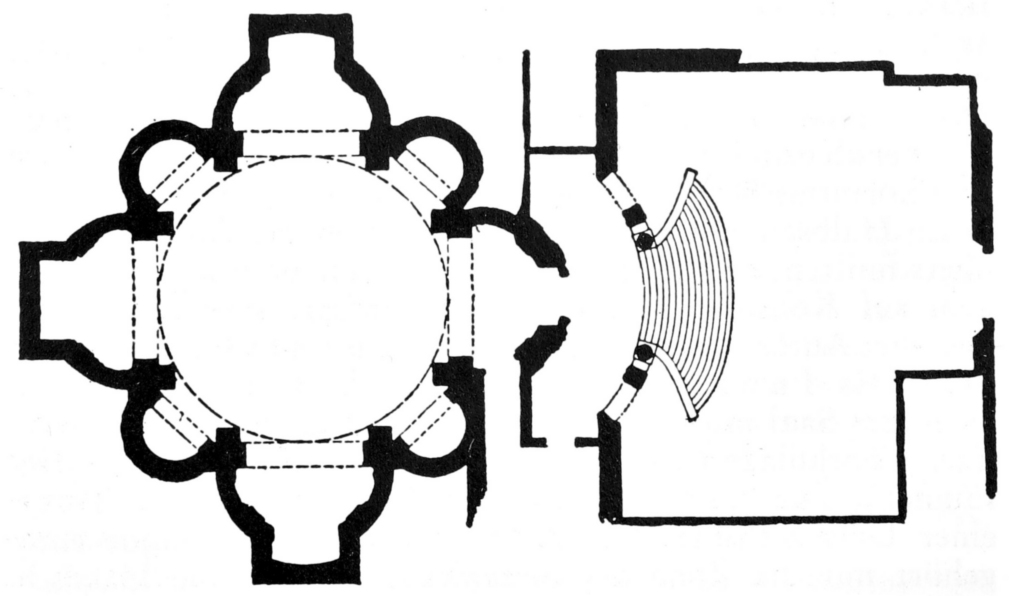 S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone. Grundriß
S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone. Grundriß
und Pfeilernischen in einen ringsumlaufenden Kranz von großen und kleinen Apsiden hat den Vierungsbau in einen allseitig ausstrahlenden Rundraum verwandelt. Die ganz einfache, hell in hell getönte Stuckdekoration hält den größtmöglichen Abstand zur Gravitas des röm. Vorbilds.
Das Hochaltarbild mit Darstellung der Titelheiligen stammt von A. Vaccaro, die übrigen Altarbilder malte P. de Matteis. In den Schrägnischen der Eingangsseite 2 schöne Holzbildwerke: ein drachentötender Michael und ein Tobias mit dem Engel, von Nicola Fumo. (Die in den älteren Guiden verzeichneten Gegenstücke, Immacolata und Kruzifix, scheinen verloren.)
S. Maria delle Grazie (am Toledo, gegenüber der Via A. Diaz). Gegr. 1628, erhielt die Kirche ihre heutige Form i. J. 1835 durch den Architekten Carlo Parascandolo. Flache Pilasterfassade mit großem Giebel. Das Innere eine 3schiffige Pfeilerhalle von breiten und niedrigen Verhältnissen, mit kassettierter Tonne im Mittelschiff und Stutzkuppeln in den Seitenschiffen. Einen schönen Effekt macht die durch eine Laterne hell erleuchtete Chorkuppel als Abschluß des dunklen Langhauses.
S. Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli (am Largo Madonna delle Grazie auf dem höchsten Punkt des Altstadtgebietes, zwischen dem antiken Decumanus Superior [Via Pisanelli] und der Piazza Cavour [Museo Nazionale] gelegen; Inneres nur zwischen 8 und 10 Uhr geöffnet)
Seit 1411 befand sich an diesem Ort eine Niederlassung von Eremitaner-Fratres, die an Stelle eines kleinen Marienoratoriums von 1447 zwischen 1516 und 1560 den heute bestehenden Ban errichteten. Architekt scheint Giovanni Francesco di Palma gewesen zu sein, ein Schüler und Schwiegersohn des Giovanni Donadio und wie dieser »il Mormando« genannt.
Das Äußere der Kirche ist schmucklos bis auf das sonderbar verschachtelte, wohl schon von Serlio angeregte Portal (ein korinthischer Ädikula-Rahmen mit paarweise angeordneten Halbsäulen wird von der vortretenden Türeinfassung überschnitten, der Segmentgiebel durch einen tabernakelartigen, auf Konsolen ruhenden Mittelaufsatz gesprengt), für das die Autorschaft Mormandos dokumentarisch gesichert ist. — Das Innere präsentiert sich als flachgedeckter, geräumiger Saal mit je 6 Seitenkapellen, Querschiff und 3teiliger Choranlage (halbrunde Apsis mit rechteckigen Nebenräumen). Die starke Höhenentwicklung scheint die Folge einer Umgestaltung des 17. Jh. zu sein. Dem Cinquecento gehört nur die Zone der Seitenkapellen an, eine klassisch proportionierte Pfeilerarkade mit gekuppelten Halbsäulen
auf Piedestalen und verkröpftem Gebälk, über und über bedeckt mit reichem, aber, nach Jacob Burckhardts Urteil, »schon ziemlich schwülem« plastischem Zierat. Darüber liegen ein Halbgeschoß mit Wandbildern und der hohe, lichte Fenstergaden, beide mit kräftigen barocken Stuckrahmungen dekoriert. Ein im 18. Jh. über die Wände gelegter Verputz wurde bei einer neueren Restaurierung wieder entfernt. Aus dem frühen 18. Jh. stammt der schöne Fußboden in Marmor und Terrakotta.
Ausstattung. Langhaus: In den Nischen rechts und links des Eingangsportals 2 Grabmäler der Familie Brancaccio, Teile eines großen Wandgrabes aus der 2. Hälfte des 16. Jh., das sich urspr. im Chor der Kirche befand und gegen Ende des 17. Jh. hierher versetzt wurde; die schönen Tugendallegorien (»Giustizia« und »Prudenza«), die jetzt die kniende Figur des Fabrizio Brancaccio flankieren und urspr. als Karyatiden seinen Sarkophag trugen, werden dem Annibale Caccavello zugeschrieben. — Über der Tür Leinwandbilder von Beinaschi, Einzug Christi in Jerusalem und die hll. Onophrius und Hieronymus. — Die Bilder der Seitenwände (Wundertaten Christi) stammen von Beinaschi, Frezza, Castellano u. a. — Über den letzten Langhauskapellen befinden sich 2 prächtige Sängertribünen mit Orgeln des 17. Jh.; die Kanzel am rechten Vierungspfeiler trägt das Datum 1631. — Seitenkapellen, links: 1. Der reich skulptierte Ädikula-Altar mit dem Relief der Beweinung Christi gilt als eines der besten Werke des Giovanni da Nola (1540-49); rechts Wandgrab für Galeazzo Giustiniani, Mitte 16. Jh. — 4. Großes Wandbild (Kreuzigung und Auferstehung) von Bern. Lama. — 6. Hervorragendes Altarrelief (Christus inmitten der Jünger zeigt dem Ungläubigen Thomas seine Wunde) in sehr feiner Rahmenarchitektur, von Girol. Santacroce (1536). — Rechts: 2. Altarbild (B. Nicola da Forca Palena) von Paolo di Maio (1772). — 3. Links ein Reliefaltar (Bekehrung Pauli), dem Annibale Caccavello zugeschr. — S. Marmoraltar von Gius. Sammartino (1768).
Querschiff: An der Oberwand Fresken aus dem Marienleben (Geburt, Traum Josephs, Flucht nach Ägypten, Himmelfahrt), von Beinaschi. — Der linke Querschiffaltar wurde 1811 aus Teilen zweier Marmoraltäre von Giov. Tommaso Malvito zusammengesetzt. Links davon eine Madonna mit den hll. Andreas und Markus, von Marco Cardisco. — Am rechten Querschiffaltar, gleichfalls unter Verwendung von Fragmenten Malvitos im 18. Jh. errichtet, eine Statue des B. Pietro da Pisa von Nicola Fumo; rechts davon eine Madonna und ein hl. Antonius von Padua, wahrscheinl. von Criscuolo.
Chorkapellen: Der Hochaltar hat üppige Marmorintarsien und 2 dem Lor. Vaccaro zugeschriebene Heiligenstatuen; das Bild
der Madonna delle Grazie ist von Fabrizio Santafede. — In der Apsiskalotte Fresken von Andrea Sabatini, übermalt von Beinaschi. — In der rechten Nebenchorkapelle (Cappella de Cuncto) schöne marmorne Zierarchitektur und Wandgrab des Giovanello de Cuncto und seiner Gemahlin Lucrezia Filangieri de Candida, von Giovanni Tommaso Malvito (1517-24); auf dem Altar eine burlesk-realistische Holzfigur des nur mit seinem Bart und einer Efeuranke bekleideten St. Onophrius (18. Jh.). — Von der linken Nebenchorkapelle aus gelangt man durch eine reich geschnitzte Türe in die Sakristei mit feinem Schrankwerk (2. Hälfte 16. Jh.), darüber noch ein ausgedehnter freskierter Marienzyklus von Beinaschi; auf dem Altar der anschließenden Cappella Pisciotta befindet sich eine beachtenswerte Madonnenstatue (Madonna delle Grazie) von G. T. Malvito aus der Cappella de Cuncto; in den Wänden eine Serie höchst zierlicher Wachsfigurengruppen von Fra Benedetto Sferra (1767-74).
S. Maria delle Grazie a Mondragone (Piazzetta Mondragone, ein Stück östl. von S. Carlo alle Mortelle) gehört zu einem 1653 gegründeten Damenkonvent. Die Kirche, in der 1. Hälfte des 18. Jh. von G. B. Nauclerio entworfen, hat eine hübsche Stuckfassade in 2 Ordnungen, mit überaus fein aufeinander abgestimmten kurvigen Giebelkonturen. Das Innere ist leider ständig verschlossen (angeblich Sonntag vormittags Messe).
S. Maria dell’Incoronata (della Corona di Spine; nördl. der Piazza del Municipio an der Via Medina)
Der breite Straßenzug der Via Medina bildete im 14. Jh. als Turnier-und Rennplatz (platea corrigiarum, piazza delle corregge) das Zentrum des Adelsquartiers zu Füßen des Castel Nuovo, dessen mondänes Leben Boccaccio überschwenglich geschildert hat. Eines der prächtigsten Feste, die hier gefeiert wurden, war die am Pfingstsonntag 1352 vollzogene Krönung Johannas I. und Ludwigs von Tarent, des 2. ihrer insgesamt 4 Ehemänner (die zahlreichen offiziellen Liebhaber nicht gerechnet). Ihren 1. Gemahl Andreas von Ungarn hatte diese bemerkenswerte Frau 1345 erdrosseln lassen; als daraufhin der Bruder des Getöteten mit seinem Heer vor Neapel erschien, floh sie nach Frankreich, wo der zu Avignon residierende Papst ihr volle Absolution erteilte.
Wahrscheinl. ist der Bau unserer Kirche und des mit ihr verbundenen Armenhospizes bei diesem Anlaß gelobt und nach der erwähnten Krönungsfeier ins Werk gesetzt worden; der Name »dell’Incoronata« würde dann die Erinnerung an dieses Ereignis festhalten. Auch der urspr. Titel der Kirche, »coronae spineae«‚ weist auf Johanna I. hin, die einen Dorn aus der Krone Christi (der Reliquie der Ste-Chapelle in Paris) vom französ. König zum Geschenk erhielt. Das älteste bekannte Schriftstück, das sich mit Sicherheit auf die Incoronata beziehen läßt, ist eine Urkunde Johannas von 1373: Die Königin spricht darin von einem Bau,
den sie zur Vergebung ihrer und ihrer Vorfahren Sünden vor geraumer Zeit habe errichten lassen (»costrui feci jamdiu«) und noch weiter zu fördern gedenke. Dagegen besitzt ein in der Literatur vorkommender Hinweis auf d. J. 1328 als mögliches Gründungsdatum der Kirche kein nachprüfbares Fundament; rein hypothetisch geblieben sind die Versuche, den Bau mit einer Palastkapelle vom Anfang des Jahrhunderts in Verbindung zu bringen. — In der Folgezeit scheinen Kirche und Hospital unter Leitung der Kartäuser von S. Martino ein recht kümmerliches Leben gefristet zu haben; zu Beginn des 16. Jh. war die Stiftung praktisch erloschen. Im Zuge der Erdarbeiten bei der Neubefestigung des Castel Nuovo z. Z. Karls V. verschwand der größte Teil des Untergeschosses unter dem 3-4 m gestiegenen Straßenniveau; die oberen Partien wurden von Wohnhäusern um-und überbaut. Gegen die Mitte des 18. Jh. ging man daran, den Innenraum neu auszustatten und wieder zur Kirche zu weihen, wobei glücklicherweise der alte Bestand weitgehend erhalten blieb. Eine durchgreifende Restaurierung von 1925 brachte im Innern die Wiederherstellung des got. Originalzustands; an der Außenwand längs der Via Medina wurden 5 Portikusachsen ausgegraben. Nachdem die Bomben des 2. Weltkriegs einen Teil der umliegenden Häuser zum Einsturz gebracht hatten, entschloß man sich, die Kirche von ihren Überbauten zu befreien und auch das urspr. Äußere soweit als möglich wiederherzustellen, wobei eine zeitgenössische Ansicht des Urbaus im Freskenzyklus der Cappella del Crocefisso (s. u.) gute Dienste leistete.
Äußeres. Das interessante Resultat dieser Restaurierungen war die Freilegung der schon erwähnten Portikus-Architektur an der östl. Längswand des Schiffes. Typologisch läßt die Anlage eines derartigen Außenportikus sich am ehesten mit dem Spital in Verbindung bringen, von dessen Lage und Aussehen sonst nichts überliefert ist. Die Einzelformen — antike Spoliensäulen und -kapitelle‚ flache Stichbögen, überfangen von Spitzbogenblenden — erinnern an den Franziskanerkreuzgang von S. Chiara und weisen hier wie dort auf sienesische Vorbilder zurück. — Am nördl. Ende der Arkadenreihe fanden sich Reste des Campanile, den das genannte Fresko im Innern der Kirche zeigt. — In der O-Wand des Langhauses hat man 1925 die urspr. Fensterform wiederhergestellt; die Strebepfeiler des 16. Jh. mußten aus statischen Gründen beibehalten werden. — Auch die schlichte Eingangsfassade ließ sich einigermaßen zuverlässig rekonstruieren (das Portal wurde aus anderweitig versetzten Bruchstücken wieder zusammengefügt); vor ihr muß sich eine Art Atrium befunden haben, das man durch das breite,
rundbogig gewölbte Eingangsjoch der Portikusfront betrat.
Das Innere zeigt die für Neapel einzigartige, im Süden Kampaniens aber gelegentlich anzutreffende Form einer 2schiffigen Gewölbebasilika, deren Wahl hier viell. durch topographische Schwierigkeiten bedingt war. Beide Schiffe sind jeweils 4 Joche tief; dabei haben die Joche des Hauptschiffs leicht querrechteckige, die des etwas schmaleren Nebenschiffs zur Linken annähernd quadratische Grundgestalt. Eine rundbogige Pfeilerarkadenreihe mit ausgekehlten Profilen trennt die Schiffe voneinander; die Kreuzrippengewölbe ruhen auf flachen Konsolen an den breiten Stirnflächen der Pfeiler. Jedes Schiff besitzt an seinem N-Ende eine eigene Chorkapelle: die des Hauptschiffs ist in der Breite leicht eingezogen und etwas nach rechts aus der Achse gerückt; sie hat 2 schmale Rechteckjoche und ein polygonales Chorhaupt aus 3 Seiten des Achtecks; die des Nebenschiffs dagegen ist breiter als dieses und besteht aus einem einfachen Querrechteck.
Die Gewölbefresken im 1. Joch des Hauptschiffs geben ein durch schlechte Erhaltung und vielfache Übermalung getrübtes Bild von der neapolitan. Giotto-Nachfolge der 2. Hälfte des 14. Jh. Unmittelbare Nachklänge der Kunst des großen Toskaners, der sich von 1328-33 in Neapel aufgehalten hatte, spürt man in der teilweise höchst bedeutenden Bilderfindung, der erzählerischen Lebendigkeit und den komplizierten, wenngleich nicht immer richtig durchdachten Architekturen; der Figurenstil wirkt sehr uneinheitlich, die Ausführung im einzelnen vielfach grob und flüchtig. Eine überzeugende Zuschreibung hat sich nicht finden lassen; zu beachten bleibt der Hinweis auf Roberto d’Oderisio, dessen Kreuzigungsbild in Salerno manche Ähnlichkeiten aufweist. — Ikonographisch ist der Zyklus bemerkenswert als eine der frühesten Darstellungen der Sieben Sakramente. Man sieht im südöstl. Gewölbefeld die Taufe; es folgen (im Uhrzeigersinn) die Firmung, die Beichte, das Abendmahl, die Priesterweihe, die Eheschließung und die Letzte Ölung; im 8. Feld thront Christus unter einem zeltartigen Baldachin; vor ihm steht ein hl. Bischof oder Papst mit dem Abendmahlskelch, wohl als Repräsentant der Kirche, die von einem Königspaar (viell. Johanna und Ludwig von Tarent) mit der angiovinischen Lilienfahne verehrt wird. Die ganz fragmentarisch erhaltenen Fresken der Seitenwände zeigen Bilder aus der Geschichte des ägyptischen Joseph und andere alttestamentliche Szenen.
Roberto d'Oderisio, Sakramentsfresken und der Triumph der Kirche, 1328-1333, Santa Maria Incoronata (Schiff, 1. Joch) in Neapel.
Roberto d'Oderisio, Sakramentsfresken - Sakrament der Taufe, 1328-1333, Santa Maria Incoronata (Schiff, 1. Joch) in Neapel.
Roberto d'Oderisio, Sakramentsfresken - Sakrament der Beichte, 1328-1333, Santa Maria Incoronata (Schiff, 1. Joch) in Neapel.
In der Chorkapelle des Nebenschiffs (gen. Cappella del Crocefisso nach einem derzeit entfernten Holzkruzifix von Michelangelo
Naccherino) findet sich ein weiterer Freskenzyklus, der, soweit die fast völlig zerstörten Bilder erkennen lassen, gleichzeitig oder wenig später entstanden sein muß. Am Gewölbe Szenen aus dem Marienleben; an den Seitenwänden vermutl. Bilder aus dem Leben des hl. Martin und der Kartäuser, u. a. links die Übergabe der Incoronata-Kirche an die Mönche (auf älteren Kopien und Photos besser zu sehen).
S. Maria Maggiore (am westl. Ende der Via dei Tribunali)
Die Kirche fährt, ihrer legendären Gründungsgeschichte nach, den ältesten Marientitel der Stadt und ist zugleich eine ihrer frühesten Pfarrkirchen. Der populäre Zuname »La Pietrasanta« ist erst seit dem 17. Jh. nachweisbar; er bezieht sich auf eine früher am Eingang der Kirche angebrachte alte Steintafel mit dem Kreuzeszeichen, die (von den Gläubigen zum Zwecke der Ablaßerlangung geküßt wurde (heute an der Außenwand der Kapelle links vom Hauptportal, unter einem gußeisernen Baldachin mit Wellblechdach von 1904).
S. Pomponio, ein neapolitan. Bischof aus der 1. Hälfte des 6. Jh., soll die Kirche gestiftet, Papst Johannes II. (533-535) den Bau geweiht haben. Ein Autor des 17. Jh. überliefert die pittoreske Vorgeschichte: Es befand sich an dieser Stelle, in der Nähe der Stadtmauer, ein Müllabladeplatz, auf dem der Teufel in Gestalt eines riesigen Schweines sein Unwesen trieb und durch lautes Grunzen ganz Neapel in Angst und Schrecken versetzte. Die ratlosen Bürger suchten den in der Nähe wohnenden Bischof auf und flehten ihn an, das »pestilenzialische Ungeheuer« mit Hilfe der Gottesmutter zu verjagen. Nach einem entsprechenden Bittgottesdienst erschien die Madonna dem Bischof und wies ihn an, die Kirche zu bauen; so geschah es, und das Monstrum ward nicht mehr gesehen. Daraus entstand eine alljährliche Prozession des Klerus von S. Maria Maggiore zum Dom, wo ein Ferkel dem Erzbischof dargebracht und im Dom selbst geschlachtet wurde, »unter großer und festlicher Anteilnahme allen Volkes«. Der erstaunliche Brauch dauerte bis zum Jahre 1625; dann wurde die Opfergabe in einen Golddukaten und später in eine Wachskerze umgewandelt.
Gestalt und Baugeschichte der alten Basilika sind in völliges Dunkel gehüllt; als einziger Überrest hat sich der Campanile, an der rechten vorderen Ecke des Grundstückes stehend, erhalten, der allerdings seinem Stilcharakter nach (Ecksäulen) kaum vor 1100 entstanden sein kann. Der nach kampanischer Art ohne Geschoßunterteilung m die Höhe strebende Baukörper besteht aus reinem, feinem Backsteinmauerwerk (ein seltener Anblick in dieser Tuffsteinstadt); im Unterteil ist antikes Spolienmaterial vermauert; am Glockenstuhl Biforienöffnungen, darüber im Innern ein in
byzantin. Technik mit Tonamphoren ausgeführtes Gewölbe, außen ein massiv gemauertes Pyramidendach.
Die neue Kirche, errichtet 1653-67, war eines der Hauptwerke des Cosimo Fanzago-. Die Bombardierungen von 1942 haben davon nur eine Ruine übriggelassen, freilich von piranesihafter Großartigkeit. Dabei steht fest, daß die Fliegerbomben einen seit langem einsturzbedrohten Bau trafen, der vom 18. Jh. an immer wieder neue, höchst einschnei-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S. Maria del Parto. Grabmal des Jacopo Sannazaro (G A. Montorsoli, B. Ammannati)
dende Reparaturen über sich ergehen lassen mußte. Die Außenansicht zeigt noch das mächtige Eingangsportal, eine prachtvoll gebündelte Pilasterordnung mit »Michelangelo-Kapitellen« (ionisch mit zwischen den Schnecken herabhängenden Festons) und gesprengtem Segmentgiebel, darüber das volutenflankierte Obergeschoß mit reich gerahmtem Mittelfenster und endlich die Rundung der großen Tambourkuppel; alles von wildem Pflanzenwuchs überwuchert und so dem endgültigen Zerfall entgegengehend. — Den Innenraum hat man sich als in die Länge gezogene Kreuzkuppelkirche vorzustellen, eine vereinfachte Version des Themas von S. Giorgio Maggiore, mit Tonnengewölbe über allen 4 Kreuzarmen (eine ganz ähnliche Raumform zeigte in Rom schon S. Carlo ai Catinari, beg. 1612 von Rosato Rosati). Die oblongen Eckkapellen haben wie in S. Giorgio ausgerundete Ecken; darüber liegen Muldengewölbe mit Stichkappen, die von Borromini beeinflußt scheinen. Das dekorative Detail ist, nach alten Abbildungen zu urteilen, sehr sparsam verteilt, dünnlinig und flach, ohne plastisches Eigenleben; bemerkenswert das unverkröpft ringsumlaufende Hauptgebälk, das alle Kompartimente zusammenbindet und das räumliche Einheitsmoment des Ganzen betont.
S. Maria Maddalena dei Pazzi del SS. Sacramento (Via Salvator Rosa) gehört einem 1646 gegründeten Karmeliterinnenkloster. Die Kirche, ein einfacher Saalbau mit Vierungskuppel und schönem Stuckdekor, soll gegen Ende des 18. Jh. von Pompeio Schiantarelli erneuert worden sein. Am Hochaltar (derzeit in Restaurierung) ein oft gerühmtes Bild von Luca Giordano (Maria Magdalena).
S. Maria Mater Domini (S. Maria dei Pignatelli; Piazzetta F. Pignatelli [Montesanto], oberhalb der Chiesa dello Spirito Santo), ein hübscher kleiner Saalbau der Renaissance mit pilastergerahmter Giebelfront, der als Familienkapelle der Pignatelli zu einem 1573 von Fabrizio Pignatelli gegründeten Pilgerhospital (vgl. SS. Trinità dei Pellegrini) gehörte. Links vom Altar das Grabmal Fabrizios, 1590 in Auftrag gegeben, aber lt. Inschrift erst 1609 vollendet, von Michelangelo Naccherino. In einer prachtvollen Marmor-Ädikula kniet die Bronzefigur des Verstorbenen, »wahrhaft tonangebend an der Schwelle des barocken 17. Jahrhunderts, sehr spanisch anmutend in der Verbindung von hagerer Askese und inbrünstiger Devotion mit aristokratischem Gebaren« (Leo Bruhns). In der Sakristei, unter allerlei Gerümpel verborgen, eine schöne marmorne Madonnenfigur von Francesco Laurana, sehr ähnlich der Statue über dem Portal der Barbara-Kapelle im Castel Nuovo.
S. Maria dei Miracoli (S. Maria della Providenza; an der gleichnamigen Piazza oberhalb der Via Foria), ein konventioneller 1schiffiger Bau von F. A. Picchiatti (1662-75), besitzt einen großen Zyklus von Wand- und
Gewölbefresken des Stanzione-Schülers Andrea Malinconico, schwer und düster. Von demselben der hl. Michael am rechten Querschiffaltar. Links gegenüber eine Immacolata von Giordano, bei fein gedämpfter Tonigkeit von größtem farbigem Reiz. Hinter dem Hochaltar eine Hl. Dreifaltigkeit mit der Madonna, dem hl. Joseph und anbetenden Nonnen von A. Vaccaro.
S. Maria di Montesanto (Hl. Maria vom. Berge Karmel; an der gleichnamigen Piazza [Station der Funicolare Montesanto und der Ferrovia Cumana]), ehem. Karmeliterkonvent, heute Pfarrkirche, wurde in der 2. Hälfte des 17. Jh. von Pietro de Marino erbaut, kurz vor 1680 von Dionisio Lazzari vollendet. — Das Innere ein Saal mit Seitenkapellen und tambourloser Vierungskuppel, Stuckdekorationen des späten 17. Jh. Am 3. Altar rechts eine hl. Cäcilie von Gius. Simonelli, davor die bescheidene Grabstätte des Komponisten Alessandro Scarlatti (1660-1725).
S. Maria di Montevergine (»le Monteverginelle«; Via G. Paladino, zwischen Piazza Nilo und »Rettifilo«, gegenüber der Universität; Inneres nur Sonntag morgens geöffnet)
An Stelle eines alten Marienoratoriums (S. Maria di Alto Spirito) gründete Bartolomeo di Capua, Rechtsgelehrter und Protonotar Karls [Land Roberts d. Weisen, 1314 eine der Madonna von Montevergine (bei Avellino) geweihte Klosterkirche. 1588 wurde der heute bestehende Bau errichtet. Das Innere 1728 durch D. A. Vaccaro neu dekoriert; 1843 restauriert.
Die breitgelagerte Fassade, mit dorisch-korinthischen Pilastern und Blindfenstern gegliedert, ist stilistisch der von S. Maria Regina Coeli verwandt. — Das Innere, ein Saalraum mit gewölbten Kreuzarmen und Kuppelvierung, hat Deckenbilder von D. A. Vaccaro und im Querschiff Gewölbefresken von Corenzio. Am linken Querschiffaltar eine Marienkrönung von Santafede, gegenüber die hll. Petrus und Paulus von Francesco de Maria. Schönes Chorgestühl (Ende 16. Jh.), darüber 2 große Historienbilder aus der Geschichte der Madonna von Montevergine von C. Giannini und F. Amendola.
S. Maria ai Monti (auf der Kuppe eines Hügels nordöstl. von Capodimonte)
Man fährt ostwärts des Albergo dei Poveri bergan (Via SS. Giovanni e Paolo, Via Nicola Nicolini), passiert die mit rotem Backstein verkleideten Bögen des Serino-Aquädukts (»Ponti Rossi«, vgl. S. 457) und findet weiter oben eine kleine Straße, die zur Kirche hinaufführt.
Es handelt sich um einen 1607 von Carlo Carafa gegründeten Konvent der »Pii Operai« von S. Giorgio Maggiore (heute Padri Passionisti). Die sehr reizvolle Kirche, wohl erst in der 2. Jahrhunderthälfte entstanden, gilt als Werk Fanzagos.
Die Fassade, mit flachen Pilastergliederungen in rot-gelbem Verputz, hat eine 3bogige Vorhalle. — Das Innere ist ein zentraler Kreuzkuppelbau. Der um ein Joch verlängerte
Eingangsarm enthält eine Orgeltribüne; an das etwas eingezogene Chorjoch schließt sich eine Halbrundapsis mit Stichkappengewölbe. Über der leicht erweiterten Vierung sitzt eine tambourlose Kuppel; die Nebenräume in den Kreuzarmwinkeln sind (wie in Fanzagos S. Teresa a Chiaia) in 2 Geschosse unterteilt, unten kreuzgratgewölbte Durchgangsräume, oben Coretti. Eine Pilasterordnung mit reichen Verkröpfungen wird begleitet von grau-weißen Rahmen und Putzfeldern, die in der Gewölbezone einige zarte Schnörkel bilden. Kräftige Akzente setzen die Querschiffaltäre, leicht konvex aufgebogene Ädikulen mit kurvig gebrochenen Segmentgiebeln. Wohlerhalten der schöne Fußboden aus Marmor und Backstein.
Am Hochaltar eine von Carlo Carafa gestiftete Madonna mit Heiligen von Girolamo d’Arena; im Chorjoch rechts und links Fresken in der Art Muras.
S. Maria la Nova (an einem ehemals idyllischen Plätzchen am Beginn der gleichnamigen Straße, die von der Via Montoliveto nach () abzweigt)
Urspr. der Maria Assunta, seit 1910 der Maria delle Grazie geweiht. Ihrer Gründungsgeschichte nach ist sie die älteste Franziskanerkirche der Stadt: Als die 1229 errichtete erste Niederlassung des Ordens (S. Maria a Palazzo) nach 1279 dem Bau des Castel Nuovo weichen mußte, wies König Karl I. den Brüdern für ihre »Neue Marienkirche« das hiesige Gelände zu. Die 3schiffige Kirche wurde 1596 wegen Baufälligkeit niedergerissen und durch den heute bestehenden, später im Innern mehrfach restaurierten Bau ersetzt. Schon 1599 konnte der Neubau eine erste Weihe erhalten. Ein Architektenname ist nicht überliefert; die in der Literatur vorkommende Zuschreibung an einen Agnolo oder Cesare Franco entbehrt des historischen Fundaments.
Die Gliederung der Fassade — hoher Sockel, 2 gleichartige korinthische Pilasterordnungen, Dreiecksgiebel — wirkt frührenaissancemäßig einfach und zart; nur das Portal mit den beiden Granitsäulen und dem Madonnen-Tondo über dem Türsturz weist auf die späte Entstehungszeit hin. Eine breitgelagerte Doppelrampentreppe führt zum Eingang hinauf; am linken Aufgang steht eine kleine offene Ädikula, Grabkapelle der Familie Fasano (1624); daneben die vorspringende Außenwand der Cappella S. Giacomo della Marca mit einfacher Rahmengliederung von, 1504. — Das Innere präsentiert sich als geräumiger Saal mit Seiten«
kapellen, hohem Lichtgaden und flacher Kassettendecke; hinter dem weit einspringenden Triumphbogen liegen ein Querschiff mit Kuppelvierung und ein langer tonnengewölbter Rechteckchor. Die Wände wurden seit 1663 mehrfach neu dekoriert; die Stuckmarmorverkleidung stammt von 1859.
Ausstattung. Langhaus: Die reich vergoldete Holzdecke entstand 1598-1600 (letzte Restaurierung 1924/25). Sie enthält 3 große Leinwandbilder: auf dem ersten, von Francesco Curia, bringt ein vom Himmel herabfahrender Engel eine viell. als Marianisches Symbol (»corona aurea«) deutbare Krone; das zweite stellt die Himmelfahrt Mariae dar (von Francesco Imparato, 1601), das dritte ihre Krönung (von Fabrizio Santafede). Die Nebenbilder der Decke (Heilige, alttestamentliche Könige, Mariensymbole) stammen von Corenzio und Rodriguez. — Gorenzio schuf auch die Fresken zwischen den Oberfenstern des Schiffes; sie stellen die 12 Artikel des Credo dar. — Die Lünettenfelder über den Kapellenbögen tragen Tugendallegorien von Nicola Malinconico (1701). — An den Pfeilern zwischen den Seitenkapellen befinden sich Altäre mit Bildern vom Anfang des 17. Jh., die meisten von Francesco Imparato und seinen Schülern. — Am letzten dieser Seitenaltäre links die marmorne Statue der »Madonna dell’arco« von Lazzaro Marasi (1610); rechts gegenüber ein Verkündigungsrelief, Anfang 16. Jh. — 2 weitere plastische Wandaltäre stehen an den dem Schiff zugewandten Flanken der Vierungspfeiler: links eine anonyme Maria Addolorata, rechts, inmitten einer Marmor-Ädikula mit den hll. Franziskus und Markus (1. Evangelisten, eine schöne hölzerne Ecce-Homo-Figur in alter farbiger Fassung (1950 freigelegt), von Giovanni da Nola. — Die Marmorkanzel mit dem Relief der Stigmatisierung des hl. Franz von 1618, die beiden Orgeln von 1663.
Die 2. Seitenkapelle links bildet den Durchgang zur großen Cappella di S. Giacomo della Marca, zu Ehren dieses 1476 verstorbenen Fraters errichtet von Consalvo Fernandez von Cordoba, Gran Capitano der spanischen Krone und 1. Vizekönig von Neapel (1503-07). Die Kapelle wurde bei der Niederlegung des alten Langhauses geschont und in den Neubau einbezogen, um die Mitte des 17. Jh. von Cos. Fanzago neu ausgestattet und 1925 durchgreifend restauriert. — Das Tonnengewölbe des Hauptraums enthält Fresken von Massimo Stanzione mit Szenen aus dem Leben und Nachleben des populären Heiligen, dessen wundertätiger Körper, in einer Prozession herumgetragen, den Vesuv-Ausbruch von 1631 zum Stehen brachte. — Zu seiten des Hauptaltars die Gräber zweier französ. Kommandeure aus dem Feldzug von 1528, des Grafen Lautrec und des Pietro Navarro, von Annibale Caccavello (1550). — Seitenkapellen (der Cappella di S. Giacomo) links: 1. Madonna della Purità, Heimsuchung und
Hl. Familie, von Francesco de Maria; Fresken von Giacinto dei Popoli (1660). — 2. Schöne Marmorstatue Johannes’ d. T. von Pietro Bernini, 1599 (man beachte die Ähnlichkeit mit dem Johannes von G. d’Auria, S. 95); die exzellenten (leider stark restaurier.) Fresken aus dem Leben des Täufers stammen von Luca Giordano. — 3. Fresken (S. Diego) viell. von Stanzione, die beiden Aquino-Gräber und die Nischenfiguren der hll. Thomas und Andreas von Ercole Ferrata. — Seitenkapellen rechts: 1. Geburt Christi von Leandro Bassano. — 2. Marmoraltar mit Statuen der Madonna und der hll. Franziskus und Bernhardin, von Girolamo d’Auria; von demselben wahrscheinl. das Turbolo-Grab an der linken Seitenwand. — Von der 3. Seitenkapelle aus führt eine Tür in den kleinen Kreuzgang, s. u.
Zurück ins Hauptschiff der Kirche, Seitenkapellen links: 4. Das feine Grabmal des im Alter von 24 Jahren verstorbenen Herzogs von Arpino, Alfonso Caracciolo-Santeodoro, von D. Morante (1853). Hier und in den folgenden Kapellen Fresken von G. B. Beinaschi. — 5. Altarbild (hll. Antonius von Padua, Giovanni da Capistrano und Pasquale Baylon) von Giuseppe Castellano (1719). — Seitenkapellen rechts: 1. Grabmäler des Geronimo und des Luigi Sanseverino (+ 1559 und 1623); Altarbild (hl. Michael) von Marco Pino; das unten angefügte Stück vermutl. von Battistello Caracciolo, dem auch die Engel in der Kuppel zugeschrieben werden. — 2. Sehr schönes Marmorrelief (Geburt Christi) in der Art des Girolamo Santacroce. — 3. Kreuzigung von Marco Pino. — Die 4. Kapelle enthält den berühmten Eustachius-Altar, eines der Hauptwerke der neapolitan. Holzskulptur vom Anfang des 16. Jh., im barocken Rahmenwerk, 1950 sorgfältig restaur. (Freilegung der originalen Farbfassung) und von der neueren Kritik einmütig dem Giovanni da Nola zuerkannt. Das zentrale Reliefbild zeigt die Vision des Eustachius, flankiert von den Nischenfiguren der hll. Franziskus und Sebastian; im Obergeschoß Geburt Christi und Verkündigung; in der Predella Szenen aus der Eustachius-Legende.
Querschiff: Fresken von Beinaschi; die beiden großen Leinwandbilder an den Schmalwänden über den Seitenkapellen — Anbetung der Hirten und der Könige — gehören zu den frischesten und besten Werken des Stanzione-Schülers und Giordano-Nachahmers Andrea Malinconico (1701). — Der gewaltige Marmoraufbau des Hauptaltars geht auf einen Entwurf Cos. Fanzagos zurück. Sein fast stets verhülltes Marienbild stammt von Bartolomeo di Guelfo da Pistoia (1509); die Statuen (Antonius und Franziskus) von Agostino Borghetti, die bronzenen Putten von Raffaele Mytens. — Vor dem Altar die Grabplatte der 1517 verstorbenen Königin Johanna III., der letzten Gemahlin Ferrantes I. Links Grabmal der Familie d’Afflitto, Grafen von Trivento, Ende 16. Jh. Über den Figuren der Verstorbenen, Fabio, Michele und Ferdinando, Reliefs mit Darstellungen aus der Legende des
hl. Eustachius, den die Familie d’Afflitto — Stifter auch des Eustachius-Altars im Langhaus — zu ihren Vorfahren zählte; der Name weist auf die Martern (afflizioni) hin, die der Ahnherr zu erdulden hatte.
In der Hauptchorkapelle ein umfangreicher Freskenzyklus — Marienleben und darauf bezügliche biblische Gestalten, Tugenden, etc. — von Corenzio; Chorgestühl von 1603. — Die linke Nebenchorkapelle enthält das berühmte Gnadenbild der Kirche (Madonna delle anime purganti), über und über von Exvoten bedeckt, von Angelillo Arcuccio (15. Jh.); die rechte enthält ein sehr schönes hölzernes Kruzifix von Giovanni da Nola (um 1520).
Durch die rechte hintere Seitentür der Cappella di S. Giacomo (s. 0.) erreicht man den kleinen Kreuzgang, einen hübschen Quattrocento-Hof von 5 x 4 ionischen Arkaden mit im 19. Jh. restaurierten bzw. übermalten Fresken von Simone Papa (Leben des S. Giacomo della Marca). An den Wänden Grabmäler aus der alten Kirche; beachtlich dasjenige des Sanzio Vitagliano und seiner Gattin Ippolita Imperato, 1496, in der Art des Isaia da Pisa; ferner das des Matteo Ferillo von 1499 sowie dasjenige des Costantino Castriota, Bischofs von Isernia, eines Enkels des großen albanischen Türkenbezwingers Giorgio Castriota »Scanderbeg« (1500). — Von hier aus Zugang zum ehem. Refektorium, einem großen Saal mit auf Konsolen ruhenden Kreuzgratgewölben; an den Schmalwänden stark verschmutzte und teilweise beschädigte Fresken: Links ein Zyklus aus dem Marienleben (im Zentrum die Anbetung der Könige, ferner Marienkrönung, Heilige, Verkündigung und Geburt Christi, um 1500); das Monogramm am Bogen der Inschrift scheint auf einen in diesen Jahren einige Male urkundlich erwähnten Magister Loisius Abbas zu deuten; gegenüber eine große vielfigurige Kreuztragung in weiträumiger Landschaft, von einem oberitalienisch geschulten Meister (viell. aus dem Umkreis des Antonio Solario) vom Ende des 15. Jh. — Der große Kreuzgang (Zugang von der Straße her links neben der Cappella S. Giacomo), ebenfalls ionisch mit 99 Arkaden und lustigem Rokoko-Stuck unter den Portiken, umschließt einen wohlgepflegten Garten; die von hier aus sichtbare Seitenwand der Kirche zeigt noch die Struktur des 13. Jh. (Rundbogenfries).
S. Maria della Pace (urspr. S. Maria Assunta; Via dei Tribunali / Ecke Vico della Pace, in der Nähe des Castel Capuano)
Als Teil eines 1587 von den Frati di S. Giovanni di Dia gegründeten Hospitals wurde die Kirche, genannt nach dem 1659 zwischen Ludwig XIV. und Philipp IV. geschlossenen Frieden, 1629 von P. de Marino begonnen und 1739 restauriert.
Die Kirche ist heute wegen Baufälligkeit versperrt. — Von dem zu Beginn des 15. Jh. erbauten Palast des Gianni Caracciolo, in dem das Hospital eingerichtet wurde, hat sich das Vestibül mit dem schönen Portal erhalten (Nr. 227), das dem Typus eines roman. Kirchenportals folgt (stufenweise einspringende Gewände und Archivolten, in den Kehlen Dienste und Rundstäbe); im Innern 2 geräumige Pfeilerhöfe; der große Krankensaal enthält Fresken von Giac. Diana und ein ausgezeichnetes Altarbild von Solimena (Wunder des S. Giovanni di Dio, 1691).
S. Maria del Parto (Mariae Niederkunft; am Fuße des Posillipo, über dem alten Fischerhafen Mergellina [Porto Sannazaro])
Die Kirche sollte ihrer Entstehungsgeschichte nach eines der reizvollsten Denkmäler des italien. Renaissance-Humanismus bilden, ist jedoch von den Zeitläuften bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verändert worden.
Am 26. Juni 1496, dem Tage seiner Thronbesteigung, setzte König Federico von Aragon seinem treuen Humanisten und Dichter Jacopo Sannazaro (1458-1530) eine Pension von 600 Scudi aus und beschenkte ihn überdies mit einem am Strande von Mergellina gelegenen Landgut. »Fecisti vatem, nunc facis agricolam« (Du warst ein Dichter, nun bist du Bauer), sagte sich Sannazaro, zog nach Mergellina, erfreute sich am einfachen Leben der Fischer und Landleute und komponierte eine Reihe von Idyllen (Eclogae Piscatoriae), die einen ganz neuen Ton elegischer Naturschwärmerei in die italien. Literatur einführten. 1526 erschien sein berühmtes Epos »De partu virginis«, eine poetische Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte, in dem er von einem Altar spricht, den er »in culmine Mergellina« der Jungfrau errichtet habe. Es handelte sich um eine 2geschossige Kapelle, deren unterer Raum der Geburt Christi gewidmet war und, wie wir aus anderen Quellen erfahren, eine von Giovanni da Nola geschnitzte Krippengruppe enthielt (s. u.); den Eingang schmückte das Distichon: »Bruta deum agnoscunt. O rerum occulta potestas / qui sacro egreditur virginis ex utero.« Das obere Stockwerk diente dem Kultus des S. Nazarius, des »heiligen, väterlichen Numens«. Im Verlauf der kriegerischen Ereignisse d. J. 1528 (Belagerung Neapels durch die Franzosen unter dem Grafen von Lautrec) wurden Villa und Garten zerstört; die Kapelle aber blieb erhalten. Sannazaro vermachte sie 1529 den Fratres von S. Maria dei Servi, mit der Auflage, ihm hier ein Grabmal zu errichten, für das er genaue Anweisungen und ein Legat von 100 Scudi hinterließ. — In der Folgezeit wurde die Unterkirche von den Serviten als Begräbnisstätte und Beinhaus, später als Rumpelkammer benutzt; sie scheint völlig verkommen zu sein und ist heute nicht zu betreten. Die über eine aussichtsreiche Terrasse zugängliche Oberkirche wurde im 17. und 19. Jh. durchgreifend restauriert, wird 1896 wiederum als einsturzgefährdet bezeichnet und ist seitdem abermals renoviert worden; wie weit der heutige Baubestand auf den Urbau Rückschlüsse zuläßt, ist ohne genauere Untersuchungen nicht anzugeben.
Relativ unversehrt scheint allein der hinter dem Altar gelegene Chor mit hohem Kreuzgewölbe über quadratischem Grundriß; er enthält Sannazaros Grab (Tafel S. 208), eines der interessantesten Bildwerke der Spätrenaissance in Neapel. Der Auftrag ging 1536 an den Servitenbruder Giovanni Angelo Montorsoli, einen
Schüler und Mitarbeiter Michelangelos (das am Sockel angebrachte Monogramm wird gelesen: »Frater Joannes Angelus florentinus ordinis servorum faciebat«); dieser scheint sich jedoch in größerem Umfang der Hilfe jüngerer Kräfte bedient zu haben. So gilt heute nur der auf hohen Konsolen ruhende Sarkophag mit seinem plastischen Schmuck als Arbeit Montorsolis, während wir in dem ganzen Unterteil des Monuments, einschließlich der beiden Sitzfiguren, eines der frühesten Werke des Bartolomeo Ammannati erblicken dürfen; das Mittelrelief wird dem Silvio Cosini zugeschrieben. (Die einzelnen Teile wurden in Carrara bzw. Pisa gearbeitet und erst an Ort und Stelle zusammengefügt.) Zum urspr. Bestand des Grabmals gehören außerdem die beiden seitlich aufgestellten Nischenfiguren: ein jugendlicher St. Nazarius, von Ammannati, und der bärtige Apostel Jakobus, von Montorsoli — die einzigen christl. Elemente in der Ikonographie dieses Dichtergrabes, deren Sinn sich überdies in der figürlichen Darstellung des Namens »Jacopo Sannazaro« erschöpft. Als Sitzfiguren erscheinen über den Wappenfeldern des Sockels der Musenführer Apoll (formal ein Nachfahre des Giuliano von Michelangelos Mediceer-Gräbern in S. Lorenzo zu Florenz), der nach der Gewohnheit der Zeit als Leier eine Viola hält (vgl. Raffael, Dosso Dossi), und Athene mit Helm und Medusenschild. Weitere heidnische Gottheiten zeigt das Mittelrelief, ein Bild aus Sannazaros Arcadia: Artemis und Poseidon, Pan und Marsyas oder sonst irgendein wilder, in Fesseln geschlagener Naturgeist, dessen Fischschwänzigkeit wohl die amphibische Natur des Ortes andeuten soll, lauschen dem Saitenspiel der Erato. Einen dezenten Hinweis auf die Vergänglichkeit alles Irdischen liefert das von kindlichen Todesgenien gehaltene Stundenglas an der Vorderseite des Sarkophages; über sie triumphiert der Nachruhm des Dichters, repräsentiert durch lorbeerbekränzte Trophäen, die 2 athletisch gebaute Putten mit michelangelesker Energie auf dem Sarkophagdeckel festhalten. Zwischen ihnen steht Montorsolis hochbedeutende Bildnisbüste. An ihrem Sockel liest man die Worte ACTIVS SINCERVS; es ist der beziehungsreiche, aus einem lateinisch-hebräischen Wortspiel gebildete Dichtername, unter dem Sannazaro in Pontanos »Sodalitas« (s. S. 263) figurierte. Er taucht wieder auf in der von Pietro Bembo verfaßten Sockelinschrift, die den Besucher auffordert, dem. Dichter Blumen zu spenden, welcher durch seine Kunst wie durch seine Grabstätte der Nachbar Vergils genannt werden dürfe (eine Anspielung auf die nahe »Tomba di Vergilio«, S. 467). Nicht allzuviel freilich von der weltfroh-paganen Grundstimmung dieses Programms ist in die äußere Form des Grabmals eingegangen: Dafür sorgte die Realisierung durch Künstler des Michelangelo-Kreises, deren Verhältnis zur Antike nichts weniger als naiv war, und zu einem Zeitpunkt, als die Hochrenaissance schon zu Ende ging und die Idee einer Wiederbelebung des heidnischen Altertums zum Ideal formaler Antikennachahmung verblaßte. Den radikalen Gesinnungswandel des späteren Cinque-
cento illustriert die »interpretatio cristiana« der beiden Götterfiguren als David und Judith (Basisinschriften) — eine nachträglich vollzogene Nottaufe, die sie vor dem Zorn eines spanischen Vizekönigs gerettet hat, dessen frommer Sinn keine Heidengötter im Bereich eines christl. Altars dulden mochte. — Erst das endende 17. Jh. dachte liberal genug, in den Fresken der Chorwände (von Nic. Rossi, 1699) das Thema des Grabmonumentes fortzuspinnen: Hier erblickt man Venus, Merkur, den Parnaß mit Pegasus und der Hippokrene und eine geflügelte Fama, welche die Büste des Dichters krönt; den Stammplatz der Evangelisten in den 4 Gewölbekappen nehmen Allegorien der Wissenschaften und Künste ein.
Das Grabmal des Jacopo Sannazaro in Santa Maria del Parto, Kupferstich aus Francois Maximilien Misson: Nouveau voyage d'Italie,
1702.
An den Seitenwänden des Chores stehen 4 Holzfiguren aus der Unterkirche, Überreste der großen Krippe von Giovanni da Nola, aus der durch den Bildschnitzer Pietro Belverte (s. S. 100) bestimmten Frühzeit des Künstlers. Während Maria und Joseph, mit scharf ausgeprägten Charakterköpfen, durch frühere Restaurierungen hoffnungslos entstellt sind, hat man an den beiden knienden Hirten kürzlich die sehr feine Originalfassung freilegen und ergänzen können. »Sie bekunden ihre Liebe in rührender Weise durch ihre Gaben; der von Wind und Wetter zerzauste Alte brachte ein Schaf, der Junge — er ist kein Geistesheld — trägt mit aller Vorsicht ein Gefäß mit Milch, und an seinem Gürtel hängt ein Brot in Kringelform« (Rudolf Berliner). Ihr urspr. Aufstellungsort war eine Art Grottenanlage hinter dem Altar der Unterkirche. Die Skulpturen standen in den Durchlässen eines apsisförmigen Ganges; Ochs und Esel sowie weitere Hirten in einer Landschaft waren auf die Rückwand gemalt.
Der 1. Seitenaltar rechts des Langhauses hat ein hübsches Bild des Leonardo Grazia da Pistoia (1542), das sich unter dem Titel Il diavolo di Mergellina höchster Popularität erfreut: Ein geharnischter St. Michael triumphiert über den Teufel in Gestalt eines Weibes, angebl. einer schönen Neapolitanerin, die dem Kardinal Diomede Carafa unsittliche Anträge gemacht haben soll, auf welche dieser Kirchenfürst allerdings nicht einging; die Inschrift ET FECIT VICTORIAM HALLELUIA feiert, so will es die Legende, den Sieg des Tugendhelden über die Versucherin.
S. Maria della Pazienza (Via Salvator Rosa; nach ihrem Stifter Annibale Cesareo auch La Cesarea gen.). Ein einfacher Saalbau mit Flachdecke, der zwischen 1601 und 1636 restauriert, im letzten Kriege beschädigt und vor kurzem wiederhergestellt wurde. An der linken Seitenwand das würdigstrenge Grabmal des Stifters mit schöner Statue von Michelangelo Naccherino (1613).
S. Maria delle Periclitanti (auch SS. Pietro e Paolo; Salita Pontecorvo) ist die Kirche eines 1674 gegründeten Nonnenklosters und Mädchenheims (fanciulle pericolanti, neapolitanisch periclitanti). Der 1702 vollendete Bau — ein einfacher Saalraum mit flachen Seitenkapellen und Tonnengewölbe mit Stichkappen — gilt als eines der ersten Werke Ferdinando
Sanfelices. Die Apsis zeigt bereits die für diesen Architekten charakteristische Neigung zu polygonalen Grundrißformen; die Stuckdekorationen lassen den Einfluß Fanzagos erkennen. — Im 19. Jh. verlassen und während des 2. Weltkriegs schwer beschädigt, scheint das sehr reizvolle Gebäude heute dem Verfall anheimgegeben.
S. Maria del Pianto (auf der aussichtsreichen Kuppe des »Monte di Leutrecco« — nach dem Hauptquartier des Grafen v. Lautrec, Befehlshabers der französ. Belagerungstruppen von 1528 — im Friedhofsbezirk von Poggioreale), 1658-62 als Votivkirche der Bürgerschaft über einem Massengrab des Pestjahres 1656 errichtet. Der Entwurf des quadratischen Saalbaus mit 4 flach geschlossenen Kreuzarmen und Doppelturmfassade geht viell. auf F. A. Picchiatti zurück; die Bauleitung hatte Pietro de Marino. Nach dem Erdbeben von 1805 wurde die Kirche durchgreifend restauriert. — Aus der Bauzeit stammen die 3 großen Altarbilder. Am Hochaltar die Fürbitte Mariens bei Christus dem Weltenrichter für die Seelen der ohne Sterbesakrament verschiedenen Pestopfer, eine großartig pathetische Komposition des reifen A. Vaccaro. — In den Querarmen 2 frühe Meisterwerke Luca. Giordanos, stilistisch wie ikonographisch auf neuen Wegen. Links wieder eine Fürbitte: der Jungfrau hat sich S. Gennaro zugesellt; Christus trägt sein Kreuz, ein Erzengel stößt das Schwert in die Scheide, zum Zeichen, daß die Heimsuchung ein Ende hat. Am unteren Bildrand aber erblickt man, statt der armen Seelen, ein schauerliches Leichenfeld vor den Mauern der Stadt. — Rechts der Gekreuzigte auf Golgatha, einer Gruppe von fürbittenden Stiftern und Geistlichen zugeneigt; in den Wolken die tröstliche Erscheinung Gottvaters.
S. Maria di Piedigrotta (am Eingang des großen Posillipo-Tunnels neben der Bahnstation Mergellina)
Die Kirche rühmt sich eines Gnadenbildes von welthistorischer Wirksamkeit — hier erflehte Don Juan d’Austria im August 1571 den Sieg in der bevorstehenden Seeschlacht gegen die Türken, die dann bei Lepanto geschlagen wurden — und steht im Mittelpunkt eines der ältesten Volksfeste von Neapel. Die Eignung des Platzes zum Festefeiern scheint schon von den Alten erkannt werden zu sein; jedenfalls hält die Lokalforschung sich hartnäckig überzeugt, gewisse priapische Mysterienkulte, von denen Petronius Kunde gibt, hätten hier ihren Ort gehabt. Das neuzeitliche Piedigrotta-Fest, alljährlich in der Nacht vom 7. zum 8. September begangen, entwickelte sich im frühen 17. Jh. zur solennen Staatsaktion. Aus dem pomphaften Aufzug des Vizekönigs und seines Hofstaates entlang der Riviera di Chiaia wurde mit der Zeit eine allgemeine Militärparade, an der noch Garibaldi sich zu beteiligen Gelegenheit fand; seither geben so. a. die Volksdichter und -sänger sowie in neuester Zeit die Pyrotechniker den Ton an.
Vom alten Bestand der Kirche ist nach 7 Jahrhunderten Baugeschichte nicht viel übriggeblieben. Die älteste Nachricht über ein Marienheiligtum am Fuß der »Grotte« von Posillipo (s. S. 466) stammt aus d. J. 1207; etwas später (1276) wird ein damit verbundenes Hospital erwähnt. 1353 erschien einem in der Nähe der Grotte hausenden Eremiten die Madonna und befahl die Errich-
tung eines Neubaus; da ein Mönch von S. Maria a Cappella und eine Nonne von S. Pietro a Castello von ähnlichen Visionen zu berichten wußten, kam bald das nötige Geld zusammen. Beim Ausheben der Fundamente stieß man zur freudigen Verwunderung des versammelten Volkes auf eine in der Erde liegende Statue der Muttergottes. Ihr Kult breitete sich mit Windeseile aus, hat aber wohl auch schon ältere Ursprünge gehabt; so schwört bereits Boccaccio in einem 1349 datierten Brief bei der »Madonna de Pederotto«, und Petrarca beschreibt in seinem gegen Ende der 30er Jahre verfaßten »Itinerarium Syriacum« den ständigen Zustrom der Seeleute, die sich des Beistandes der Piedigrotta-Maria versichern wollten. — König Alfons von Aragon übergab die Kirche den Kanonikern des Laterans; für diese errichtete Don Vincenzo Galeoto, Bischof von Squillace, um 1500 den benachbarten Konvent. Gleichzeitig wurde die Kirche durchgreifend erneuert und umorientiert, das alte Langhaus zum Chorarm gemacht und eine neue nach O gewendete Eingangsfassade errichtet. 1818-22 ließ König Ferdinand I. den Bau gründlich restaurieren; damals entstanden die überaus häßlichen Gewölbefresken von Gaetano Gigante. Die Fassade erhielt ihre heutige Gestalt unter Ferdinand II. (1853); weitere Restaurierungen fanden zu Anfang des 20. Jh. statt; 1927 wurde der Campanile neu errichtet.
Das Innere läßt durch alle modernen Entstellungen hindurch zum mindesten den Grundriß der alten Querschiffbasilika erkennen, die man nun also vom Kopfende her betritt. — In der 1. Kapelle links hat sich die Ausmalung von Corenzio erhalten (Marienkrönung, Evangelisten, Tugenden, Wundertaten Christi), die früher die Gewölbe der ganzen Kirche bedeckte. — In der 1. Kapelle rechts die Madonna mit den hll. Januarius, Blasius und. Ubaldus, der einen Besessenen heilt, von Santafede. — 2. Kapelle rechts: An der Wand rechts oben ein niederländisch beeinflußtes Tafelbild vom Ende des 15. Jh. (ringsum angestückt); im Zentrum eine Beweinungsgruppe in der Art der Rogier-Nachfolge vor einem interessanten Architekturprospekt; links eine Barmherzige Madonna, die von einigen armen Seelen zu ihren Füßen angefleht wird, rechts der hl. Antonius von Padua. — Im Tabernakel des Hochaltars die Madonna von Piedigrotta, ein stark restauriertes und übermaltes, ganz von Votivgaben zugedecktes Holzbildwerk, das als sienesisch, 14. Jh., gilt. — Die Apsis hat ein Chorgestühl vom Anfang des 16. Jh. — In der rechten Seitenkapelle des Presbyteriums (einem Nebenschiff des ehem. Langhauses) steht ein Kenotaph für den großen neapolitan. Staatsrechtler Gaetano Filangieri (1752-88, s. S. 303 und 561) und seinen Sohn Carlo (1784-1862).
Links neben der Kirche liegt der um 1500 erbaute Kanonikerkonvent (heute Sezione di Sanitär della Marina Militare). Die urspr. Gestalt des Kreuzgangs läßt sich mit weitgespannten Arkaden auf schlanken Marmorsäulen rekonstruieren, deren Proportionierung, wie auch die Kapitellornamentik, auf einen toskanisch geschulten Baumeister schließen
lassen. Im 17. Jh. wurden die Säulen ummauert, die Bogen verstärkt und ein Obergeschoß aufgesetzt.
S. Maria del Popolo agli Incurabili (auch Tutti i Santi; Kirche des gleichnamigen Krankenhauses am Ende der Via Luciano Armanni, zwischen Via dell’Anticaglia und Piazza Cavour). Die Gründung des Hospitals (nicht für unheilbar Kranke, sondern für Arme und Obdachlose, die keine häusliche Pflege erhalten können) geht in d. J. 1519 zurück. Die Kirche, zur Rechten des Eingangs, ist absolut unzugänglich, wahrscheinl. in nicht besichtigungsfähigem Zustand; sie wurde 1650 dekoriert und enthält oder enthielt 2 dem Jac. Sansovino zugeschriebene Grabmäler von 1531 und. diverse Altarbilder des 17. und 18. Jh.
Im Hof des Spitals rechts führt eine höchst zierliche Freitreppe mit 2 geschwungenen Läufen und Rokoko-Balustraden zu der 1748 eingerichteten Apotheke, deren Dekoration und Einrichtung fast vollständig erhalten ist. Fresken und Leinwandbilder von Pietro Bardellino, zahllose Fayence-Gefäße mit z. T. höchst kunstvoller Bemalung von Donato Massa, einem der Meister des Kreuzgangs von S. Chiara. — Ein 2. doppelläufiges Freitreppchen des 18. Jh. links neben dem Haupteingang des Hospitals, davor ein feines schmiedeeisernes Gitter.
S. Maria di Portanova (an der gleichnamigen Piazzetta in der Nähe des »Rettifilo«, zwischen Universität und Via del Duomo) wird unter ihrem alten Namen S. Maria in Cosmedin schon im 9. Jh. erwähnt. 1631 errichteten die Barnabiten den heutigen Bau; die Fassade, mit leicht vorschwingenden Flanken, großer Doppelpilasterordnung und Stuckdekoration, wurde 1704 hinzugefügt. — Das Innere, ein tonnengewölbter Saal mit korinthischer Ordnung und je 2 Seitenkapellen, ohne Chorapsis, ist modern restauriert. Am Hochaltar ein Triptychon (Madonna mit Johannes d. T. und den hll. Eustasius, Petrus und Januarius — die Köpfe Christi und der Maria vollplastisch aus Holz gearbeitet) von Marco Cardisco (Ende 15. Jh.); in der 1. Kapelle links eine Kreuzigung von Carlo Selitto; über dem Eingang schlecht erhaltene Fresken (Triumph Davids und Judiths) aus der Nachfolge des Massimo Stanzione.
S. Maria in Portico (im Chiaia-Viertel, ein Stück westl. der Villa Pignatelli)
1632 gestiftet, führt die Kirche ihren Namen nach einer hier verehrten Kopie des wundertätigen Madonnenbildes vom Portikus der Oktavia in Rom, für das Carlo Rainaldi 1662 die Kirche S. Maria in Campitelli errichtete.
Der interessanteste Teil des Gebäudes ist die 1862 wiederhergestellte Vorhallenfassade, deren Gliederungsformen (»Palladio-Motiv« mit von Säulen flankierten Rustika-Pfeilern, Fenster mit Rundbogen in Segmentgiebeln u. a.) so stark an Fanzago erinnern, daß die neuerdings ausgesprochene Zuweisung an diesen Meister ohne weiteres gerechtfertigt scheint.
Im Innern reiche Stuckdekoration; in der 1. Kapelle links eine Geburt der Maria von F. Fischetti (1766); die Apsis hat verdorbene Fresken von Luca Giordano. — Die Kirche besitzt eine Weihnachtskrippe aus etwa lebensgroßen Figuren verschiedener Herkunft, in kostbare z. T. alte Gewänder gekleidet, die zur Weihnachtszeit im rechten Querschiff ausgestellt wird (um 1700 entstanden Joseph, der alte König, ein »povero«).
S. Maria di Portosalvo (zwischen Immacolatella Vecchia und Piazza Bovio an der Via Marconi). Eine Schifferkirche mit wundertätigem Marienbild, heute isoliert inmitten der Wüstenei, die Bomben und Spitzhacke von den Slums des alten Hafenquartiers übriggelassen haben. Als Gründungsdatum ist d. J. 1554 überliefert; zahlreiche Spenden von Seeleuten, die der Madonna ihre Rettung aus Seenot verdankten, ermöglichten immer neue Restaurierungen. Hübsche Rokokofassade; Campanile und Chorkuppel mit farbiger Majolika verkleidet. Das 1schiffige Innere besitzt reiche polychrome Marmordekorationen und eine üppig vergoldete Holzdecke. Am Hochaltar das stark restaurierte Gnadenbild, flankiert von Statuen der hll. Petrus und Paulus (16. Jh.).
Der links neben der Kirche stehende Obelisk wurde zur Feier des blutigen Sieges der »Sanfedisten« unter dem Kardinal-Erzbischof Fabrizio Ruffo über die jakobinische »Repubblica Partenopea« errichtet (1799). Seine Zeichen und Inschriften wurden nach 1860 entfernt; übrig blieben 4 Medaillons mit der Madonna, S. Antonio di Padova (dem Schutzpatron der Sanfedisten), S. Francesco da Paola (dem Nationalheiligen ihrer kalabresischen Truppen) und S. Gennaro (der den Republikanern beigestanden hatte und erst nach einigem Hin und Her vom Bischof rehabilitiert wurde).
S. Maria della Redenzione dei Cattivi (Via S. Sebastiano, Ecke Via S. Pietro a Maiella) ist die Kirche einer 1548 gegründeten Bruderschaft zur Befreiung neapolitan. Bürger, die in die Hände türkischer Seeräuber gefallen waren. Der heutige Bau mit hübscher dorisch-ionischer Stuckfassade stammt von Ferdinando Sanfelice (1717); das unzugängliche Innere, 1836 restaur., enthält ein Hochaltarbild von Giac. Farelli.
S. Maria Regina Coeli (beim Caponapoli, Ecke Via Pisanelli / Via S. Gaudioso)
Eine Nonnenklosterkirche, angebl. 1590-94 von Giov. Francesco di Palma errichtet. Die Fassade enthält im Untergeschoß eine 3bogige Pfeilervorhalle, davor eine doppelläufige Freitreppe; oben ein giebelbekröntes Fenstergeschoß mit korinthischen Pilastern und Flankenvoluten, von frührenaissancehafter Zartheit. In der Vorhalle ein von der Lokaltradition P. Bril zugeschriebener Zyklus von Landschaftsfresken, motivisch amüsant, jedoch von ziemlich grober Faktur und zweifellos nicht von der Hand des flämischen Meisters, von. dem auch kein Aufenthalt in Neapel bezeugt ist. — Das Innere (klingeln in Vico S. Gaudioso 2) ist ein Saal mit Seitenkapellen und überkuppelter Chorkapelle, mit prunkvoller Marmorausstattung des 18. Jh.; vergoldete Holzdecke (entstanden zwischen 1634 und 1659) mit 3 außerordentlich schönen Leinwandbildern von Massimo Stanzione: Geburt, Verkündigung (der ganze Himmel einschließlich Gottvaters bricht ins Gemach der Maria ein) und Krönung der Jungfrau zur Himmelskönigin. Die Bilder zwischen den Fenstern stammen von Gargiulo (Micco Spadaro) und Luca Giordano. Von diesem außerdem 3 Gemälde in der 2. Seitenkapelle links (Ereignisse aus dem Leben des hl. Augustin, 1684) und 2 in der 4. Kapelle (Passionsszenen). Das Hochaltarbild (Marienkrönung) von Ferdinando Castiglia, angebl.
nach einem Entwurf des G. B. Caracciolo. In einem Seitenraum hinter dem Chor eine Grablegung von Filippo Vitale (Anfang 17. Jh.).
Der hübsche Kreuzgang des Klosters stammt von Francesco Antonio Picchiatti (1682).
S. Maria della Sanità (auch S. Vincenzo Ferreri; im Valle della Sanitär zu Füßen des Hügels von Capodimonte; der alte Ortsname rührt wahrscheinl. von den zahlreichen Wunderheilungen her, die den in dieser Zone gelegenen Heiligengräbern [Katakomben] zugeschrieben wurden)
Der älteste Teil der Anlage ist eine wohl aus dem 6. Jh. stammende Coemeterialkapelle; in ihr verehrte die neapolitan. Christengemeinde das Andenken des hl. Gaudiosus, eines afrikanischen Bischofs, der nach seiner Vertreibung durch die Vandalen in Neapel ein Coenobitenkloster gegründet hatte. Der im Mittelalter vernachlässigte Bau wurde im 16. Jh. von den Dominikanern restauriert, 1577 unter seinem heutigen Titel neu geweiht und bald von zahlreichen Gläubigen besucht; so beschloß man die Errichtung einer geräumigen Kirche, die 1602 begonnen und schon 1613 im wesentlichen vollendet wurde. Den Entwurf lieferte Giuseppe Donzelli, bekannt unter seinem Ordensnamen Fra Nuvolo‚ einer jener geistlichen Architekten, die um die Wende des 16. Jh. in Neapel eine gewichtige Rolle spielten (vgl. Grimaldi, Valeriani). Seine Erfindung scheint die Majolikaverkleidung der Kuppelkalotte gewesen zu sein, die dem Äußeren dieser und vieler späterer neapolitan. Kirchen ein so zauberhaft morgenländisches Gepräge gibt (gut zu sehen vom Autobus auf der Fahrt nach Capodimonte, rechts unterhalb der Straße).
Die Fassade hat ein polygonal vorspringendes Mittelcorps mit 2 Ordnungen, unten korinthisch, darüber niedrige Hermenpilaster mit Phantasiekapitellen; die Nischenrahmen, die eine Verkröpfung des Hauptgebälkes bewirken, sind schon ein deutlicher Schritt in Richtung auf das neapolitan. Rokoko. — Der Grundriß des Innenraumes ist abgeleitet von dem des Gesù Nuovo: 4 gleich lange Tonnenarme treffen sich in der Kuppelvierung; in den Winkeln des Kreuzes liegen jeweils 3 Nebenkuppeln. Die leicht labyrinthische Wirkung des Ganzen klärt sich auf, wenn das Zentralsystem als Kreuzung zweier basilikaler Langhäuser, die Nebenkuppeln als Seitenschiffjoche aufgefaßt werden; so hat das Vorbild der röm. Peterskirche, mit dem die gleichzeitig entstandenen oberitalien. Kuppelbauten sich unmittelbar auseinandersetzen (S. Alessandro in Mailand, Duomo
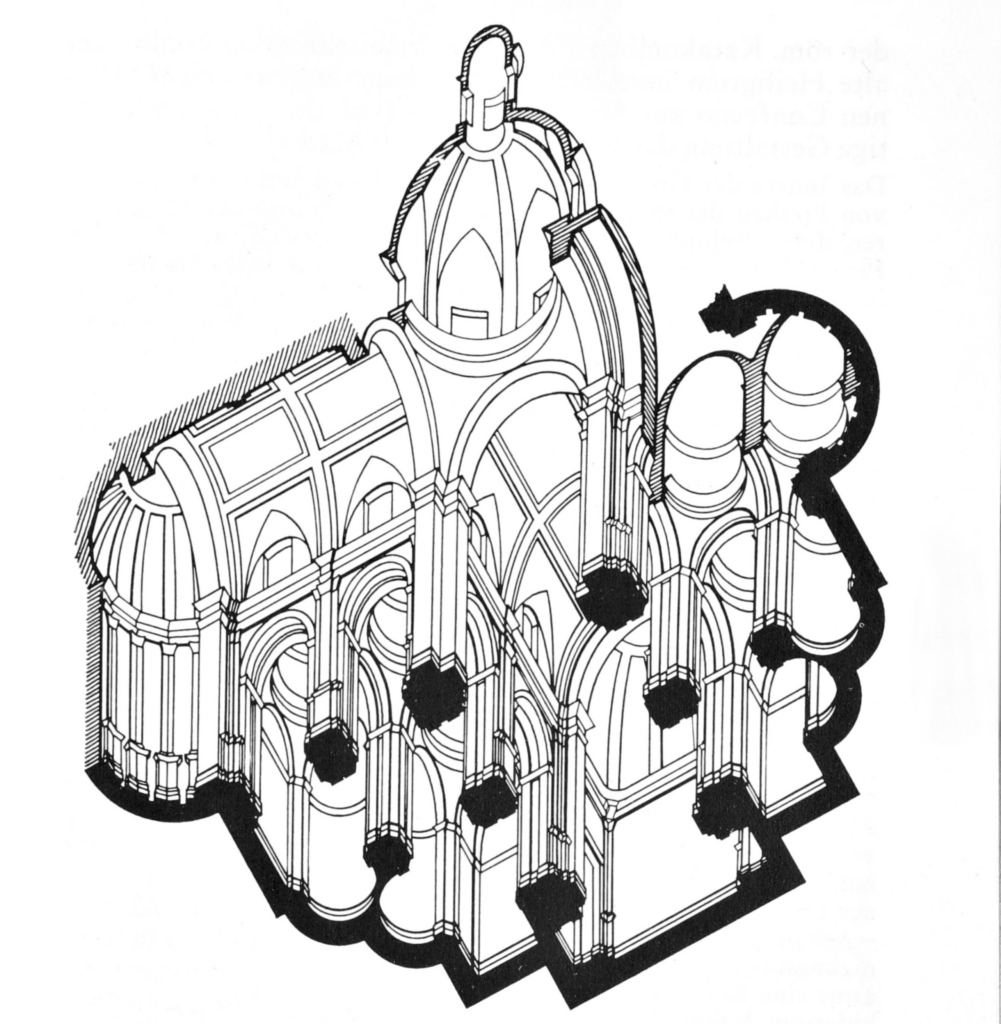 S. Maria della Sanità. Untersicht
S. Maria della Sanità. Untersicht
Nuovo in Brescia), hier wohl nur in der Vermittlung durch Valeriani (vgl. S. 139) eingewirkt. — Der Chorarm wird von einer phantastischen Treppenanlage eingenommen: 2 seitlich ausbiegende Rampen führen auf eine erhöhte Bühne, die den. Hauptaltar trägt. Darunter öffnet sich in flachem, weitgespanntem Bogen der Zugang zum eigentlichen sakralen Zentrum des ganzen Gebäudes, der Cappella oder Grotta di S. Gaudioso. Das neu erwachte Interesse des 17. Jh. an frühchristl. Altertümern — es ist das Jahrhundert der Erforschung
der röm. Katakomben — hat den Architekten veranlaßt, das alte Heiligtum innerhalb des Neubaus in Form einer offenen Confessio zur Schau zu stellen (vgl. die etwa gleichzeitige Gestaltung des Petersgrabes durch Maderno).
Giuseppe Nuvolone, Treppenanlage von Santa Maria della Sanità und San Vicenzo (Chor), 1570, Neapel.
Giuseppe Nuvolone, linker Arm der Treppenanlage von Santa Maria della Sanità und San Vicenzo (Chor), 1570, Neapel.
Das Innere der Grotte, ein einfacher Saalraum mit Apsis, ist ganz von Fresken des späten 17. Jh. bedeckt (Geschichte der 11 Märtyrer, deren Reliquien in den Altären beigesetzt sind, von Bernard. Fera); in der Apsis ein altes, als wundertätig verehrtes Madonnenbild.
Von hier aus gelangt man in die Gaudiosus-Katakomben. Am Ende des 1. Ganges das Grab des Heiligen. Die Wölbung der Nische und die Frontwand darüber waren mit Mosaik verkleidet (6. Jh.); man erkennt die Umrisse einer lebensgroßen Büste, ringsum Reste von Weihgaben und Tauben, darüber eine Inschrift, die Namen, Alter und Tag des Begräbnisses nennt. In einem anderen Nischengrab ein Lünettenfresko mit dem hl. Petrus (in der Mitte), der den hier beigesetzten Pascentius (links) ins Paradies aufnimmt; rechts wohl der hl. Paulus. Darunter Reste von 3 Büsten (5. Jh.). In anderen Räumen weitere Gräber mit Gemmenkreuzen, Schafen usw.; makabre Überreste von Bestattungen des 17. Jh.
Ausstattung der Kirche. Seitenkapellen links (vom Eingang aus): 1. Madonna mit den hll. Hyazinth und Katharina von Luca Giordano. 3. Verkündigung von Azzolino (1629). 5. Vision des hl. Thomas von Pacecco de Rosa (1652); daneben in einer kleinen Wandnische ein frühchristl. Bischofsstuhl (aus der Gaudiosus-Kapelle). — Von hier aus führt ein Korridor in den Kreuzgang, einen elliptischen Pfeilerhof mit Resten von Sgraffitti von Marco Pino, durch den Bau des »Corso Napoleone« (1809) halb zerstört. — In der 6. Kapelle (neben dem Chorarm) ein schöner Luca Giordano: Die hl. Maria Magdalena betet das Kreuz an. — Seitenkapellen rechts: in der 1. und 3. Kapelle noch 2 große reinigungsbedürftige Heiligenbilder Giordanos. Am Altar des Querarms eine Rosenkranz-Madonna von Azzolino (1612). — Im Presbyterium hinter dem Hochaltar schönes geschnitztes Chorgestühl von G. B. de Nubila (1618/19), darüber eine Madonnenfigur von Michelangelo Naccherino.
S. Maria della Sapienza (Via S. Maria di Costantinopoli beim Nationalmuseum; Inneres wegen andauernder Restaurierungsarbeiten unzugänglich)
1614-38 von Francesco Grimaldi errichtet. Die Fassade, 1638-41 hinzugefügt, stammt von Cos. Fanzago. Eine Doppelrampentreppe, die zum Portal der hoch gelegenen Kirche hinaufführt, wird von einer breitgelagerten offenen Halle überfangen; zwischen den eigentümlich schmalen und
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Certosa di S. Martino, Museum. Weihnachtskrippe (18. Jh.)
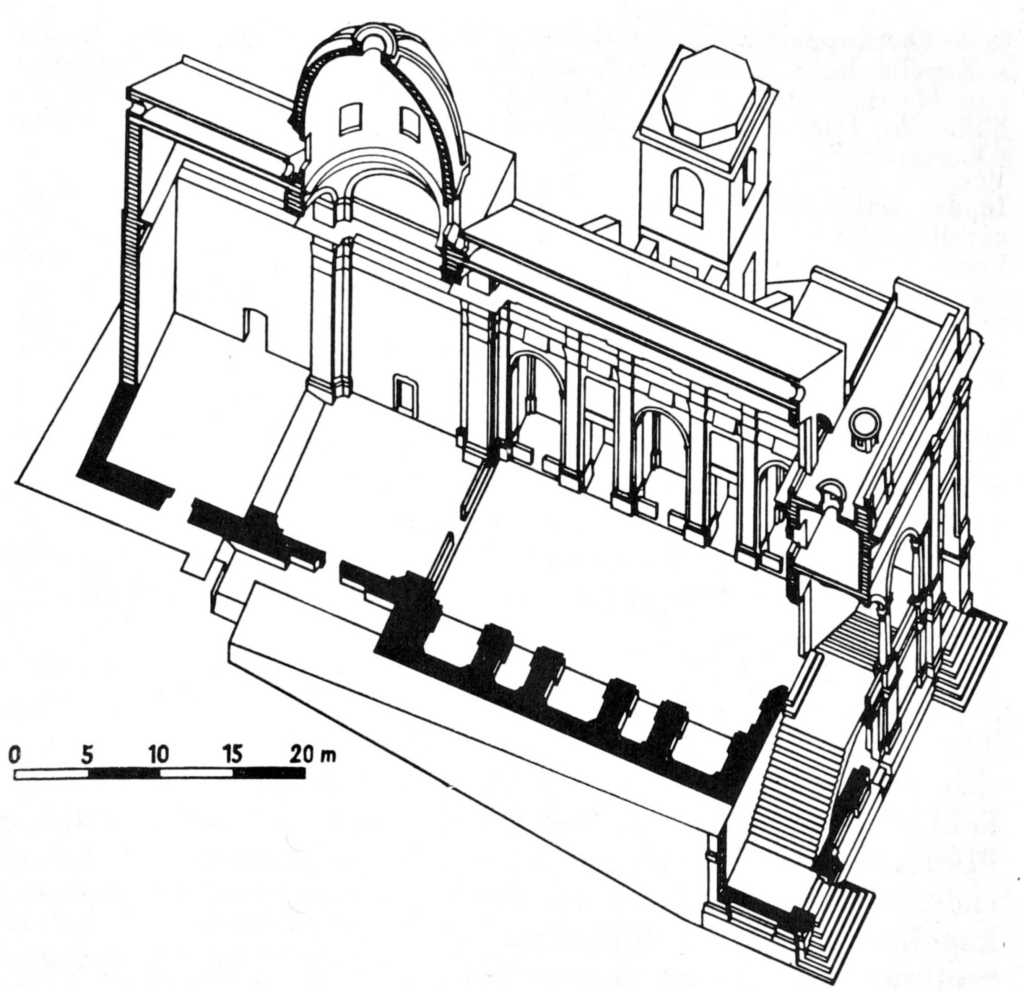 S. Maria della Sapienza. Schnitt
S. Maria della Sapienza. Schnitt
hohen, von Pilastern eingefaßten Treppeneingängen öffnen sich 3 schöne Doppelsäulenarkaden, darunter ein geschlossenes Sockelgeschoß, das die schräg ansteigenden Treppenläufe verbirgt: eine rhythmisch reizvolle, intelligent ersonnene Anordnung von freilich eher profaner Gesamtwirkung (Vestibüle und Hofanlagen genuesischer Paläste zeigen ähnliche Motive).
Das Innere ist ein 1schiffiger‚ tonnengewölbter Raum mit je 5 in rhythmischem Wechsel angeordneten Seitenkapellen (2 niedrige, gerade geschlossene zwischen den Pilasterpaaren, die die 3 großen Rundbogenöffnungen voneinander trennen), Kuppelvierung und glatt geschlossener Apsis. Die Führer nennen Fresken von Corenzio und Fracanzano, Altarbilder von Gargiulo, Simonelli, A. Vaccaro u. a.
S. Maria dei Sette Dolori (Via P. Scura, am Ende des vom Toledo zum Montesanto ansteigenden W-Arms des »Spaccanapoli«) wurde 1597 gegründet und in der 1. Hälfte des 17. Jh. erneuert. Der sich vom Portal aus bietende Blick durch die nahezu 2 km lange, von wimmelndem Leben erfüllte Straßenschlucht hat selbst in Neapel nicht seinesgleichen. — Das Innere der Kirche ist ein tonnengewölbter Saal mit Chorkuppel und
je 5 überkuppelten Seitenkapellen; hübsche Stuckausstattung. In der 3. Kapelle links (provisorisch aufgestellt) ein grandioser hl. Sebastian von Mattia Preti; in der 5. Kapelle rechts über der Sakristeitür ein lesender Hieronymus in abendlicher Landschaft, aus dem Umkreis Riberas.
In der links abwärtsführenden Via Girardi (der alten Strada Magnocavallo) liegt linker Hand der ehem. Konvent von S. Maria del Soccorso, heute Volksschule; im Innern ein Gärtchen und eine prächtige halbrunde Exedra im Stil Vanvitellis, mit ionischen Doppelpilastern und Öffnungen nach dem Schema des »Palladio-Motivs« seitlich gerade Architrave, im Zentrum ein großer Bogen, darin eine Muschelnische, deren Rückwand sich wiederum in einem Bogen öffnet.
S. Maria della Stella (in der Via della Stella, die von der Piazza Cavour [Museo Nazionale] nach N führt)
Ein seit dem 16. Jh. verehrtes Gnadenbild (heute am linken Querschiffaltar) gab den Anlaß zum Bau, der 1587 begonnen wurde.
Als Architekt wird ein sonst nirgends nachweisbarer Camillo Fontana genannt.
Die Fassade, in 2 Ordnungen mit darüber hinausragendem Giebelauszug, bildet ein frühes Beispiel jenes Typus mit Treppenläufen im Innern einer Vorhalle, der sich im 17. Jh. in Neapel großer Beliebtheit erfreute (vgl. S. Maria della Sapienza, Gesù delle Monache, S. Giuseppe a Pontecorvo, S. Giuseppe dei Ruffo, Madonna del Rosariello). — Das Innere ist ein geräumiger Saal mit Seitenkapellen und Querschiff, flachgedeckt, dazu eine tonnengewölbte quadratische Apsis; im 18. Jh. stuckiert und marmoriert, jüngstens nach Kriegsschäden wiederhergestellt.
In der Apsis ein überaus großartiges Gemälde von Battistello Caracciolo: Maria Immacolata mit den hll. Dominikus and Antonius und dem Erzvater Adam (Tafel S. 209), vorzüglich zu sehen von dem hölzernen Podium an der Rückseite des Altars. Das signierte, aber nicht datierte Bild dürfte um 1615/16 entstanden sein. Es sind die entscheidenden Jahre der Entwicklung des Künstlers: Aus der ersten, sehr selbständigen Reaktion auf das Werk Caravaggios (s. S. 247) hat sich eine innere Affinität entwickelt, die weit über den bloß nachahmenden »Caravaggismus« der Zeitgenossen hinausgeht, das Zentrum der Kunst des großen Norditalieners berührt. Das kompositionelle Gefüge wird nicht mehr durch eine räumliche Ordnung, sondern durch die unmittelbare Verkettung der Einzelfiguren und -gesten bestimmt, vom liegenden Adam im Vordergrund bis hinauf zum Gottvater, der von links oben heranschwebend die Hand der Maria ergreift. Oben und unten, Himmlisches und Irdisches sind unauflöslich ineinander verschlungen; die Farben — stumpfes Rot, Dunkelgrün, gelblich fahle Fleischtöne und das herrliche Silbergrau des Mantels der Jungfrau — treten
einzeln aus jenem raum-und atmosphärelosen Caravaggio-Dunkel hervor, das wie ein negativer Goldgrund die Bildfläche ausfüllt. Leider hat der schlechte Erhaltungszustand des lange vernachlässigten Bildes zahlreiche Einzelheiten unkenntlich gemacht; nur an einigen gut konservierten Partien in den Gewändern, den Flügeln der Engel und den Blumen am rechten Bildrand läßt die außerordentliche malerische Qualität sich noch bewundern.
S. Maria della Stella alle Paparelle (am Ende der Via G. de Blasiis beim Archivio di Stato [SS. Severino e Sossio]), eine kleine Votivkapelle in reinsten Renaissanceformen, die, wie die innen und außen angebrachten Inschrifttafeln besagen, 1519 von dem Architekten Giovanni Donadio (Mormando) gestiftet und erbaut wurde. Die zierliche Fassade hat 4 korinthische Pilaster, die nach Art einer klassischen Tempelfront den Dreiecksgiebel tragen; in den Seitenfeldern Nischen und kreisrunde Muschelschalen, in der Mitte ein schlichtes Portal mit geradem Sturz und halbrundem Tympanon, worin sich ein heute verschwundenes Marienbild befand; im Giebel ein großes Rundfenster. — Das schlimm verwahrloste Innere (stets versperrt, der Schlüssel wird in der Redaktion der Bistumszeitung »La Croce« im Erzbischöflichen Ordinariat aufbewahrt) ist ein tonnengewölbtes Sälchen mit barock restaurierter ionischer Pilasterordnung, je 3 kleinen Seitennischen und einer etwas größeren Nische an der Altarwand; in der Sakristei eine Marmorstatuette Johannes’ d. T., gleichfalls von Mormando.
S. Maria succurre miseris (oder S. Antonio da Padova, auch S. Antoniello delle Vergini oder alla Vicaria; vor der Porta S. Gennaro, am Anfang der Via delle Vergini)
Der heute bestehende Ban, gegen Mitte des 18. Jh. für einen nach Franziskanerregel lebenden Damenkonvent errichtet, stammt von Ferdinando Sanfelice.
Die Fassade zählt zu den charakteristischen Werken des phantasiebegabten Architekten: ein kompakter 2geschossiger Block, der bei relativ kleinen Abmessungen eine überaus reiche Skala kontrastierender Formelemente in sich vereinigt. Zwischen abgerundeten Flanken tritt das Mittelcorps kräftig hervor, wobei im Untergeschoß eine ganz leichte konkave Einziehung auf die konvexe Biegung der Seiten antwortet, während das von einem schmucklosen Segmentgiebel bekrönte Mittelfeld des oberen Stockwerkes eine reine Ebene bildet. Die vielfachen Vor- und Rücksprünge der Mauer sind unten durch Kompositpilaster und Säulen artikuliert, oben nur von flachen Rahmungen begleitet; eine dichte, an Säulenbücher des 16. Jh. erinnernde Oberflächendekoration — Kanneluren, Schaftringe, einzelne Diamantquader in den Eckfeldern — verleiht dem Ganzen einen Zug von schreinermäßiger Eleganz. — Das Innere ist ein quadratischer Ein-
heitsraum, abermals mit abgerundeten Eck-und flachen Kapellennischen, in 2 Geschossen schachtartig in die Höhe strebend und mit einem Muldengewölbe abgeschlossen. Der Hochaltar ist jetzt durch Baugerüste verstellt; in alten Führern wird als Altarbild eine Vision des hl. Antonius von Fabrizio Santafede erwähnt.
Um 1940 kamen bei Reparaturarbeiten Reste eines tieferliegenden, von der heutigen Kirche überdeckten mittelalterl. Vorgängerbaus zutage. Die betreffenden Räumlichkeiten scheinen derzeit unzugänglich zu sein; ihre Existenz wird von Pfarrer und Sakristan standhaft abgeleugnet. Nach den Beschreibungen handelt es sich um Teile eines 1schiffigen Baues mit halbrunder Apsis; die Wände tragen Fresken aus der 2. Hälfte des 14. Jh. von unterschiedlicher Qualität (Heilige, Stifter, Szenenfragmente aus Heiligenleben, Kopf eines Verkündigungsengels).
S. Maria della Vittoria (Piazza della Vittoria, am östl. Ende der Villa Comunale)
1572 in Gedenken an den ein Jahr zuvor errungenen Seesieg von Lepanto gegründet; die Tochter des Admirals Don Juan d’Austria, Johanna, ermöglichte 1628 die Umwandlung des bescheidenen Karmeliterkonvents in ein Theatinerkloster; ihre Tochter Margarethe von Österreich ließ 1646 die heutige Kirche errichten. Der Architekt des interessanten Gebäudes wird nirgends erwähnt.
Der Innenraum läßt sich als Kreuzkuppelkirche mit verlängertem Eingangsarm bezeichnen. Das architektonische Hauptmotiv bilden 4 gewaltige monolithische Marmorsäulen; sie tragen frei stehend, von je 2 mittragenden Pfeilern flankiert, die Vierungskuppel, wodurch die Bogenstellung der Kreuzarme sich entsprechend verengt. Über dem Chorarm eine Darstellung der Schlacht von Lepanto; die Madonna verheißt dem Don Juan den Sieg (17. Jh.).
S. Marta (Via S. Sebastiano, Ecke Via B. Croce, unweit der Piazza Gesù Nuovo). Der kleine Bau wurde zu Ende des 14. Jh. von Margherita Durazzo gegründet, während der Masaniello-Unruhen von 1634 gebrandschatzt, 3 Jahre später wiederhergestellt und im 18. und 19. Jh. restauriert. Das Eingangsportal mit flachem Bogen, von stumpfwinklig gebrochenen Profilstäben gerahmt, zeigt noch die Formen der Durazzo-Gotik. Das Innere (stets verschlossen) enthält ein Altarbild (S. Marta) von A. Vaccaro.
S. Martino, das berühmte Kartäuserkloster, heute Museum und eine der glanzvollsten Versammlungen von Kunstwerken in Neapel, liegt in beherrschender Position auf der Höhe des Vomero, zu seiten des Castel S. Elmo.
Die Gründung des Klosters erfolgte 1325 auf Veranlassung Karls von Anjou (des ältesten Sohnes Roberts d. Weisen). 1337 zogen die ersten Mönche ein; 1368 wurde unter dem Patronat der Königin Johanna I. die Kirche geweiht. Als erste Baumeister gelten Francesco di Vito und Tino di Camaino; ferner werden die Namen
des Atanasio Primario (1336) und des Balduccio de Bacza (1346) genannt. Gegen 1580 begann unter dem wohlhabenden Prior Severo Turbolo eine durchgreifende Erneuerung der ganzen Anlage. Die Leitung lag zunächst in den Händen G. A. Dosios und Giov. Giac. Confortos; 1623 berief man den aus Oberitalien (Clusone bei Bergamo) zugewanderten, damals gerade 32jährigen Cosimo Fanzago, dessen exzeptionelle dekorative Begabung hier ihr reichstes Betätigungsfeld fand.
Im Gefolge der Säkularisation ging das Kloster in den Besitz des italien. Staates über; 1866 wurde in ihm auf Veranlassung des Archäologen Giuseppe Fiorelli das Museo Nazionale di S. Martino eingerichtet, das Gemälde, Skulpturen, Kleinkunst und Denkwürdigkeiten aus der Geschichte Neapels enthält. Nach schweren Kriegsschäden wurden die Sammlungen von Bruno Molaiuoli und Gino Doria neu geordnet.
Der Eingang (Spianata S. Martino 5) führt zunächst in einen langgestreckten Vorhof, zur Rechten überragt von der östl. Bastion des Castel S. Elmo. Links die Vorhalle der Martinskirche (normalerweise geschlossen; man erreicht das Innere der Kirche vom großen Kreuzgang aus). Ihre Fassadendekoration, der trecentesken Eingangswand vorgeblendet, ist ein charakteristisches Werk Fanzagos: Hinter streng dorischer Pilasterordnung entfaltet sich ein freies Spiel von Rahmen und Öffnungen, durch die man in die weiß stuckierten Rippengewölbe der Vorhalle blickt (Fresken Von Dom. Gargiulo, gen. Micco Spadaro, 1644: Verfolgung der Kartäuser in England). Ordnung und freies Ornament werden dekorativ zusammengehalten durch den noblen Chiaroscuro-Effekt des Materials (dunkelgrauer Peperin mit hellgrauem und elfenbeinfarbenem Marmor, dazu das schwarze Schmiedeeisen der Türgitter). Über dem Hauptportal eine formenreiche, außerordentlich schöne Volutenbildung, die die Handschrift des Bildhauers Fanzago verrät. Auch für die heute durch einfache Putzfelder gegliederten Seitenkompartimente war eine Marmordekoration geplant; an den Flanken sollten sich nach dem in einer Zeichnung überlieferten Projekt Fanzagos 2geschossige Campanili erheben. — Der anschließende Kleine Kreuzgang (Chiostrino dei Procuratori), mit 5 x 5 durch toskanische Marmorpilaster geschmückten Pfeilerarkaden, zeigt die gleiche Farbstimmung. Der hübsche Ziehbrunnen (1605) stammt von dem carraresischen Bildhauer Felice de Felice, der zwischen 1591 und 1622 nach Entwürfen Dosios und
Confortos in S. Martino gearbeitet hat. Unter den Portiken die Wappen der ältesten neapolitan. Familien.
Von hier aus führt der übliche Rundgang zunächst ins Marinemuseum (Säle 1-4), mit alten Schiffen, Schiffsmodellen, nautischem Gerät und einer Serie großformatiger, aber penibel gemalter Veduten von Philipp Hackert (die Häfen des neapolitan.-sizilianischen Königreichs). Die Räume 1 und 2 bildeten ehemals die Klosterapotheke (Deckenfresken von Paolo de Matteis).
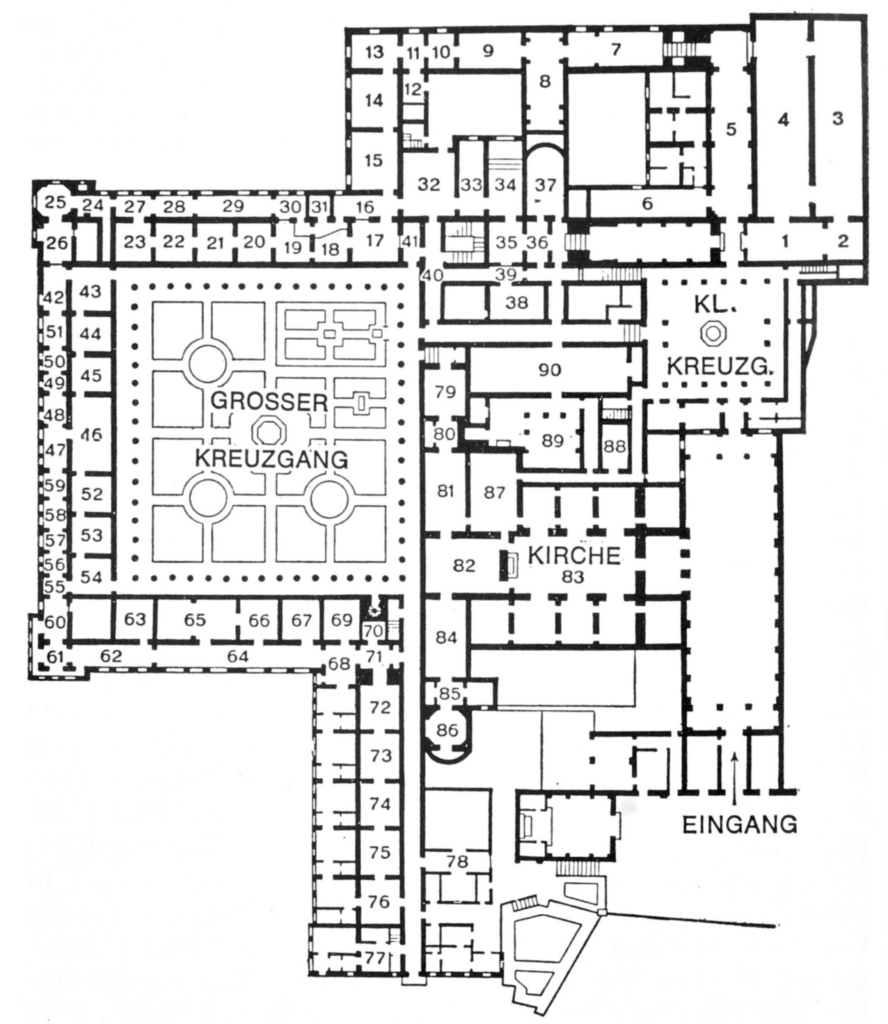 Certosa di S. Martino: Grundriß
Certosa di S. Martino: Grundriß
In Saal 5 Kutschen des 18. und 19. Jh.; links vom Eingang die »Colonna della Vicaria« vom Portal des Justizpalastes der Vizekönige (Castel Capuano).
In den anschließenden Sälen (5bis) die kunstgewerbliche Sammlung Marcello Orilia (hauptsächlich Porzellan).
Saal 6 enthält ein großes Chorgestühl aus S. Agostino degli Scalzi.
In Saal 7 die berühmte Tavola Strozzi (Tafel S. 224), ehemals im Palazzo Strozzi zu Florenz, darstellend die Rückkehr der Flotte Ferrantes I. aus der Seeschlacht von Ischia (Sieg über die Franzosen, 1464), mit einer höchst fesselnden Ansicht des damaligen Neapel; exakt wiedergegeben sind das Castel Nuovo, die große Mole und links davon die im 18. Jh. zerstörte Hafenfestung Torre S. Vincenzo. — Die gegenüber hängende große Tafel mit der Anbetung der Könige, gegen 1520 entstanden und neuerdings dem Polidoro-da-Caravaggio-Schüler Marco Cardisco zugeschr., zeigt in der Rolle der 3 Weisen Ferrante I. (links kniend), neben ihm seinen Sohn und Nachfolger Alfons II., rechts den jugendlichen Karl v. — Außerdem 2 Marmormedaillons mit den Bildnissen des Dichters Giov. Pontano (vgl. S. 263) und des Königs Ladislaus von Anjou-Durazzo. Eine Serie von Bildern des Micco Spadaro (Dom. Gargiulo) gibt dramatische Augenzeugenberichte in der Art Callots von den großen Katastrophen des 17. Jh.: 1631 Vesuv-Ausbruch, 1647 Masaniello-Revolte (davon hier auch zahlreiche Dokumente), 1656 Pest.
Francesco Pagano, Tavola Strozzi, 1465, Museo e Galleria Nazionale di Capodimonte, Neapel.
Die Säle 8-12 enthalten Denkmäler aus der Bourbonenzeit; man findet u. a. eine Serie von Bildnissen des Anton Raphael Mengs; in Saal 11 außerdem 2 kleine Bildchen, Weinlese und Getreideernte mit den als Bauern verkleideten Bourbonen, von jenem Christoph Kniep, den Goethe für seine Sizilienreise als Zeichner von »Konturen« in Dienst genommen hatte (»die besten englischen Bleistifte zu spitzen und immer wieder zu spitzen, ist ihm eine fast ebenso große Lust als zu zeichnen; dafür sind aber auch seine Konturen was man wünschen kann«).
Die Säle 13-16 dokumentieren die Revolution von 1799 und die Repubblica Partenopea, die Sanfedistische Repression unter dem Kardinal Raffo und das »decennio francese« (Joseph Bonaparte und Joachim Murat).
Die Säle 14 und 15 sind Teile der fürstlich ausgestatteten Wohnung des Priors; schöne Deckenbilder von Micco Spadaro.
Es folgt (Säle 17-23) die Geschichte des 19. Jh. mit Truppenaufmärschen, erster Eisenbahn, Risorgimento, Garibaldi und dem Aufgehen des »Regno di Napoli« in dem neuen Königreich Italien (1860).
Von Saal 23 aus erreicht man durch einen kurzen Korridor das an der SO-Ecke des Gebäudes liegende Belvedere, dessen Balkon einen überwältigenden Blick auf Stadt und Golf gewährt. Den Horizont bildet ganz links der Hügel von Capodimonte, dann die ferne Kette des Apennin und der über die Sebeto-Ebene aufsteigende Vesuv, umgeben
vom Kranz seiner Land- und Küstenstädte bis zur Bucht von Castellammare, dahinter die Sorrentiner Halbinsel und Capri. Die Stadt ist fast vollständig überschaubar, doch ist es nicht einfach, sich innerhalb des Häusergewimmels zurechtzufinden; wir nennen einige Orientierungspunkte, von denen aus man anhand eines Stadtplans weitere Einzelheiten aufsuchen kann. Rechts unterhalb des Palastes von Capodimonte erscheinen die Kuppeln von S. Agostino degli Scalzi und S. Teresa, dann das große Ziegeldach des Nationalmuseums; darüber die durch graue Pilaster gegliederte Fassade von S. Maria della Stella. Weiter rechts im Vordergrund die Kuppel des Spirito Santo (mit orangefarbenem Tambour und großen Fenstern); dahinter kommt ein Stückchen Piazza Dante zum Vorschein; links daneben, weiter vorn, Hof und Fassade von Trinità dei Pellegrini. Über Spirito Santo die Ruine der »Pietrasanta« (S. Maria Maggiore); rechts davon, weiter zurückliegend, die neugot. Fassade des Domes, an seiner Flanke die hohe Spitzkuppel der S.-Gennaro-Kapelle, quer davor S. Filippo Neri (dunkle Kuppel mit hoher weißer Laterne). Es folgt die schnurgerade Linie des »Spaccanapoli« (noch eindrucksvoller von der NO-Ecke des Baues, an der man genau in der Straßenachse steht). Man erkennt in der linken Straßenflucht die Diamantquaderfassade des Gesù Nuovo, gegenüber Campanile und Langhaus von S. Chiara. Hinter dem Campanile der Palazzo Sangro di Vietri an der Piazza S. Domenico, weiter links Chor und Langhaus von S. Domenico Maggiore.
Über dem Langhaus von S. Chiara erscheint weiter hinten die grünspanbedeckte Kuppel der SS. Annunziata; etwas rechts davon Fassade und Campanile von S. Agostino della Zecca; davor SS. Severino e Sossio mit Kuppel auf weit ausladendem Tambour; vor dieser die kleine Kuppel von S. Maria di Montevergine. Zur Rechten von S. Agostino verläuft der »Rettifilo« vom Bahnhofsplatz zur Piazza G. Bovio, dann schräg nach vorn abknickend (Via G. Sanfelice-Via Diaz) zum »Toledo«, der sich quer durchs Bild zieht; links der Piazza Bovio erkennt man das Langhaus von S. Maria la Nova, mit weißem, grau gerahmtem Dreiecksgiebel. Aus dem Straßenraster der »Quartieri« am Fuß des Vomero hebt sich ganz vorn links die Achteckkuppel der Concezione a Monte Calvario heraus (weiß verputzter Tambour, Bandrippen, keine Laterne). Der Hafen zeigt sich von
hier aus in seiner ganzen Ausdehnung. Als Zentrum erscheint der Molo Angioino mit der Stazione Marittima; davor die Grünfläche der Piazza Municipio, rechts daneben Castel Nuovo, die Galleria Umberto (im Winkel ihrer Kreuzarme die flache Kuppel von S. Brigida), Palazzo Reale, Teatro S. Carlo, Piazza del Plebiscito und S. Francesco di Paola; rechts hinter dieser die Weißblechkuppel von S. Maria Egiziaca. Der Pizzofalcone (der das Castel dell’Ovo verdeckt) wird durch die Via Monte di Dio in 2 Teile zerschnitten; an deren Anfang rechts liegt S. Maria degli Angeli, dahinter die grellrot gestrichene Nunziatella. Es folgt am Ufer Piazza Vittoria, vor ihr die Rückfront des Palazzo Cellamare, dann Villa Comunale, Via Caracciolo, Mergellina, Posillipo und darüber der Gipfel des Monte Epomeo auf Ischia.
Der Rückweg durch die Säle 25-31 führt durch die hochinteressante topographische Sammlung. Ein Seitenkabinett des achteckigen Belvedere-Saales (26) enthält ein Ölbild und 7 meisterhafte großformatige Handzeichnungen des Gaspar van Vittel oder Gaspare dagli occhiali (»Brillen-Kaspar«), des Vaters von Luigi Vanvitelli. Die Säle 27-29 zeigen neapolitan. Vedutisten des 19. Jh. und die Entdeckung der Landschaft des Golfes bis hinunter zur amalfitanischen Küste durch die Romantik. In Saal 29 Veduten des 17. und 18. Jh., darunter eine malerisch erstaunliche Ansicht des Pizzofalcone mit Santa Lucia und Castel dell’Ovo, von unbekannter Hand. Der aus 35 Einzelblättern zusammengesetzte Plan von Neapel und Umgebung, von Giovanni Carafa di Noia 1750 beg., 1775 posthum ediert, ist ein Gegenstück zu G. B. Nollis Rom-Plan von 1748 und als kartographische Leistung seitdem nicht mehr übertroffen worden. Ferner, in Saal 30, Stadtpläne und Panoramen vom 16. bis 19. Jh. (van Aelst, Lafrery, Stoopendael, Lieven Cruyl), kostbares Material für baugeschichtliche Studien.
Die Säle 32-33 bildeten die Bibliothek des Priors. Der Majolikafußboden (17. Jh.) stellt eine »Meridiana« (Mittagslinie) mit Tierkreissymbolen, Sternbildern, Windrose etc. dar; an der Decke der Triumph des katholischen Glaubens, die Glorie des hl. Martin und die Übergabe der Kartäuserregel an den. hl. Bruno. Die hier beginnende Museumsabteilung (Säle 32-40) ist den Volksfesten und -bräuchen Neapels gewidmet. Sie liefert das Gegenbild der historischen Sammlungen: Das »Volk« als Objekt der dort dargestellten Geschichte tritt hier in der Rolle des Subjekts auf — nicht freilich in seinem alltäglichen Dasein, dessen Elend und Leiden, vergebliche Revolten und Resignation nur in den Bildern des Micco Spadaro gelegentlich aufscheinen, sondern
»als applaudierendes Publikum bei den Festen der Großen oder als Schausteller seiner selbst, in seinen Tänzen und Riten« (Gino Doria). Man sieht Trachtenpuppen, Bilder von Festen, Aufzüge, Karneval, Jagden und Militärparaden; außerdem eine Sammlung von venezianischen Spiegeln des 18. Jh.; ferner das Bildnis eines Elefanten, der für Karl von Bourbon beim Sultan gekauft und als »Gran Signore di Costantinopoli« in Portici einlogiert wurde (sein Skelett heute im Museum für vergleichende Anatomie).
In Saal 34 ein Korkmodell des Poseidon-Tempels von Paestum, das in seinem Innern eine Weihnachtskrippe birgt, von dem Bühnenmaschinisten Taglioni. Es leitet über zur Sammlung der Weihnachtskrippen (Säle 35-37), der glorreichsten Selbstdarstellung Neapels im 18. und frühen 19. Jh. (Tafel S. 225), darunter der berühmte »Presepe di Cuciniello« und zahlreiche Einzelstücke der wichtigsten Meister (Sammartino, Celebrano, Vaccaro, Viva, Gori, Mosca, Trillocco u. a.).
Die Säle 38-40 illustrieren die Geschichte des neapolitan. Theaters: Modelle, Figurinen, Masken, Plakate, Programmzettel und Bilder.
Über Saal 40 erreicht man den Großen Kreuzgang, Zentrum und architektonisches Glanzstück der komfortablen Einsiedelei. Die reinste Luft und weltabgeschiedene Stille erfüllen das weite, von 1515 Säulenarkaden eingefaßte Geviert. Seine Grundform stammt noch aus dem Trecento-Bau: In den Rückwänden aller 4 Portiken fand ein Restaurator des 19. Jh. Spuren got. Spitzbogenarkaden; eine Reihe alter, später abgearbeiteter Bogenanfänger sind heute im W-Flügel zu sehen (weitere neuerdings freigelegte Überreste der got. Klosteranlage in dem Korridor von hier zum Chiostrino dei Procuratori, s. S. 243). Die Umgestaltung des 16./17. Jh. war also, wie bei der Fassade der Kirche, im wesentlichen dekorativer Natur. Die architektonischen Hauptelemente — unten toskanische Säulenarkaden mit Gurtbögen und böhmischen Kappen, im Obergeschoß Segment- und Dreiecksgiebelfenster, nach je 3 Achsen durch eine Nische unterbrochen — scheinen auf einen Dosio-Entwurf zurückzugehen; doch hat Fanzago, unter dessen Leitung der Umbau stattfand (1623-31), charakteristische barocke Motive eingeflochten: Kannelierte Hermenpilaster in den Bogenzwickeln und Lilienarabesken über kräftig geschweiften Konsolen in den Scheiteln der Archivolten deuten ironische Vorbehalte gegenüber dem Dogma der Säulenordnungen an. Für die 7 großen Portale unter den Eckarkaden entwarf Fanzago, auf alles antike Herkommen kühn verzichtend, eine genial freizügige »Ohrmuschel«-
Dekoration — einer der frühesten Durchbrüche jenes neuen ornamentalen Formgeistes, aus dem ein Jahrhundert später die Kunst des Rokoko hervorgehen sollte.
Giovanni Antonio Dosi und Cosimo Fanzago, Kreuzgang, 1623, Certosa di San Martino in Neapel.
Giovanni Antonio Dosi und Cosimo Fanzago, Kreuzgang, 1623, Certosa di San Martino in Neapel.
Giovanni Antonio Dosi und Cosimo Fanzago, Kreuzgang, 1623, Certosa di San Martino in Neapel.
Von der Hand Fanzagos (der den Vertrag über die Erbauung des Kreuzgangs als »scultore« unterzeichnete) sind auch die staunenswert formenreichen, spannungsgeladenen Büsten der Ordensheiligen in den Ovalnischen über den Türen (Tafel S. 240). Von den Statuen auf der Portikusbrüstung stammen von Fanzago die hll. Bruno (im Zentrum der N-Seite), Martin (SW-Ecke) und Joseph (NO-Ecke). Zacharias und Johannes d. T. an der S-Seite sowie der Salvator an der W-Wand sind von Naccherino begonnen, von Fanzago vollendet worden; die Madonna an der O-Seite wahrscheinl. von Antonio Perasco. In der NW-Ecke schließlich eine zierliche antike Gewandstatue, von Cosimo Fanzago als S. Lucia ergänzt.
Cosimo Fansago, Lavabo (Konversenchor), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Cosimo Fansago, Heiliger Bruno (Kreuzgang), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Cosimo Fansago, Heiliger Martin (Kreuzgang), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Cosimo Fansago, Heiliger Hugo von Grenoble (Kreuzgang), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Jusepe de Ribera, Moses (Klosterkirche), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Jusepe de Ribera, Elias (Klosterkirche), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Massimo Stanzione, Die Trauer der Angehörigen und Freunde um Christus (Klosterkirche), 1650, Certosa di San Martino in Neapel.
Ein kleiner Friedhofsbezirk enthält das Grab des 1363 gestorbenen Priors Pietro de Villa Mayra und ein schlichtes Metallkreuz auf einer Spiralsäule, die möglicherweise aus dem Trecento-Kreuzgang stammt. Die marmorne Einfriedung mit dem dialektischen Widerspiel konventioneller und frei-ornamentaler Balusterformen zeigt unverwechselbar Fanzagos Stil (das paradoxe Motiv der aufgeschlitzten Eckpfosten!). Monumentalplastik im Kleinstformat bietet die Reihe der Totenköpfe, in verschiedenen Graden zeitbedingter Zerstörung (künstlerische Absicht und natürliche Verwitterung arbeiten unauflöslich ineinander); besonders schön die bekränzten Schädel im Zentrum der Langseiten. — In der Mitte des Hofes steht ein schöner marmorner Ziehbrunnen in reinen Renaissanceformen, 1568 dat.
Von hier aus weiter zur Gemäldegalerie im O-Flügel.
Saal 42: Holzskulpturen, darunter eine liegende Madonna auf bemaltem Ruhebett, aus S. Chiara (14. Jh.); Verkündigung, Teile eines Polyptychons (Fortsetzung im nächsten Saal) von Jac. Ripanda aus Bologna (tätig um 1490-1530).
In Saal 43 steht ein bedeutendes Triptychon von dem Florentiner Nicolò di Tommaso (2. Hälfte 14. Jh.); in der Mitte der hl. Antonio Abbate, links Franziskus und Petrus, rechts Johannes d. Evangelist und der hl. Ludwig, alles von feinstem Kolorit und großer Zartheit und Präzision der Zeichnung.
Saal 44: Neapolitan. Manieristen: Marco Pino, Nic. de Simone u. a.; 4 Täfelchen von Vasari aus S. Giovanni a Carbonara.
Saal 45 gibt mit einigen vorzüglichen Bildern von Salvator Rosa und Micco Spadaro einen Begriff von der neapolitan. Landschaftsmalerei des 17. Jh. Von Spadaro außerdem das fesselnde Bildnis des Abtes Sedgravis, in caravaggesker Beleuchtung, Grenzfall zwischen individuellem Porträt und Heiligenbild. Ferner 4 kleine, aber großartig gebaute Szenen aus dem Leben des hl. Januarius von B. Caracciolo.
Saal 46 wird beherrscht von Riberas Schindung des Marsyas durch Apoll, einer paganen Marterszene von schneidender Drastik. Als Zentrum des Bildes erscheint das schreiende Gesicht des kopfunter am Boden liegenden Opfers, dämonisch verzerrtes Spiegelbild des siegreichen Gottes, der in bläßlich vornehmer Jünglingsschönheit über ihm kniet: ein zutiefst zweifelhafter Triumph gefühllos heiterer Apollinik über den Ausdruck realen Leidens. Luca Giordanos Neufassung des gleichen Themas, an der gegenüberliegenden Wand, weiß von solcher Problematik nichts. »Clearly, the purpose of painting for him was delight« (R. Wittkower): So wandelt der Gehalt des Bildes, obgleich am Gegenständlichen nichts verändert wurde, sich zur Apotheose der Kunst als selbstgenießerischer Virtuosenleistung. Ein Zug von barocker Dynamik lockert das starre Gleichgewicht der Komposition; das raumlose Dunkel Riberas erscheint nun atmosphärisch belebt, das Inkarnat wird durch rosige Fleischtöne und schimmernde Glanzlichter humanisiert, die Farbskala durch Einführung einer Spur von leuchtendem Blau in Dur umgestimmt. — Von Luca Giordano weiterhin ein Raub der Sabinerinnen in effektvoller, malerisch reich differenzierter Gewitterbeleuchtung, das figürliche Thema des Frauenraubes mit nahezu unerschöpflicher Phantasie variierend (dahinter steht Pietro da Cortonas großes Bild im röm. Konservatorenpalast). Von dem gleichen Meister die lebensprallen Allegorien der 4 Weltteile: »Afrika«, wollüstig-dumpf den Eroberer erwartend; »Europa«‚ durch Krone und Tiara zur weltlichen wie geistlichen Herrschaft bestimmt, auch Kunst und Wissenschaft spielen ihre wenngleich bescheidene Rolle (eine minimale Eule auf einem Büchlein); »Asien«, Hort mystischer Weisheit und üppigen Lebensgenusses, von rechts kommt Alexander dahergesprengt; »Amerika«‚ eine tragische indianische Diana inmitten des Cortezschen Gemetzels um Gold- und Silberschätze. — Von Solimena ein etwas theatralisches Selbstporträt in der Pose des Grandseigneurs, um 1730; eine wilde Magnasco-Landschaft; Allegorie der 4 Lebensalter von M. Preti; Jakob und Rahel, von G. B. Castiglione.
Säle 47-57: instruktive Sammlung neapolitan. Stillebenmalerei des 17. Jh. (Gius. Recco, G. B. Ruoppolo u. a.). — Saal 52 führt ins 18. Jh.: Streitende Bauern beim Kartenspiel, von Gaspare Traversi, einem der Hauptmeister des populären Genres in Neapel; eine gleichfalls als Volksstück gegebene Verspottung Christi von dem etwas gefälligeren Schulgenossen Gius. Bonito; von De Mura eine große mythologische Szene, Diana und Endymion; eine vorzügliche Ruinenlandschaft mit röm. Motiven (Tempel der Venus und Roma), Tempera auf Papier, von Pannini; als neapolitan. Gegenstück eine bezaubernde Ruinenpbantasie vom Ufer des Golfes, in bläuliches Mondlicht getaucht, von unbekannter Hand. — In Saal 53 Porträts des 18. und 19. Jh., darunter einige der besten Werke von Gaetano Forte (1790-1871) und ein flottes Aquarellporträt von Angelika Kauffmann. — Saal 54: Sammlung hübscher
Aquarelle von Giacinto Gigante, dem bekanntesten neapolitan. Landschafter des 19. Jh. Die Säle 55-61 enthalten weitere Proben der neapolitan. Malerschulen jener Epoche; darunter (Saal 59) ein Werk des Goethe-Freundes Wilh. Tischbein, darstellend eine monumentale bunte Ente vor klassischer Landschaft.
Im anschließenden N-Flügel die Skulpturensammlung.
In den Sälen 62-64 verschiedene Grabmäler und Skulpturenfragmente, hauptsächlich des 14. Jh. — In Saal 63 zwei bedeutende Werke von Tino di Camaino, der als Schüler Giov. Pisanos die Formen der toskanischen Gotik im Süden Italiens heimisch machte: eine Sitzmadonna mit Kind und ein hl. Dominikas, der den knienden Giov. di Durazzo empfiehlt, Fragmente vom Durazzo-Grab aus S. Domenico Maggiore. Die Herauslösung aus dem Grabmalsverband offenbart die außerordentlichen plastischen Qualitäten der beiden Stücke. Während in den langen schwingenden Faltenzügen, den schlanken Proportionen und in der sanften Neigung der Köpfe französ. Erbe fortlebt, möchte man den malerischen Reichtum der Oberflächenbehandlung, der in der zeitgenössischen Plastik kaum Parallelen hat, auf den Eindruck hellenistischer Vorbilder zurückführen; der Ausdruck der Gesichter mit ihren aufwärtsgerichteten Augen und der charakteristisch zur Nasenwurzel ansteigenden Brauenpartie ist mit skopasischen Köpfen verglichen worden.
Saal 65 enthält 2 große Wandgräber, für Enrico Poderino, von einem unbekannten Künstler des 15. Jh., und für Carlo Gesualdo, von Girol. Santacroce. Die Marmorbüste Pauls III. Farnese von Guglielmo della Porta ist eine Werkstattreplik des Exemplars von Capodimonte (s. S. 412).
In Saal 66 ein Ovalmedaillon mit dem satyrhaften Profil des großen Peretti-Papstes Sixtus V., aus dem Konvent von S. Lorenzo. Die überlebensgroße Madonna mit dem Jesus- und Johannesknaben stammt von P. Bernini, dem Vater des großen Lorenzo. Obwohl als Wandplastik konzipiert, nähert sich die Gruppe mit ihren kompliziert ineinandergreifenden Schraubenbewegungen deutlich dem manieristischen Ideal der all-ansichtigen »figura serpentinata«. Sie entstand in den letzten neapolitan. Jahren des Meisters (1606/07) und bildet das weitaus interessanteste seiner hiesigen Werke; 1624 wurde die Gruppe von Cos. Fanzago überarbeitet oder vollendet (von diesem jedenfalls die prächtige Konsole).
Die Säle 67-69 enthalten die Raccolta Vesuviana, eine Sammlung teils virtuoser, teils naiver Ansichten und gelehrter Darstellungen des großen Naturdenkmals in allen Stadien vulkanischer Tätigkeit (darunter, in Saal 67, einige sehr feine Stiche von Sandrart und Nicolas de Per); der heutige Reisende muß sich hier ergänzen, was die Wirklichkeit ihm seit 1944 am Panorama des Golfes vorenthält.
Saal 70: kleines Kabinett mit Skulpturen und Zeichnungen des 19. Jh. (d’Orsi, Gemito).
Der anschließende Flügel, Säle 72-78, enthält vorwiegend Kunstgewerbe. Wir heben hervor: Saal 72: die großen Holztüren von S. Marcellino e Festo mit Heiligenbüsten und feinem Rankenwerk (16. Jh.). — In Saal 73 abruzzesische Fayencen vom 16. bis 18. Jh.; darunter der große Teller mit dem Urteil des Paris in der Mittelvitrine, von A. Lolli (um 1600). — Saal 74: vorzügliches Porzellan (Ginori, Capodimonte, Neapel). — In Saal 76 einige instruktive Modelle und Ansichten der Certosa und des Castel S. Elmo, Ausstattungsstücke und Dokumente zur Geschichte des Klosters; außerdem eines der schönsten Werke des Micco Spadaro: das Dankgebet der Kartäuser an die Madonna nach dem Ende der Pest von 1656 (der Maler selbst hatte hier im Kloster Zuflucht gefunden und schenkte den Mönchen zum Dank dieses Bild). Man erkennt an seinem roten Gewand den Kardinal Filomarino; neben ihm kniet der Prior Andrea Cancelliere; am rechten Bildrand Spadaro selbst und sein Freund Viviano Codazzi. Im Hintergrund der weitgeöffneten Loggia erscheinen wie eine Friedensverheißung die in der Tiefe liegende Stadt und der Golf im Morgenlicht.
Eine kleine Tür im westl. Flügel des Kreuzgangs führt über einige Treppenstufen zum Parlatorium (79), dem Besuchszimmer der Mönche, mit Fresken des Ant. Avanzini (Geschichte des hl. Bruno). Im anschließenden Durchgangsraum (80) Deckenfresken von Ippolito Borghese; an den Wänden eine Heimsuchung von Cav. d’Arpino, Maria im Tempel von Flaminio Torelli, Predigt Johannes’ d. T. von Massimo Stanzione. — Es folgt der Kapitelsaal (81) mit feinem Chorgestühl (Anfang 17. Jh.) und Deckenfresken von Corenzio. An der rechten Wand ein hl. Bruno, dem die Madonna erscheint, von Simon Vouet (1620) und eine dem Paolo Finoglia zugeschriebene Beschneidung Christi; links die Anbetung der Könige und Hirten (leider stark zerst.) von Battistello Caracciolo (um 1620/30); von demselben die Figuren der hll. Martin und Johannes d. T. rechts und links des Bogens der Schmalwand, in der sich der Durchgang zur Apsis der Kirche befindet. Darüber Jesus unter den Schriftgelehrten von dem stets erfreulichen Francesco de Mura; in der Lünette Christus und die Ehebrecherin von Corenzio.
Die Kirche, ein einfacher Saalraum mit Seitenkapellen, zählt dank ihrer malerischen Ausstattung zu den höchsten Leistungen des neapolitan. Seicento. Daß aus dem Zusammenwirken so gegensätzlicher Individualitäten wie Lanfranco, Ribera, Stanzione als Maler, Fanzago als Dekorateur ein so ausgeglichenes Ensemble hervorgehen konnte, wird immer erstaunlich bleiben. Dabei ist die architekto-
nische Substanz des Gebäudes im wesentlichen identisch mit der 1368 geweihten Kartäuserkirche, einer kreuzgewölbten, querschifflosen Pfeilerbasilika mit Vorhalle und Rechteckchor; es bedurfte lediglich der Umwandlung der Seitenschiffe in rundbogig gerahmte Einzelkapellen, um den heutigen Eindruck hervorzurufen — ein Beispiel für die zeitüberdauernde Stabilität italien. Raumempfindens. Während die architektonische Umgestaltung noch von Dosio und Conforto geleitet wurde (1580 ff.), ist Fanzago (seit 1623) für den Hauptteil der Marmordekoration verantwortlich (unverkennbar von seiner Hand die mit quellendem Ornament durchsetzten Pilasterkapitelle, die Engelvoluten an den Bogenscheiteln und die überdimensionalen »rosoni« aus dunkelgrauem Marmor in den Gewänden der Kapellenöffnungen). Auch der marmorintarsierte Fußboden im Chor stammt von Fanzago (um 1650), der des Schiffes von seinem Nachfolger Bonaventura Presti (1673 fertiggestellt und leider stark zerst., derzeit in Restaurierung). Presti wird auch das fein geschnitzte Chorgestühl in der Apsis zugeschrieben. Dagegen möchte man die in Marmor, Halbedelsteinen und Bronze ausgeführte Chorbalustrade, die einige reine Rokokoformen enthält, doch eher ins 18. Jh. setzen (in dem nachweislich noch an der Ausstattung der Kirche gearbeitet wurde).
Ausstattung. Die Wölbung des Langhauses hat Giov. Lanfranco 1638 mit einer großen illusionistisch-dekorativen Himmelfahrt Christi bemalt (Blickpunkt am Eingangsportal des Langhauses). Die Kreuzrippen des got. Gewölbes bilden das Gerüst einer perspektivischen Scheinarchitektur, durch deren Öffnungen der Himmel als einheitlicher Luftraum hereinschaut. Die Figuren sind gleichwohl nicht in reiner Untersicht gegeben, sondern jeweils in Richtung der Gewölbekappen »liegend« — eine bolognesisch-klassizist. Einschränkung des reinen Illusionsprinzips. Stark leuchtende Lokalfarben vor gleichmäßig hellem Grund bestimmen den koloristischen Eindruck; die feurige Bewegtheit der Figuren, in einzelnen Motiven deutlich von Michelangelos Sixtinischer Decke inspiriert, übt ihre Wirkung auf den ganzen Kirchenraum. Vom selben Meister in den Fensterlünetten die gleichfalls heftig agierenden Apostel und, über der Eingangswand, »Christus den Sturm stillend« und »Petrus auf dem Wasser wandelnd«. — Eine radikale Absage an den dekorativ-extravertierten Geist italien. Freskomalerei formulierte der Spanier Giuseppe Ribera mit dem auf Leinwand gemalten Prophetenzyklus in den Arkadenzwickeln des Schiffes (1638-43): 12 in sich gekehrte, in schattiges Dunkel ge-
hüllte Figuren von unvergleichlicher physiognomischer Realistik; von Ribera stammen auch die beiden machtvollen Halbfiguren des Moses und Elias rechts und links über der Eingangstür. — Im Zentrum der Eingangswand die Beweinung von Massimo Stanzione (1638), deren Beseeltheit und edel-schwungvolle Komposition selbst den in Neapel so kritisch gestimmten Jakob Burckhardt zu Bewunderung hinriß.
Seitenkapellen links (vom Haupteingang her): 1. An der Decke kraftvoll gedrängte Historienbilder von Batt. Caracciolo (Geschichte des hl. Januarius, 1631); in den leider stark beschädigten Lünetten, ebenfalls von Caracciolo, sieht man den Schutzpatron der Stadt in einen Titanenkampf mit ihrem Erzfeind verwickelt: Stillung eines Vesuv-Ausbruches und Aufhalten des auf Neapel zufließenden Lavastroms. Altarrelief (Maria überreicht dem Heiligen die Schlüssel der Stadt) von D. A. Vaccaro. — In der 2. Kapelle erweist Stanzione sich als Meister der Freskotechnik. Im Gewölbe die Apotheose des hl. Bruno, ein glanzvolles Stück Hell-in-Hell-Malerei in der Tradition Coreggios; darunter anschaulich erzählte Szenen aus dem Leben der ersten Certosini, malerisch zusammengehalten durch das feierliche Weiß der Ordensgewänder. — 3. Die Decke enthält, in kleinteiligem Feldersystem, 9 Fresken mit Szenen aus dem Marienleben von Batt. Caracciolo (1631), die in Komposition und Zeichnung den größten Leistungen des Cinquecento nur wenig nachgehen; die Lünetten (Anbetung der Hirten und Beschneidung) bezeichnen den Höhepunkt des plastisch-monumentalen Freskostils der letzten Lebensjahre des Meisters. An den Wänden 3 große Leinwandbilder (Verkündigung, Heimsuchung und Himmelfahrt Mariae) von Fr. de Mura; die Skulpturen (die Jungfräulichkeit und ihre Belohnung, Amoretten und Cherubim) stammen von Gius. Sammartino (1757).
Seitenkapellen rechts: 1. Gewölbefresken aus dem Leben des hl. Hugo, von Corenzio; am Altar eine große Madonna mit den hll. Hugo und Anselmus, von Stanzione, in satten, leuchtenden Farben, inspiriert von venezianischen Sacra-Conversazione-Bildern; an den Wänden 2 bedeutende Historienbilder A. Vaccaros: Auferweckung eines toten Kindes und Gründung der Kathedrale von Lincoln durch den hl. Hugo. — Von hier aus rechts in die Rosenkranzkapelle, mit feiner Stuckdekoration von D. A. Vaccaro und einem weiteren Bild von Caracciolo: hl. Januarius mit anderen hll. Bischöfen. — 2. Kapelle: ein Höhepunkt der Dekorationskunst Fanzagos; im Gewölbe wieder ein Fresko Stanziones: eine dramatische Höllenfahrt Christi, »sotto-in-sù« aus der Sicht der Verdammten dargestellt; vom gleichen Meister die 4 Kardinaltugenden in den Zwickeln und die mit breitem Pinsel auf Leinwand gemalten seitlichen Lünettenbilder: Gastmahl des Herodes und Enthauptung Johannes’ d. T. (1645); am Altar eine Taufe Christi von Carlo Maratta (1710), leider nicht in bester Verfassung; an den Seitenwänden 2 Johannes-Darstellungen von Paolo
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Certosa di S. Martino. Nordwestecke des Großen Kreuzgangs (C. Fanzago)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Certosa di S. Martino. Der Große Kreuzgang im 15. Jh. (Holzintarsie vom Gestühl des Konversenchors)
de Matteis. — 3. Gewölbefresken (Geschichte des hl. Martin) von Paolo Dom. Finoglia; an den Seiten 2 effektvolle Bilder von Solimena: Erscheinung Christi vor dem hl. Martin und Teilung des Mantels mit dem Bettler; der plastische Schmuck der Kapelle wieder von Sammartino (1757).
Die Deckenbilder der Chorapsis, Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, wurden schon 1589 vom Cav. d’Arpino begonnen, von G. B. Azzolino beendet. In der Lünettenzone weitere Werke Lanfrancos: an der Schmalwand ein bis zum Rand von dramatischem Geschehen erfüllter Kalvarienberg (1638); seitlich der Fenster Leinwandbilder einzelner Heiliger des Kartäuserordens (1637). — Im Zentrum der Apsis steht die Anbetung der Hirten von Guido Reni (Tafel S. 256), ein authentisches Spätwerk des großen Bolognesen (um 1641; ein Z., nahezu identisches Exemplar in der National Gallery in London; die von zeitgenössischen, an die glatte Manier der früheren Jahre gewöhnten Kritikern in Umlauf gesetzte Legende vom unvollendeten Zustand des Neapler Bildes wurde durch die Restaurierung von 1945 widerlegt). Mit der Weisheit des Alters hat Reni darauf verzichtet, sein Thema im Sinne jenes Hell-Dunkel-Effektes auszubeuten, dem die Poesie der Hl. Nacht in der italien. Barockmalerei zum Opfer zu fallen pflegt.
Nur ein gedämpftes Leuchten, das teils vom Himmel, teils von dem in der Krippe liegenden Jesusknaben ausgeht, verklärt die sparsam angedeutete nächtliche Szenerie und verleiht den eigentümlich erloschenen Farben ihren zarten Silberglanz. Ausdruck und Haltung aller Figuren sind von vollkommener, stiller Natürlichkeit; in einzelnen Köpfen und Gebärden, so v. a. in der Gruppe der Madonna mit dem Kinde, scheint die Stimmung italien. Andachtsbilder des Quattrocento zu neuem Leben zu erwachen. Auch die Komposition, in der Beherrschung des Tiefenraums von einsamer Meisterschaft, hat allem malerisch-barocken Pathos abgeschworen zugunsten eines ruhigen, scheinbar zufälligen Beieinanderseins der von nah und fern herbeigeströmten Zuschauer. — 4 große Leinwandbilder schmücken die Seitenwände der Apsis.
Links die Fußwaschung von Caracciolo (1622), eine großfigurige Szene auf kahler, auch koloristisch kaum belebter Bühne, von unstreitig bedeutender Erfindung: Christus, in demütiger Haltung, kniet isoliert im Zentrum des Bildes, durch sein grellrotes Gewand von den fahlen Erdfarben der Jünger tragisch abgesondert. Daneben die Kommunion der Apostel von Ribera, 1638 bestellt, aber erst 1651 abgeliefert (derzeit in Restaurierung). Rechts Einsetzung der Eucharistie, von einem unbekannten Nachahmer Veroneses; daneben das Abendmahl von M. Stanzione, kompositionell auf Veroneses Spuren wandelnd, aber in allgemeine Finsternis getaucht. — Die Nischenstatuen, »Gehorsam« und »Sanftmut«, stammen Von Giuliano Finelli und Cos. Fanzago.
In der anschließenden Sakristei (84) bewundert man v. a. die Intarsien der ringsumgeführten Wandbänke, als deren Meister ein
Hendrik von Utrecht (1598) genannt wird; in der oberen Zone links alttestamentliche Szenen, rechts die Offenbarung des Johannes; darunter, in Abwandlung älterer Muster (vgl. S. Anna dei Lombardi, S. 49), eine Serie architektonischer »prospettive« von fabelhaftem Reichtum der Formen und Motive. — Über den Schränken Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, von unbekannter Hand. Die Lünettenfresken (Propheten und Sibyllen) sind von Luca Cambiaso; die Decke mit der Leidensgeschichte Christi und verschiedenen allegorischen und biblischen Figuren, in einem Michelangelos Sixtinischer Decke nachgebildeten Rahmensystem, gilt als eines der besten Werke des Cav. d’Arpino. Über dem Eingang eine Verleugnung Petri von einem unbekannten, wohl französ. Caravaggisten; darüber eine Kreuzigung von Cav. d’Arpino, umgeben von einer gemalten Halbkreiskolonnade von Viviano Codazzi. Für das gegenüberliegende Bogenfeld entwarf der gleiche Meister eine Treppenbühne, die Mass. Stanzione mit einer düster-dramatischen Darstellung des Ecce homo bevölkerte. — Von Stanzione auch der Miniaturfreskenzyklus (alttestamentliche und Passionsszenen) im folgenden Durchgangsraum (85), erfindungsreich erzählt und farbig voller Delikatesse; dazwischen sitzen 4 prächtige Evangelisten in Chiaroscuro. An den Wänden 2 stark unter dem Eindruck Veroneses stehende Bilder von Luca Giordano, Berufung von Petrus und Andreas sowie Zinsgroschen; daneben Kardinaltugenden von Paolo de Matteis.
Von hier aus betritt man die Cappella del Tesoro (86), einen kleinen, doch weit und licht wirkenden Zentralraum mit flachen Kreuzarmen und halbrunder Apsis. Ihren größten Schatz bilden die Gewölbefresken des Luca Giordano, eines der letzten Werke des Künstlers (1704), Höhepunkt und Zusammenfassung seiner gloriosen Meisterschaft. Das Deckenbild, Triumph der Judith, bildet eine wahre Orgie gewagter, doch mühelos beherrschter Verkürzungen. Während im Zentrum die himmlischen Heerscharen und Gottvater luftig durcheinanderwirbeln, geht es an den Rändern irdisch-kriegerisch drunter und drüber. Doch löst die Bewegung sich nirgends ins Formlose auf, alles bleibt vermittelt durch das präzis gezeichnete, ganz individuell aufgefaßte figürliche Einzelmotiv, in dessen immer neu ansetzender Variation das unzerstörbare Temperament des 72jährigen sich auslebt. An der Seitenwand links: Opfer Abrahams; Daniels Freunde im Feuerofen des Nebukadnezar. Über dem Altar: das Wunder der ehernen Schlange. An der Seitenwand rechts: Moses schlägt Wasser aus dem Felsen; Manna-Lese. Über dem Eingang das Opfer des Aaron, eine der erstaunlichsten Leistungen reiner Lichtmalerei im Fresko, leider durch Feuchtigkeit angegriffen und in rasch fortschreitendem Verfall. — Am Altar Riberas Grablegung Christi von 1637 (Tafel S. 257), wohl das berühmteste der neapolitan. Werke des großen Spaniers. Ein merkwürdig stilles, ja kühles Bild, sehr weit entfernt von der leidenschaftlichen Totenklage Stanziones an de
Eingangswand der Kirche (mit der Ribera hier siegreich konkurriert haben soll). Der leblose Körper Christi liegt eckig gebrochen auf dem Leichentuch, 2 große Nägel erinnern an die überstandene Kreuzigung. Maria, Johannes und Joseph von Arimathia scheinen in stummer Konversation begriffen. Kein Blick trifft den Leichnam; nur Maria Magdalena, schattenhaft am linken Bildrand wahrnehmbar, wagt eine zärtliche Berührung. So ist das Pathos des Schmerzes, bei Stanzione in weitgreifender Ausdrucksbewegung verströmend, hier zurückgenommen in das halb fragende, halb ergebene Mienen- und .Gebärdenspiel der Trauernden; dementsprechend hat die kompositorisch-plastische Einheit der Gruppe sich aufgelöst in eine von innerer Spannung erfüllte Konfiguration scharf beleuchteter, sprechender Einzelmotive, die aus dem verbindenden Dunkel des Grundes hervortreten. Das aus vibrierenden Schwarz-und Grautönen entwickelte Kolorit bezeichnet einen Höchststand der individuellen Technik Riberas und zugleich einen (von Caravaggio vorbereiteten) Krisenmoment der Barockmalerei: die Entthronung des schönlinig-expressiven »disegno« durch eine lückenlos ausgearbeitete, gegen jeden unmittelbaren Gefühlsausdruck gleichsam abgedichtete malerische Textur — ein Weg, den freilich nicht mehr Neapel, überhaupt nicht Italien, sondern der Norden Europas (Rembrandt) zu Ende gehen wird.
Zur Apsis der Kirche zurückgekehrt, betritt man durch ein im Chorgestühl verstecktes Türchen rechts vom Hauptaltar den Konversenchor (87). Er enthält noch ein schönes, im 17. Jh. restauriertes Quattrocento-Chorgestühl, das sich vordem in der Apsis der Kirche befand, von Giovanni Francesco d’Arezzo und seinem Schüler Maestro Prospero, mit architektonischen Motiven; auf der 3. Tafel der rechten Seite erblickt man den hl. Bruno, der den neapolitan. Kartäusern ihre Stätte anweist (»hic est locus vester«), mit einer Abbildung der Fassade der Trecento-Kirche; die letzte Tafel derselben Seite zeigt den urspr. Zustand des Chiostro Grande (Tafel S. 241) mit der noch got. S-Flanke der Kirche.
Darüber in Fresko imitierte Gobelins mit Landschaften in der Art Paul Brills (biblische Szenen und Leben der Kartäuser) von Micco Spadaro. Am Altar der hl. Michael von A. Vaccaro. — Eine Tür zur Rechten führt in einen schmalen Korridor, von da aus in die Magdalenenkapelle (88), ein Kämmerchen mit prächtigen Settecento-Dekorationen und einem Bild der Titelheiligen von A. Vaccaro. — Durch einen weiteren Korridor links neben der Kapelle gelangt man in den Chiostrino del Fanzago (89), einen von diesem Meister angelegten Lichthof mit exquisitem Dekor in Stuck und Marmor; von Fanzago auch das marmorne Lavabo unter der großen Loggia. — Rechts angrenzend das geräumige Refektorium (90); an seiner Stirnwand ein kolossales Leinwandbild von Andrea Malinconico: Hochzeit zu Kana. — Ausgang nach dem Chiostrino dei Procuratori; im Korridor Überreste des got. Baues.
S. Michele (an der Einmündung des Toledo [Via Roma] in die Piazza Dante)
Ein charakteristisches Werk des universal begabten D. A. Vaccaro, erb. 1729-35 für eine Kongregation von Weltgeistlichen, an Stelle einer bescheidenen Kapelle des 16. Jh. (S. Maria di Providenza).
In der hohen, schmalen Fassade löst das System der Ordnungen sich von. unten nach oben zunehmend in kurvige Linienzüge auf, um schließlich in einen ganz krausen Stuckvolutenaufsatz einzumünden — ein Paradestück‘ für »manieristische« Tendenzen im neapolitan. Spätbarock (die unteren Partien aber möglicherweise bei einer Restaurierung Von 1857 verändert). — Von ähnlicher Verschrobenheit das Innere, ein kreuzförmiger Kuppelbau mit kurzen Querarmen, etwas längerem Chorarm und querrechteckigem Presbyterium mit seitlich ausgebuchteten Längswänden. Über dem Hauptraum tragen 4 kleine Eckzwickel einen oktogonalen Tambour; darüber liegt, von
Konsölchen unterstützt, der runde Fußring der Kuppelkalotte, die von 8 lebhaft geschweiften Fenstern angeschnitten wird. Über dem Presbyterium ein weiteres kuppeliges Gewölbe von ellipsoider Grundgestalt, das in einer hohen, mit »Palladio-Fenstern« versehenen Laterne ausmündet.
Die urspr. Dekoration bestand durchweg aus weißen oder ganz leicht getönten Stukkaturen. Der farbige Stuckmarmor der Wände stammt aus dem 19. Jh.; überdies wirkt das gelbliche Licht der modern verglasten Fenster entstellend und häßlich. — Das Hochaltarbild (S. Michele) malte Marullo, die Ovalbilder der Seitenaltäre (die hll. Irene und Emidio in Engelwölkchen als Schutzpatrone über der Stadt schwebend) sind von Vaccaro. — In der Sakristei noch ein bes. schönes marmornes Lavabo in reinstem Rokoko (1768).
Monte della Misericordia (Piazzetta Riario Sforza, an der S-Flanke der Kathedrale; Kirche bis 10 Uhr vormittags geöffnet)
Die 1601 vom städtischen Patriziat ins Leben gerufene Stiftung für Armen- und Krankenpflege (»monte« heißt hier soviel wie Vermögen, Kapital) widmet sich noch heute in voller Unabhängigkeit ihren barmherzigen Zwecken. Ihr Sitz wurde 1658-78 von Francesco Antonio Picchiottti erbaut.
Die Fassade hat über einem Pfeilerportikus 2 Vollgeschosse mit Pilasterordnung und reichlich stuckierten Fensterrahmungen. Durch die Tür in der 2. Arkade von rechts betritt man die Kirche, einen hohen und hellen Zentralraum über oktogonalem Grundriß. Große Nebenkapellen (in den Hauptseiten) wechseln mit kleinen (in den Diagonalen, darüber Coretti); 8 Pilasterbündel in den Winkeln des Oktogons bilden entschiedene Vertikalen, die sich, durch die Verkröpfungen des Gebälkes hindurch, bis in den Gewölbescheitel hinaufziehen. Die stark gestelzte Kuppel enthält 2 Zonen von Fenstern, in jedem Gewölbefeld wieder zu einer vertikalen Gruppe verbunden; darüber noch eine lichtspendende Laterne. Die Dekoration entstammt dem 18. Jh.; von besonderem Reiz die exquisiten Marmorintarsien der Altäre.
Ausstattung. Der Hauptaltar, gegenüber dem Eingang, trägt Caravaggios Sieben Werke der Barmherzigkeit von 1607/08 (Tafel S. 272), eine halb realistische, halb allegorische Darstellung des Programms der Stiftung, in Anknüpfung an die Worte des Herrn bei Matthäus 25, 35-36: »Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränket. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen.« Als 7. Werk fügte spätere Tradition das Totenbegraben hinzu. Ungünstige Aufstellung und starke Verschmutzung des Bildes machen es fast unmöglich, die eng ineinander verschränkten, momentweise aus nächtlichem Dunkel hervortauchenden Szenen zu entziffern. Im Vordergrund links fällt der scharf beleuchtete Rückenakt eines am Boden Liegenden ins Auge; ein vornehmer Jüngling kleidet ihn, indem er nach Art des hl. Martin seinen Mantel zerschneidet. Links neben dem Liegenden, kaum erkennbar, ein verschatteter Kopf mit betend gefalteten Händen, in dem man den zu besuchenden Kranken vermuten muß. Darüber, am linken Bildrand, ein wohlgenährter Bürger (Porträt eines Stifters?), der einem mit Wanderstab und muschelgeschmücktem Hut versehenen Pilger seine Herberge anweist. Hinter dieser Gruppe wird ein Durstiger getränkt; es ist Samson, dem Gott aus seinem Eselskinnbacken Wasser fließen läßt (Buch der Richter 15,19). Rechts im Hintergrund wird bei kaltem Fackelschein ein Toter zu Grabe getragen. Speisung des Hungrigen und Gefangenenfürsorge sind zu einer einzigen Szene zusammengezogen, mit Hilfe der sonderbaren Legende von Pero, einer jungen Römerin, die ihren gefangenen Vater Cimon vor dem Hungertode bewahrt, indem sie ihm ihre Brust reicht — ein
jener Zeit ganz geläufiges Sinnbild karitativer Liebesübung (vgl. dazu die pompejanischen Terrakottagruppen im Museo Archeologico Nazionale, 1. Stock, Saal 80, Vitrine links vom Fenster). Am oberen Rand des Bildes erscheint die Madonna, auch sie in geisterhaftes Dunkel getaucht, begleitet und halb verdeckt von 2 Engeln, die in heikelster Verschlingung, ein phantastisch geflügeltes Doppelwesen, durch den leeren Raum dahinstürzen. Die Tonskala reicht vom tiefsten Schwarz über alle Nuancen von Braun und matt schimmerndem Silbergrau bis zum Kalkweiß des Fackellichtes; keine Farbe belebt das Bild, so wie kein Laut die Traumstille zu durchbrechen scheint, in der die barmherzigen Werke sich hier vollziehen.
Michelangelo Merisi Caravaggio, Die sieben Werke der Barmherzigkeit, 1608, Pio Monte della Misericordia in Neapel.
Der tiefe Eindruck, den Caravaggios Kunst in Neapel hinterließ, spricht aus B. Caracciolos wenige Jahre Später entstandener Befreiung Petri (1. Kapelle links vom Eingang). Gleichwohl erscheint der etwa 40jährige Meister als unabhängiger Kopf, der mit den neuen Mitteln frei zu schalten weiß. Das Thema darf als Anspielung auf die Befreiung gefangener Christen aus türkischer Sklaverei verstanden werden, die damals eine der Hauptaufgaben der Stiftung bildete. Die Finsternis der Szenerie ist hier erzählerisch motiviert; die Helligkeitskontraste, unterstützt durch klare Lokalfarbigkeit, werden zur Klärung der räumlichen Anordnung (dunkle vor hellen, helle vor dunklen Figuren) eingesetzt: Folgerichtig bildet das eigentlich thematische Gegensatzpaar, die Lichtgestalt des Engels und der von der Kerkerhaft noch umdüsterte Petrus, den Gipfelpunkt auch der Hell-Dunkel-Komposition.
Am nächsten Altar rechts die Grablegung Christi von Luca Giordano (1672), ein rechtes Virtuosenstück des großen Neapolitaners. Es illustriert die Wendung der einheimischen Malerschule vom Caravaggismus der 1. Jahrhunderthälfte zum vorwiegend aus röm. Quellen (P. da Cortona) gespeisten Hochbarock. Dem Nordländer mag Caravaggios in sich gekehrtes Pathos nähergehen; doch sollte niemand sich durch solche Nachbarschaft den Genuß an Lucas Malerei verderben lassen. Ein Gefühl, das sich in konventionellen Formen äußert, braucht deshalb nicht unecht zu sein, und gerade Giordanos »tocco«, die scheinbar absichtslose Leichtigkeit seines Pinselstrichs, erweist sich hier als ein feines Kunstmittel, geeignet, den überkommenen Ausdrucksgebärden jenen Lebenshauch einzublasen, den der barocke Subjektivismus forderte.
Die übrigen Altarbilder der Kirche, ihrem Gegenstand nach gleichfalls mehr oder minder direkt auf die frommen Werke der Stiftung bezogen: zwischen Giordano und Caravaggio die Auferweckung der Tabitha von Fabrizio Santafede; rechts von Caravaggio: Das Gleichnis vom Samariter von Giov. Vinc. Forli; dann Die Auferweckung des Lazarus, ebenfalls von Santafede; schließlich Der Loskauf eines Sklaven durch den hl. Paulinus, von Carlo Selitto.
Am linken Ende der Vorhalle führt eine Treppe hinauf in die Büroräume der Stiftung, deren nicht unbedeutende Gemäldesamm-
lung auf Wunsch gern gezeigt wird. Sie enthält einige der besten Werke von Francesco de Mura — Büßende Magdalena, ein jugendlicher Johannes mit dem Lamm — sowie eine große Anzahl von Bozzetti dieses fruchtbaren Meisters. Bemerkenswert ferner 2 kleine 8eckige Brustbilder der hll. Agnes und Apollonia von Massimo Stanzione; eine bedeutende, ernste und düstere Kreuzabnahme von Fracanzano; ein Selbstbildnis Luca Giordanos; einige phantastische Landschafts- und Ruinenstücke von Leon. Coccorante.
Monte di Pietà (Via S. Biagio dei Librai 114, Ecke Vico S. Severino; Inneres am frühen Vormittag geöffnet)
Es handelt sich um eine Mitte des 16. Jh. von frommen Privatleuten eingerichtete Armenkasse, die zu festen Zinssätzen kleinere Geldsummen auslieh; der Hauptzweck dieser Institute, die damals mit kirchlicher Unterstützung in vielen Städten Italiens gegründet wurden, war die Bekämpfung des von den Juden beherrschten Kreditwuchers. 1597 erwarb die Stiftung das Haus der Grafen von Montecalvo in der Via S. Biagio dei Librai und ließ an dessen Stelle von G. B. Cavagna den heutigen Palast und seine Kapelle errichten.
Die 4geschossige Außenfront des Gebäudes besitzt einfache Peperingliederungen; die Außenachsen sind durch rahmende Quaderketten risalitartig hervorgehoben; das Piano nobile (hier wegen der Enge der Straße das 2. Obergeschoß) hat Balkonfenster und Giebelverdachungen, die übrigen Stockwerke zeigen einfache Mezzaninfenster. Über dem großen Rustika-Portal die Gründungsinschrift des Vizekönigs Enriquez de Guzman, Grafen von Olivares (1599).
Ein imposantes Pfeilervestibül von 2 x 3 Jochen lenkt den Blick sogleich auf die im Grund des Hofes liegende Cappella della Pietà. Ihre Fassade hat unten eine ionische Pilasterordnung mit Dreiecksgiebel, etwa vom Typus der S. Maria della Stella alle Paparelle von Mormando; das Obergeschoß zeigt ein einfaches Feldersystem mit großem ädikulagerahmtem Mittelfenster; darüber sitzt noch ein Uhrtürmchen, flankiert von Voluten und Zierobelisken.
In den Nischen zu seiten des Portals 2 Statuen von Pietro Bernini (1601): links »Caritas«, die Figur unter einem schweren, faltenreichen Gewand begraben; 3 schöne Knaben klettern in manieristisch vertracktem Zickzack auf ihr herum; rechts »Securitas«, schlafend auf eine Säule gestützt, aber gleichwohl von lebhaft bewegtem Faltenwurf (reizvoll der Vergleich mit der im Motiv ganz ähnlichen S. Bibiana von Berninis Sohn Gianlorenzo in der gleich-
namigen Kirche zu Rom). Die Pietà-Gruppe im Tympanon stammt von Michelangelo Naccherino.
Das Innere ist ein beinahe quadratischer Saalraum. Die Längswände haben je eine flache, rundbogig gerahmte Altarnische, flankiert von schmalen Seitenfeldern mit Türen und Coretti; das Tonnengewölbe wird durch weit eingreifende Stichkappen quasi zur Zentralform umgedeutet.
Die sehr feine und wohlerhaltene Stuckdekoration bildet ein kleinteilig-kompliziertes Feldersystem; darin ein vorzüglicher Freskenzyklus (Passion und Auferstehung) von Corenzio. Das Hochaltarbild, die Grablegung Christi, stammt von Fabrizio Santafede (1601); daneben eine Pietà-Gruppe aus Holz vom Anfang des 17. Jh.; an den Seitenaltären die Auferstehung Christi, von Imparato und Santafede (1608), rechts Himmelfahrt Mariae von Ippolito Borghese (1603). — Links vom Hochaltar die Sakristei mit dekorativen Malereien (4 Tugenden in Chiaroscuro) und prächtigem Schrankwerk des 18. Jh.; an der Decke ein hervorragend schönes Leinwandbild von Giuseppe Bonito (Apotheose der Caritas, 1742). — Rechts gegenüber der Sitzungssaal des Vorstandes der Stiftung, mit in Rocaillewerk aufgelöster Scheinarchitektur und 4 herrlichen Eckschränken; an der Decke noch ein Corenzio-Fresko (die »Hilfe«, mit prall gefülltem Geldbeutel und beherzigenswertem Motto) von 1601. Im Vorzimmer weitere Settecento-Dekorationen und eine Vitrine mit alten Paramenten.
Sacro Monte dei Poveri del Nome di Dio (Via dei Tribunali 213)
Der Titel nennt eine 1563 gegründete karitative Laienbruderschaft, die sich im 17. Jh. zu einem florierenden Bankunternehmen entwickelte. Ihr Sitz befindet sich seit 1616 im Palazzo Riem (ein freundlicher Pförtner führt).
Die mit Rustika-Quadern und Lisenen gegliederte Straßenfront des Palazzo Ricca, aus der 2. Hälfte des 18. Jh., wird neuerdings Ferdinando Fuge. zugeschrieben; im Hof links das in 4 Geschossen sich öffnende Treppenhaus des ersten Baues, vom Anfang des 16. Jh. — Am Ende des Hofes erhebt sich die hohe schmale Fassade der 1616 gegründeten Bruderschaftskirche. Dahinter liegt das Oratorium der Brüder, um 1670-80 von einem Giuseppe Caracciolo erb.; es enthält eine der schönsten barocken Innendekorationen von Neapel, heute total verschmutzt und verwahrlost, aber unberührt von späteren Restaurierungen. An den Wänden des rechteckigen Saales zieht sich ein Chorgestühl entlang; das Obergeschoß hat Fenster zwischen Doppelpilastern und stuckierte Engelgruppen. Darüber ein Muldengewölbe mit Stichkappen und prachtvollem weiß-gelbem Stuckdekor; im Spiegel ein großes Fresko (die Immaculata im Kreise der Tugenden) von Luca Giordano. Gleichfalls von Giordano stammen die leider stark beschädigten Bilder der Altarwand: In der Mitte eine Beschneidung Christi — Inszenierung und schimmerndes Kolorit kommen von Veronese her, im Figürlichen spürt man Einflüsse Pietros da Cortona; daneben Verkündigung und Geburt. An der Eingangswand eine üppig dekorierte Orgel.
S. Nicola alla Carità (Piazza Carità, am Toledo)
Die Kirche gehörte einer 1622 gegründeten Kongregation der Pii Operai, die sich der Krankenpflege widmeten. Ein von ihnen gesundgepflegter Schweizer stiftete den Brüdern die Mittel zum Bau der Kirche, die zwischen 1646 und 1682 entstand. Als erster Architekt wird ein Onofrio Gisolfi genannt, später soll Fanzago den Bau weitergeführt haben.
1700 entwarf Francesco Solimena die schöne (erst nach seinem Tode zu Ende geführte) Fassade, die an Vorbilder des röm. Frühbarock anknüpft (Maderno, Soria); der Geschmack des Malers verrät sich in der delikaten Polychromie der Marmor-und Peperingliederung (heute leider übel verschmutzt). Der plastische Dekor wurde von Bart. Granucci und Paolo Persico ausgeführt. — Das Innere, eine kurze Pfeilerbasilika mit lichterfüllter Vierungskuppel (doppelter Fensterkranz in Tambour und Kalotte), ist bedeutend durch seine Malereien, die im gegenwärtigen Zustand nur sehr eingeschränkt genießbar sind.
Solimena schuf die Fresken des Schiffsgewölbes (Geschichte des hl. Nikolaus, vor 1692, derzeit in Restaurierung) und der inneren Eingangswand (Predigten Johannes’ 01. T., 1697, und des hl. Paulus, um 1700); über dem Eingang eines der besten Werke des Paolo de Matteis (Der hl. Nikolaus heilt einen Besessenen). In der 1. Kapelle rechts die Geschichte des Tobias von Giac. Diana; 2. Kapelle rechts: gutes Holzkruzifix von Nic. Fumo (1695). An den Querschiffaltären wieder 2 exzellente Solimenas (Madonna mit den hll. Petrus und Paulus, 1684, und die hll. Franz von Assisi, Franz von Sales und Antonius von Padua). In der Apsis der Tod des Nikolaus von P. de Matteis.
S. Nicola a Nilo (Via S. Biagio dei Librai, zwischen Via del Duomo und Piazza S. Domenico)
Als Kirche eines 1647 gegründeten Waisenhauses 1705 von Giac. Lucchesi erbaut.
Die 2geschossige Fassade ist um einige Meter aus der Straßenfront zurückgenommen; schräg auswärts gedrehte Pfosten mit eingestellten Säulen halten den Baukörper in Bewegung bis hinauf zum vielfach geschwungenen Giebelabschluß, über den der große Kuppeltambour herabschaut; eine kleine Treppenanlage mit ausgerundeten Läufen und phantastisch geformten Volutenwangen, heute über und über von den Warenauslagen der hier hausenden Händler bedeckt, führt zum Portal empor (2 Inschriften von 1706 besagen ausdrücklich, daß die Treppe mit den beiden seitlichen »bassi«
für den profanen Gebrauch bestimmt ist und keine kirchliche Immunität genießt). — Das halb verfallene Innere (Schlüssel beim Pfarrer von SS. Filippo e Giacomo gegenüber) ist
von hohem architektonischem Reiz: ein vollkommen zentralsymmetrisch ausgelegter Rundraum mit 8 korinthischen Wandsäulen und 4 Diagonalnischen mit Evangelistenstatuen; darüber eine hohe Kuppel, laternenlos, aber mit 4 großen Bogenfenstern im Tambour (das Gewölbe wohl später erneuert oder ergänzt)‚ die Chorkapelle nochmals mit Säulenstellung und halbelliptischer Apsis. Die gänzlich verdorbenen Altarbilder stammen von Giuseppe Castellano.
La Nunziatella (eigentlich S. Maria Annunziata; am Ende der Via Generale Parisi über dem W-Hang des Pizzofalcone)
Das ehem. Jesuitennoviziat, seit 1787 Collegio Militare, ist ein Hauptwerk des Rokoko-Architekten Ferdinando Sanfelice, etwa 1730-34 erbaut.
Die gelb-rot verputzte Zwei-Ordnungs-Fassade der Kirche, mit malerisch aufgelöstem Giebelkontur, hat konkav eingezogene Seitenflügel, doch bleibt der Mittelteil in der Ebene, so daß die zartlinige Flächenbehandlung rein und klar zur Wirkung kommt; Portal, Fenster und Volutenaufsatz bilden große plastische Akzente. — Dem geräumigen Inneren hat die ganz einheitlich durchgeführte,
farbig ungemein delikate Ausstattung eine beinahe intime Grundstimmung mitgeteilt. Das Langhaus, mit Tonnenwölbung und großen Stichkappenfenstern, hat je 2 kuppelgewölbte Seitenkapellen; ein Triumphbogen mit schräg einspringendem Gewände markiert den Ansatz der polygonal gebrochenen Apsis. Eine Folge rhythmisch gruppierter Marmorpilaster von flachstem Reliefgrad, mit graurosa gestreiften Schäften, läuft wie eine Seidenbespannung über die Wände hin; ihr entspricht das großformige marmorne Teppichmuster des Fußbodens.
Ausstattung. In die Pfeilerstirnwände sind längliche Bildfelder eingelassen (Marienerzählungen von Lodovico Mazzante); die verbleibenden Flächen werden von. zartem Rocaillewerk ausgefüllt. Die Fresken an Eingangswand, Tonne (1751) und Apsiswölbung (1732) — Bilder aus dem Marienleben — schuf Francesco de Mara; hellfarbig, heiter, bewegt, aber klar in Zeichnung und Komposition, sind auch sie auf einen gleichsam bürgerlich-intimen Ton gestimmt, der in den Genreszenen der Eingangswand (Werkstatt des Joseph, Flucht nach Ägypten) besonders schön zur Geltung kommt. Die Grenzen seines Talentes zeigt das vielfigurige Deckenfresko (Assunta): Bei feinster und reichster Durchbildung des Details bleibt das gestalterische Vermögen im ganzen an den von Solimena errichteten Standard fixiert, ohne daß Mura mit dem leichtfertig-feurigen Temperament seines Meisters wetteifern könnte. ’-Das Gewölbe der 1. Kapelle rechts freskierte Girolamo Cenatiempo, die übrigen Gius. Mastroleo. An den Seitenaltären links noch 2 feine Bilder Fr. de Muras (hll. Stanislaus Kostka und Ignatius). Die Beweinung Christi in der 1. Kapelle rechts ist eine der besten Arbeiten des Stanzione-Schülers Francesco (»Pacecco«) de Rosa (1746); die Farben sind durch gelblichen Firnis entstellt. Der von Putten Wimmelnde marmorne Hochaltar stammt von Gius. Sammartino; von dem gleichen Meister die beiden seitlich angeordneten Grabmäler der Brüder Andrea und Michele Giovene.
S. Paolo Maggiore (Piazza S. Gaetano, Via dei Tribunali)
In den Trümmern des Dioskurentempels am Forum der alten Neapolis existierte seit dem 9. Jh. eine St. Peter und Paul geweihte Kirche. 1538 machte der hl. Cajetan (Gaetano) von Thiene sie zum Sitz der Theatiner (richtiger Teatiner, von Teate, dem lateinischen Namen der Abruzzen-Stadt Chieti, wo der nachmalige Papst Paul IV., Gian Pietro Carafa, den Orden ins Leben gerufen hatte). Die Errichtung des heute stehenden Baues wurde 1581 beschlossen und ab 1583 in mehreren Etappen ins Werk gesetzt (s. u.).
Die prächtige Theatinerkirche zählt zu den Hauptmonumenten des Frühbarock in Neapel.
In ihrer erhöhten Lage hat sich die Podiumsituation des alten Tempels bewahrt; die der Fassade vorgelagerte Plattform, die man über eine 1576 erbaute 2läufige Freitreppe erreicht, entspricht dem alten Pronaos, der, bis zum Erdbeben von 1688 völlig intakt, die schönste Kirchenvorhalle Neapels abgab; Zeichnungen von Palladio und Francesco da Hollanda haben ihr Aussehen überliefert (vgl. auch S. 344).
Nur 2 der 8 gewaltigen korinthischen Säulen überstanden die Katastrophe und wurden durch marmorne Architrave mit der neu dekorierten Schauwand verbunden. An den Flanken der Fassade, in die Wand eingelassen, die Torsi zweier antiker chlamysgeschmückter Kastor- und Pollux-Statuen; über ihnen in den Nischen die Figuren Petri und Pauli, des neuen, christl. Dioskurenpaars, das über die alten Heidengötter triumphiert. Das Portal im Untergeschoß der Freitreppenanlage bildete urspr. den Eingang zur Unterkirche, einer mehrschiffigen niedrigen Pfeilerhalle, die das Grab des 1547 in Neapel verstorbenen hl. Cajetan enthält. Ein Teil dieser Räume ist neuerdings restauriert, modern ausgestattet und dem Kultus des Heiligen gewidmet worden (Zugang durch eine kleine Tür an der rechten Seiten-
wand der Kirche, vor der zur Oberkirche hinaufführenden Treppenloggia).
Francesco Grimaldi, Giovanni Battista Cavagna, Giovanni Giacomo Conferno, San Paolo Maggiore Fassade, 1538, Neapel.
Das Innere, im 2. Weltkrieg stark beschädigt, erstrahlt im Glanz einer mit allem Aufwand durchgeführten Restaurierung. Wir lernen hier das erste bedeutende Werk des Theatinerarchitekten Francesco Grimaldi kennen (* 1543 in Oppido Lucano, + 1613 in Neapel), der für den Übergang der neapolitan. Architektur von der Spätrenaissance zum Barock wegweisend gewirkt hat. Man beschränkte sich zunächst auf den Neubau von Apsis und Querschiff (1584/85); das Mittelschiff des Langhauses, mit je 4 großen und 3 kleinen Arkaden zwischen paarweise gruppierten Pilastern, wurde unter der Leitung G. B. Cavagnas 1588-92 errichtet, 1603 geweiht; erst 1627 kamen die Seitenschiffe hinzu, weshalb wir nicht sicher sagen können, wie weit diese noch mit Grimaldis Projekt übereinstimmen. Ja es wäre gut denkbar, daß die Anfügung von Seitenschiffen überhaupt erst damals beschlossen wurde. Für den Urentwurf Grimaldis bliebe in diesem Falle das sehr viel einfachere Konzept einer Saalkirche mit (vierungslosem) Querschiff und Chorarm übrig, und tatsächlich paßt die Deckenlösung (Holzdecke mit abgerundeter Kehle, keine Kuppel) sehr viel besser zu einem solchen Plan als zu dem aufwendigen Typus der Pfeilerbasilika. Das urspr. Langhaus wäre dann wie die Chor-Tribuna von dünnen Wänden eingefaßt zu denken, und anstelle der Arkaden hätten sich einfache Seitenkapellen geöffnet. Aus dem alternierenden Rhythmus der Kapellen ging dann beim Ausbau der Seitenschiffe der perspektivisch sehr reizvolle Wechsel von Querovalkuppeln und schmalen Kreuzgewölbejochen hervor; die ersteren erhalten reichliches Oberlicht, die Zwischenjoche haben kleine Fenster in den Gewölbelünetten.
Ausstattung. An der Eingangswand die Weihe des Salomonischen Tempels von Santolo Cirillo (1737), ein gedämpftes Echo der großen Eingangsfresken Giordanos und Solimenas in S. Filippo Neri und im Gesù Nuovo. Vom gleichen Maler die Wandbilder über den Arkaden des Mittelschiffs (neutestamentliche Szenen); darüber zwischen den Fenstern des Lichtgadens Bilder aus dem Leben des hl. Cajetan, von Andrea di Leone nach Entwürfen des A. Vaccaro; von Vaccaro selbst St. Peter und Paul am Triumphbogen. Die Decke des Mittelschiffs hat einen Zyklus mit Wundertaten der Apostel von Massimo Stanzione (1643/44), leider mehrfach beschädigt und restaur. — Am Altar der 3. Kapelle des
linken Seitenschiffs findet man eine Goldgrundtafel von 1498, Madonna mit den hll. Petrus und Paulus, von Fr. Cicino da Caiazzo; im letzten Joch des rechten Seitenschiffs 4 hübsche Marmorbildwerke des 17. Jh.: »Klugheit« und »Mäßigkeit« von A. Falcone, »Gerechtigkeit« und »Stärke« von Nic. Mazzone.
Die prächtig ausgestattete Sakristei (rechts neben der Hauptchorkapelle) enthält zwei 1689/90 entstandene Historienbilder von Francesco Solimena, malerische Temperamentsausbrüche ohnegleichen, die den Ruhm des damals 33jährigen Neapolitaners weit über die Grenzen seiner Vaterstadt hinaustrugen. Der Sturz des Simon Magus folgt einer von Jacopo de Voragine überlieferten frühchristl. Legende: Um Kaiser Nero (im Bilde rechts, auf erhöhtem Thronsitz) von der ungebrochenen Wirksamkeit der heidnischen Magie zu überzeugen, erhebt der Zauberer Simon sich in die Lüfte; allein sein Widersacher Petrus (links gegenüber mit betend erhobenen Händen, hinter ihm stehend Paulus) beschwört die Engel des Satans, ihn fallenzulassen, »und er fiel herab, daß sein Haupt zerschmetterte und er seinen Geist aufgab«; woraufhin der ergrimmte Nero die beiden Apostel verhaften und im Carcer Mamertinus einsperren ließ. Für Solimena ein legitimer Anlaß, alle Register äußerlicher Dramatik zu ziehen; die fast unabsehbare Fülle schön bewegter Posen unter den Zuschauern des Zauberwettkampfes zeigt den jungen Meister auf der Höhe seines Könnens. — Die Bekehrung Pauli im Stil eines kolossalen Schlachtengemäldes, als Massenregieleistung aller Bewunderung wert, verstimmt durch das Mißverhältnis zwischen dem großen Thema und der vollkommenen Ungeistigkeit seiner Darstellung. Der Sturz des kopfunter am Boden liegenden Paulus, in Caravaggios bekanntem Bilde (Rom, S. Maria del Popolo) eine Metapher der inneren Umkehr des Mannes, erscheint hier als unvermeidliche Folge des allgemeinen Durcheinanders, das die himmlische Erscheinung Christi (Personifikation der »Stimme« des Bibeltextes) ausgelöst hat. Allein das große formale Können in der Zeichnung von Pferden und Reitern steht auch hier außer Frage. — Wände und Decken des Raumes verdanken ebenfalls dem Pinsel Solimenas ihren Schmuck: Gruppen von Engeln und Tugenden, rein dekorativ aufgefaßte anmutige Weiblichkeit, in der die koloristische Meisterschaft des Künstlers sich aufs glücklichste offenbart.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Gesamtansicht nach Norden, 1689-1690, San Paolo Maggiore (Sakristei) in Neapel.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Bekehrung des heiligen Paulus, 1689-1690, San Paolo Maggiore (Sakristei) in
Neapel.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Sturz des Simon Magus, 1689-1690, San Paolo Maggiore (Sakristei) in Neapel.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Decke: Tugenden und Seligpreisungen, 1689-1690, San Paolo Maggiore (Sakristei)
in Neapel.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Fries der Längswand: Prudentia, Fortitudo, Temperantia, Pax, Justitia, Abundantia,
1689-1690, San Paolo Maggiore (Sakristei) in Neapel.
Francesco Solimena, Ausmalung der Sakristei - Fries der Längswand: Fides, Spes, Caritas, Divina, Giustizia, Religio, 1689-1690,
San Paolo Maggiore (Sakristei) in Neapel.
Der ehem. Theatinerkonvent, heute Sitz des Notariatsarchivs, enthält einen hübschen Kreuzgang mit antiken Granitsäulen und Überbleibseln von Fresken des Aniello Falcone, Mitte 17. Jh. (zugänglich durch das Portal Via S. Paolo 14, links neben der Kirche).
S. Pasquale a Chiaia (Piazza S. Pasquale) wurde von König Karl III. zum Dank für die Geburt seines 1. Sohnes (1748) gestiftet und von Gius. Pollio erbaut; der Altarbaldachin trägt das Datum 1773. Fassade mit ionischen Doppelpilastern und gebrochenem Giebel, darüber ein großes Relief mit der Apotheose des hl. Paschalis. — Das Innere, im 20. Jh. teils neu dekoriert, teils wohl auch umgebaut, zeigt ein
tiefes Vestibül mit darüberliegender Chortribüne, daran anschließend 2 zentralisierende Raumgruppen mit je 4 Freistützen; über der ersten ein Kreuzgewölbe, in dem sich die Tonnen der Kreuzarme durchdringen; die zweite trägt eine Kuppel. Die Pilasterordnung hat ionische Kapitelle vom »Michelangelo«-Typus, darüber ein reichlich verkröpftes Gesims und großzügiger Stuckdekor. Altarbilder von Sarnelli.
S. Patrizia (Via Luciano Armanni, oberhalb der Via dell’Anticaglia) gehörte urspr. zu einem im 10. Jh. gegründeten Benediktinerinnenkloster. Der heutige Bau wurde zu Anfang des 17. Jh. von Giov. Marino della Monica errichtet. Das stets verschlossene Innere enthält Bilder von Gius. Marullo, Fabrizio Santafede und einen von Ferdinando Sanfelice entworfenen Hochaltar mit einem Tabernakel von Raff. Mytens.
Chiesa della Pietà dei Turchini (auch Chiesa dell’Incoronatella; Via Medina bei der Piazza del Municipio)
Genannt nach den türkisblauen Gewändern der Zöglinge des einstmals zugehörigen Waisenhauses. Die Kirche wurde 1592-1607 erbaut und in der Mitte des 17. Jh. restauriert.
Ein kreuzförmiger, flachgedeckter Saalbau von angenehmen Proportionen, im Typus der S. Maria di Costantinopoli von Fra Nuvolo sehr ähnlich. — Die Kirche besitzt eine Anzahl bedeutender Bilder des neapolitan. 17. und 18. Jh. Langhauskapellen: 1. links: Tod des hl. Joseph, aus dem Umkreis Solimenas. — 5. links: Ein prachtvoller Schutzengel von unsicherer Zuschreibung (Aniello de Rosa oder Gius. Marullo); außerdem von Andrea Vaccaro eine Kreuzabnahme in effektvollem Helldunkel; der Körper Christi verschwindet fast gänzlich im Schatten. Vom gleichen Meister in der 1. und 2. Kapelle rechts: Christus vor Pilatus, Kreuztragung, Madonna mit dem hl. Thomas von Aquino. — In der 3. Kapelle rechts ein Battistello Caracciolo, Hl. Familie, in ikonographisch merkwürdiger Kombination mit dem Thema des »Gnadenstuhls«: Der von Maria und Joseph geführte halbwüchsige Jesusknabe blickt mit etwas ängstlicher Miene zum Himmel, wo die mächtige Gestalt Gottvaters erscheint, bereit, den Sohn als Gekreuzigten wieder zu sich zu nehmen. Zwischen ihnen schwebt als Mittlerin die Taube des Hl. Geistes. Die ausdrücklichen Caravaggio-Zitate (Engelgruppe nach den »Sieben Werken der Barmherzigkeit« im Monte della Misericordia) rücken das Bild in die Nähe der Immacolata von S. Maria della Stella (um 1617). — Im Querschiff rechts, am Altar, noch ein A. Vaccaro: Anna, die ihre Tochter Maria bei Gottvater einführt; daneben Tod der Anna und Geburt der Maria, von Giac. Farelli. — In der Apsis und im linken Querschiff 4 große dekorative Bilder von Giacinto Diana (1781): Grablegung, Anbetung der Hirten, Beschneidung und Anbetung der Könige. — In der Sakristei eine Anbetung der Hirten, von Giov. Dò, der gleich Ribera aus Játiba in Spanien stammt und etwa 1623 in Neapel auftauchte. Sein einziges bisher bekanntgewordenes Werk zeigt den offenbar hochbegabten Künstler ganz im Banne seines großen Landsmannes.
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Certosa di S. Martino. G. Reni: Anbetung der Hirten (Ausschnitt)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Certosa di S. Martino. G. Ribera: Grablegung Christi
S. Pietro ad Aram (Via S. Candida westl. des Bahnhofsplatzes; Seiteneingang am Corso Umberto I.)
Die Kirche führt ihren Namen auf einen Altar zurück, an dem St. Peter das Meßopfer zelebriert haben soll, nachdem er die hll. Candida und Asprenas zu Christen bekehrt und den letzteren zum Bischof von Neapel geweiht hatte (vgl. S. 64). Tatsächlich scheint es sich urspr. um eine Coemeterialkirche gehandelt zu haben; Überreste von Katakomben sind im Bereich der unter dem O-Teil der heutigen Kirche liegenden Hallenkrypta gefunden worden, die wohl im 17. Jh. umgebaut und um 1930 durchgreifend restauriert wurde (Zugang im Querschiff links). — Von der im 12. Jh. errichteten, im 13. und 14. Jh. restaurierten Kirche des Mittelalters hat sich nichts erhalten. Das heute stehende Gebäude, eine weiträumige Saalkirche mit flacher Vierungskuppel, entstand zwischen 1650 und 1690 nach Entwürfen von P. de Marino und Giov. Mozzetta.
Ausstattung. In der Vorhalle links, unter einem Baldachin von Muzio Nauclerio (1711), der sog. Petersaltar (12. Jh.). — Seitenkapellen links: 1. Marmorstatue des hl. Michael, 16. Jh. — 2. An der rechten Seitenwand oben ein Relief (Kreuzabnahme), gleichfalls 16. Jh. — 4. Am Altar Taufe der hl. Candida durch Petrus von Ant. Sarnelli; rechts ein hl. Augustinus von Giacinto Diana. — Am Altar der 1. Seitenkapelle rechts ein Madonnenrelief des 16. Jh.; links davor die Feier des Hl. Jahres 1600 von W. Koberger, rechts eine Grablegung von P. Negroni.
Querschiff: links eine Immacolata von Ant. Sarnelli, seitlich davon nochmals die Taufe der hl. Candida von Pacecco de Rosa und eine Madonna mit Heiligen von D. A. Vaccaro. — An den Seitenwänden des Presbyteriums 2 große Kompositionen aus dem Leben des hl. Petrus (links Petrus und Paulus auf dem Wege zum Martyrium, rechts Schlüsselübergabe), Frühwerke des Luca Giordano (1654); Chorgestühl von Giov. Domenico Vinaccia (1661), mit schönen älteren Teilen von Antonio di Fiore (1516). — Im Vorraum der links gelegenen Sakristei das Grabmal des Baldassare Ricca von Giov. Jacopo da Napoli (1519).
S. Pietro a Maiella (in der gleichnamigen Straße, der westl. Verlängerung der Via dei Tribunali)
Die Kirche wurde mitsamt dem dazugehörigen Coelestinerkonvent zu Beginn des 14. Jh. von dem königlichen Magister Giovanni Pipino von Barletta gegründet. Stifter des Ordens war der 1313 heiliggesprochene Pietro Angelari da Murrone, der am Monte Maiella in den Abruzzen ein frommes Einsiedlerleben führte, bis i. J. 1294 das Kardinalskollegium auf Betreiben Karls II. von Anjou den über 80jährigen Greis Zum Papst wählte. Ein halbes Jahr lang residierte der in weltlichen Dingen völlig hilflose Mann als Coelestin V. unter den Augen des Königs von Neapel im Castel Nuovo; dann dankte er ab, wurde von seinem Nachfolger
Bonifaz VIII. gefangengesetzt und starb 2 Jahre später elend im Kerker zu Fumone; bei Dante erscheint in der Vorhölle des Inferno »der Schatten dessen, der tat aus feigem Sinn den Erzverzicht«.
Dem frisch restaurierten und ziemlich nüchtern wirkenden Gebäude ist kaum noch anzumerken, welch zahlreiche Metamorphosen es im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat. Der Gründungsbau, durch Stiftungen des Königshauses zwischen 1319 und 1343 gefördert, war als 3schiffige Basilika mit Seitenkapellen, Querschiff und 5 Chorkapellen angelegt; das Langhaus besaß nur 3 Joche und ein vor der Eingangsfront liegendes Atrium; der Campanile mit dem alten Eingangsportal bildete die nordöstl. Ecke des Baukörpers, dessen kompakte Würfelform in den Kirchen des amalfitanischen Küstengebietes seit 1200 vorgebildet erscheint. Zwischen 1493 und 1508 wurde der Bau restauriert und um 2 Travéen verlängert, welche die Stelle des alten Atriums einnahmen; das Hauptportal wurde 1600 hinzugefügt. Um die Mitte des 17. Jh. erhielt das Mittelschiff seine Holzdecke; gleichzeitig wurde das ganze Innere barock erneuert. 1717 entwarf Francesco Saracino wiederum eine neue Innendekoration. Die erste puristische Restaurierung, die große Teile der barocken Ausstattung beseitigte, fällt in d. J. 1836. Gegen 1870 wurde auf Veranlassung einer privaten Stifterin eine »Regotisierung« in Angriff genommen, die sogar für den damaligen Geschmack unerträgliche Resultate zeitigte und schleunigst wieder unterbunden wurde. Auf eine Periode totalen Verfalls folgten im 20. Jh. mehrere Restaurierungskampagnen, welche die nunmehr erreichte Freilegung der verbliebenen got. Mauerstruktur zum Ziel hatten.
Der Außenbau zeigt ringsum schmuckloses Tuffsteingemäuer, in dem die verschiedenen Restaurierungsphasen ineinander übergehen. Das gleiche gilt für den Campanile, der den weithin sichtbaren Abschlußprospekt der Via dei Tribunali bildet; seine frei stehenden Obergeschosse dürften ihre jetzige Form im 15. Jh. erhalten haben; die letzte gründliche Wiederherstellung erfolgte 1762 durch Mario Gioffredo. Im 19. Jh. wurde die NO-Ecke des Baukörpers abgerundet, um die Via S. Pietro für den Fahrverkehr passierbar zu machen.
Der »kubistische« Zug des Urbaus prägt sich am reinsten in der Gestaltung der Chorfront aus (Vicoletto S. Pietro a Maiella), deren glatte Wandflächen nur durch ein einfaches Sockelgesims gegliedert werden.
Auch im Inneren ist die Form der Chorwand von besonderem Interesse. Ihre 5 platt geschlossenen Kapellen bilden keine gleichförmige Reihe nach Art des bekannten Zisterzienserschemas, sondern sind zu einer pyramidalen
Gruppenkomposition zusammengeordnet, indem sowohl die Breiten wie Höhen von den Seiten zur Mitte hin gesetzmäßig anwachsen; die Grundrisse der einzelnen Kapellen variieren, bei gleichbleibender Tiefe, vom Längsrechteck (außen) über das Quadrat zum Querrechteck (Hauptchorkapelle) — ein bedeutsamer Schritt der Befreiung aus dem »quadratischen Schematismus« des Mittelalters. Das relativ schmale Querschiff wie auch das Mittelschiff des Langhauses sind flachgedeckt, die quadratischen Joche der Seitenschiffe kreuzrippengewölbt, die Seitenkapellen des Langhauses etwas niedriger angesetzt und rundbogig gerahmt. Die Pfeilerform entspricht dem kanonischen Muster der neapolitan.
Gotik: rechteckiger Kern mit flacher Stirnseite zum Mittelschiff, Halbrundvorlagen an den 3 übrigen Seiten; im restaurierten Obergaden schmale 2bahnige Maßwerkfenster. All dies ist locker zusammengefügt, kein übergreifender Rhythmus zwingt die Teile unter sein Gesetz; die Gliederungen (Bögen, Fenster, Gewölbe) stehen je für sich; was Halt gibt, ist die glatte, ungeteilte Mauerfläche, welche die einzelnen Schmuckelemente (das große Maßwerkfenster der Haupt-
chorkapelle) in sich trägt. So wirkt der Raum im ganzen, bei relativ bescheidenen äußeren Abmessungen, frei und groß — erfüllt von jenem Geiste monumentaler Nüchternheit, der auch den Riesensälen von S. Chiara oder S. Lorenzo ihr charakteristisches Gepräge gibt und den Beitrag Neapels zur italien. Trecento-Gotik kennzeichnet.
Das Hauptstück der Ausstattung ist ein Zyklus auf Leinwand gemalter Deckenbilder von Mattia Preti, dem »Cavaliere Calabrese« (z. Z. teilweise in Restaurierung). 1613 in Taverna bei Catanzaro geboren, ließ Preti sich nach Wanderjahren in Rom, Bologna, Parma und Venedig gegen 1653 in Neapel nieder; 6 Jahre später übersiedelte er nach Malta, wo er als Mitglied des Ritterordens bis an sein Lebensende blieb (1699). Ähnlich dem 20 Jahre jüngeren Luca Giordano gelangte er zu einer höchst individuellen Synthese der verschiedenen Positionen der italien. Seicento-Malerei; doch bleibt die Grundstimmung seiner kraftvollen, mit heftigen Licht- und Farbkontrasten arbeitenden Kunst vom düsteren Realismus der Caravaggio-Schule geprägt. Die Entstehung dieser Deckenbilder fällt in das letzte Jahr von Pretis neapolitan. Aufenthalt und bezeichnet den Scheitelpunkt seiner künstlerischen Laufbahn; wahrscheinl. wurde ein Teil des Werkes erst in Malta vollendet und von dort nach Neapel gesandt. Trotz verhältnismäßiger Kleinheit sind sie von raumbeherrschender Wirkung und vermögen dank ihrer intelligenten und differenzierten Erzählweise auch ungeduldige Betrachter gefangenzunehmen. Der Zyklus des Langhauses ist dem hl. Petrus von Majella gewidmet: Die 3 Rundbilder zeigen (vom Eingang zum Chor) die Reise des unglücklichen Einsiedlers zur Krönung in Aquila, eskortiert von Karl II. und seinen Kriegsleuten; die Glorie des Heiligen; die fatale Abdankung im Kreise betreten dreinschauender Kleriker; auf den beiden. Rechteckfeldern sieht man die Ankündigung der Papstwahl durch einen Engel und die Versuchungen des Eremiten in seiner Einsiedelei. — An der Decke des Querhauses ist die Geschichte der Katharina von Alexandrien dargestellt: in den Rundbildern (von rechts nach links) ihre Disputation mit den Gelehrten, ihre Enthauptung und schließlich der Transport des auf Wolken hingestreckten, halb entblößten jugendlichen Leichnams nach dem Sinai; die Schmalbilder zeigen sie beim Verlöbnis und in der Gefangenschaft.
Mattia Preti, Freskenzyklus - Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus, 1659, San Pietro a Maiella (Mittelschiff) in Neapel.
Mattia Preti, Freskenzyklus - Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus: ein Engel erscheint dem Heiligen, 1659, San Pietro
a Maiella (Mittelschiff) in Neapel.
Mattia Preti, Freskenzyklus - Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus: Petrus wird zum Himmel emporgehoben, 1659, San Pietro
a Maiella (Mittelschiff) in Neapel.
Mattia Preti, Freskenzyklus - Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus: Versuchung des Heiligen Petrus, 1659, San Pietro a
Maiella (Mittelschiff) in Neapel.
Langhauskapellen links: 2. Himmelfahrt Mariae von Giac. del Pò (1705). 5. Predigt des hl. Orontius von Francesco de Mura. — Rechts: 2. Die hll. Benedikt und Scholastika von Girol. Cenatiempo (1705). 4. Fresken (Geschichte des hl. Petrus von Majella vom gleichen Künstler); Altarbild (Erscheinung der Madonna vor dem Eremiten) von Massimo Stanzione. 5. Verlöbnis der hl. Katharina, nochmals von Cenatiempo. — Im Querschiff rechts, neben einem hübschen Renaissanceportal, ein ausgezeichneter Kruzifixus
aus der 2. Hälfte des 15. Jh. in freigelegter alter Fassung; interessant die auf die Grundfarbe aufgetragenen Schattentöne, die die Modellierung des Gesichtes nachziehen. — Die letzten Überbleibsel der barocken Innenausstattung kann man in Fanzagos Chorbrüstung und den herrlichen Marmorintarsien des Hochaltars (von Pietro und Bartolomeo Ghetti, 1645) bewundern. In der Hauptchorkapelle ein beachtliches Chorgestühl aus der Mitte des 16. Jh. und Fresken (Szenen aus der Geschichte des Coelestinerordens) von Onofrio di Lione. — Zwischen der 1. und 2. Nebenchorkapelle links ein stark übermaltes Madonnenfresko des Quattrocento. Die rechts anschließende Kapelle hat einen sehr schönen Majolikafußboden des 15. Jh. In der 1. Nebenchorkapelle rechts Fresken von Onofrio di Lione (1643) und ein Marmoraltar mit der Statue des hl. Sebastian und einem Beweinungsrelief von Giov. da Nola; die 2. Kapelle (derzeit geschlossen) enthält Freskenfragmente des 14. Jh.
Die ehem. Konventsgebäude (Via S. Pietro a Maiella 35) dienen heute als Sitz des berühmten Conservatorio di Musica, dessen Anfänge ins 16. Jh. zurückreichen und an dem u. a. Scarlatti, Paisiello, Cimarosa, Hasse, Pergolesi, Bellini und Donizetti gelernt oder gelehrt haben; das zugehörige Museum besitzt u. a. eine reichhaltige Sammlung von Musikerbildnissen des 17.-19. Jh., darunter Werke von Vaccaro, Le Brun, Batoni, Raphael Mengs und Angelika Kauffmann.
S. Pietro Martire (an der S-Seite des »Rettifilo«, gegenüber der Universität)
Die Mittel zum Bau der 1294 gegr. Dominikanerkirche stiftete König Karl II. von Anjou‚ der mit ihr dem neu in die Stadt einbezogenen »Borgo moricino« einen religiösen Mittelpunkt geben wollte. Unter Karls Nachfolger Robert, der mehr den Franziskanern geneigt war, kam der Bau ins Stocken; 1341 war er noch unvollendet, erst 1347 wurde das Hauptportal errichtet. Beim Erdbeben von 1456 stürzte ein Teil des Gebäudes ein; nach provisorischer Reparatur der Schäden, deren Kosten König Ferrante I. übernahm, fand zwischen 1519 und 1550 eine durchgreifende Erneuerung statt. 1604 legte Fra Nuvolo einen neuen Restaurierungsplan vor; danach wurde der Chor erweitert und (1647) eine neue Kuppel aufgesetzt, deren ungewöhnlich steile und spitze Kalotte außen eine weithin leuchtende Majolika-Dekoration erhielt. 1655 wurde der alte Campanile abgebrochen und durch einen Neubau von F. A. Picchiatti ersetzt. Um die Mitte des 18. Jh. erhielt der ganze Bau durch Giuseppe Astarita ein neues Gesicht. Im 2. Weltkrieg durch einen von Fliegerbomben ausgelösten Brand schwer verwüstet (1943), wurde die Kirche 1952-55 eingehend restauriert. Dabei ergab sich, daß die Mauersubstanz nicht, wie erwartet, dem got. Urbau angehört (den man sich wohl als 1schiffigen holz-
gedeckten Saal mit Seitenkapellen nach Art des Langhauses von S. Lorenzo Maggiore vorzustellen hat), sondern dem Umbau des 16. Jh. entstammt, der dem Typus von S. Caterina a Formiello (lateinisches Kreuz mit tonnengewölbten Armen und Vierungskuppel) folgte. Das Wandsystem dieses Baues mit rundbogigen Pfeilerarkaden und Pilasterordnung ist im letzten Langhausjoch freigelegt worden; man vgl. dazu die Pfeilerordnung F. Manlios in S. Giacomo degli Spagnuoli (S. 144). Die sehr gestreckten Proportionen mögen auf den Vorgängerbau zurückweisen.
Die 2geschossige, rokokohaft bewegte Eingangsfassade, ein charakteristisches Werk Astaritas, liegt an einem 1633 freigelegten, im 19. Jh. wieder halb zugebauten Plätzchen. Das rechter Hand vorspringende Gebäude, ehemals Tabakmanufaktur, enthält eine im Cinquecento erbaute doppelgeschossige Pfeilerarkade, wohl ein Rest des alten Dominikanerkonvents. — Der Innenraum, ein langgestreckter Saal mit je 7 Seitenkapellen und hohen Oberfenstern, deren Stichkappen in die gestelzte, im Scheitel abgeflachte Tonne eingreifen, erstrahlt seit der letzten Restaurierung in reinstem Weiß. Der großzügig-saftige Stuckdekor, am reichsten in der Vierungskuppel, wurde nach Entwürfen Astaritas von Giuseppe Scarola ausgeführt (1755, in den Stichkappen moderne Ergänzungen); ein geradezu flamboyanter Zug, der von Ferne an bayrische Rokoko-Kirchen erinnert, liegt in den kurvig ausschweifenden Fensterkonturen.
Ausstattung. Das berühmteste Bild der Kirche, ein dem S. Vincenzo Ferrerio gewidmetes Polyptychon des 15. Jh., befindet sich in der 3. Seitenkapelle links. Isabella di Chiaramonte, die 1. Gemahlin Ferrantes I., war eine besondere Verehrerin dieses großen, 1419 gestorbenen Dominikanermönchs; nachdem sie 1456 bei Papst Calixtus II. seine Heiligsprechung durchgesetzt hatte, ließ sie in S. Pietro Martire eine Kapelle errichten, die sie bis zu ihrem Tode (1465) fast täglich besuchte und in der sie mit ihren Kindern Alfonso und Eleonora beigesetzt wurde. Zweifellos ist auch die Vincenzo-Tafel von Isabella gestiftet worden. Über den Autor des außerordentlich schönen, auf der Höhe der zeitgenössischen flandrischen Malerei (J. v. Eyck, Rogier van der Weyden, Simone Marmion) stehenden Bildes ist nichts bekannt; die neuerdings übliche Zuweisung an Colantonio, den schwer greifbaren neapolitan. Lehrer des Antonello da Messina, kann beim derzeitigen Stand der Forschung nur als Arbeitshypothese gelten. Das Mittelbild (Tafel S. 273) zeigt den Heiligen in Dominikanertracht mit Buch und Lehrgestus vor einer geräumigen Muschelnische ste-
hend, eine Figur von echt italien. Monumentalität, aber flämischer Feinheit der Modellierung. Die Seitentafeln mit den Wundertaten des Heiligen zählen zu den erstaunlichsten Leistungen der Landschafts-und Interieurdarstellung im neapolitan. 15. Jh. (die Verkündigung links und rechts oben barock übermalt). Das Mittelstück der Predella zeigt Isabella mit ihren Kindern vor dem Altar einer got. Kapelle kniend.
Colantonio, Retabel des heiligen Vinzenz Ferrer, 1456/1465, Neapel, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte.
Seitenkapellen links: 2. S. Gennaro von Massimo Stanzione, mit hübscher Ansicht von Neapel. In der 4. und 5. Kapelle Altarbilder von Solimena (Maria mit S. Lucia, Verkündigung und Heimsuchung). 6. Lebensgroßes hölzernes Kruzifix mit Resten der alten farbigen Fassung aus dem Umkreis des Giovanni da Nola, um 1520. — Seitenkapellen rechts: 1. Eine ganz verdorbene Altartafel (Marientod) von 1501; darüber Reste des alten Skulpturenschmucks von Jacopo della Pila (1498); links ein trecenteskes Madonnenrelief, rechts eine Gnadenmadonna (15. Jh.). 5. Marmoraltar von Jacopo della Pila und Triptychon von Mario de Laurita (Madonna di Loreto mit den hll. Vincenzo und Leonardo, 1501). 6. Rosenkranz-Madonna von Giacomo del Po und Dominikanerheilige von Antonio Sarnelli. 7. Matthäus mit dem Engel, Marmorgruppe von Bartolomeo Ordoñez. — Am rechten Querschiffaltar 3 Bilder aus dem Leben des Titelheiligen der Kirche, des veronesischen Dominikanermönchs Petrus, der 1252 bei Mailand ermordet und ein Jahr später heiliggesprochen wurde; das mittlere Bild von Fabrizio Santafede, die seitlichen von Carlo Mercurio (1664). — In der Apsis Fresken und Leinwandbilder von Giacinto Diana; im Gewölbe das Wunder des Dominikus-Bildes von Soriano, 1718, links der Triumph des Thomas von Aquino, rechts die Predigt der hl. Katharina von Siena zu Rom; an der Rückwand der Tod des Petrus Martyr von Seb. Conca.
Cappella Pontano (SS. Maria e Giovanni Evangelista; vor der Fassade von S. Maria Maggiore in der Via dei Tribunali; Inneres sonntags zwischen 10 und 12 Uhr, während des Gottesdienstes, zu sehen)
Zwischen 1490 und 1495 wurde die Kapelle erbaut; der Name des Architekten ist nicht überliefert, doch liegt es nahe, ihn im Kreise des Antikenkenners Francesco di Giorgio Martini und des Frate Giocondo zu suchen, die beide in jenen Jahren im Dienst des späteren Königs Alfons II. standen.
Giovanni Pontano (als Dichter Jovianus Pontanus), * um 1422 in Cerreto bei Perugia, + 1503 in Neapel, war Sekretär und Ratgeber Ferrantes I. und gehört als Schriftsteller wie als Charakter zu den anziehendsten Erscheinungen des italien. Renaissance-Humanismus; in seinen Dichtungen — mythologischen Schauspielen und Eklogen im Stile Vergils und Theokrits — besingt er die Landschaft des Golfes und preist das bald zur Idylle verklärte, bald
burlesk-realistisch geschilderte Dasein ihrer Bewohner. Einem königlichen Privileg von 1469 verdankte Pontano seinen (heute verschwundenen) Wohnpalast bei S. Maria Maggiore; daneben errichtete er die Grabkapelle für sich und seine 1490 verstorbene Gattin Adriana (poetisch Ariadna) Sassone. Hier versammelte sich dann auch die berühmte Dichterakademie, deren Vorsitz Pontano nach dem Tode des Antonio Beccadelli (Panormita) übernommen hatte.
In späteren Jahren diente das kleine Gebäude dann verschiedenen profanen Zwecken; im Innern schlug schließlich ein Schneidermeister seine Werkstatt auf, die Außenwand war an einen Obsthändler vermietet, der seine Fruchtgirlanden an den Pilastern aufhängen durfte. 1757 ordnete König Karl III. eine Restaurierung an, die dem Verfall ein vorläufiges Ende setzte. Heute gehört die Kapelle einer Rosenkranzbruderschaft.
Der Außenbau erscheint nach dem Vorbild heidnischer Grabbauten als ein kompakter Rechteckblock; das Dach mit dem darunterliegenden Tonnengewölbe wird durch eine hohe Attika (im 18. Jh. roh erneuert) dem Blick entzogen; auch auf die Anbringung eines Giebels — der klassischen Würdeform des Sakralbaus — hat der Architekt verzichtet. Als optisches Gegengewicht der Attika fungiert ein stark vorspringender Sockel; die aus regelmäßig verfugtem Quaderwerk gebildeten Wände des Hauptgeschosses werden durch eine ringsumlaufende Pilasterordnung in je 3 bzw. 5 Felder zerlegt (sehr reizvolle Kapitelle mit Pfeifen und Akanthusblättern, darüber Eierstab mit Eckvoluten, leicht verkröpftes Gebälk von ionischem Typus, alles mehr oder weniger genau in Francesco di Giorgios Madonna del Calcinaio in Cortona vorgebildet). Die Haupttür, von 2 feinen marmornen Schmuckleisten gerahmt, liegt in der Mitte der Längswand, eine andere Tür an der östl. Schmalseite; darüber Widmungsinschriften und die Wappen Pontanos (Ponte: Brücke) und seiner Frau. Zu seiten der kleinen Rechteckfenster in den übrigen Wandfeldern sitzen weitere Inschrifttafeln, in denen Pontano — nach dem Vorbild Diomede Carafas, vgl. S. 291 — sich mit politisch-moralischen Maximen an seine Mitbürger wendet.
Das Innere besteht aus 2 Räumen. Unter der Erde, über ein Treppchen zugänglich, liegt eine kleine rechteckige Grabkammer mit Tonnengewölbe und ringsumlaufender Sitzbank. Den Hauptraum, von gleicher Grundform, schmücken wiederum Gedenkinschriften und Verse, in denen Pontanus den Heimgang seiner innig (wenn auch nicht einzig) geliebten Gattin und ihrer früh verstorbenen Kinder Lucia Marzia und Lucio Francesco beklagt.
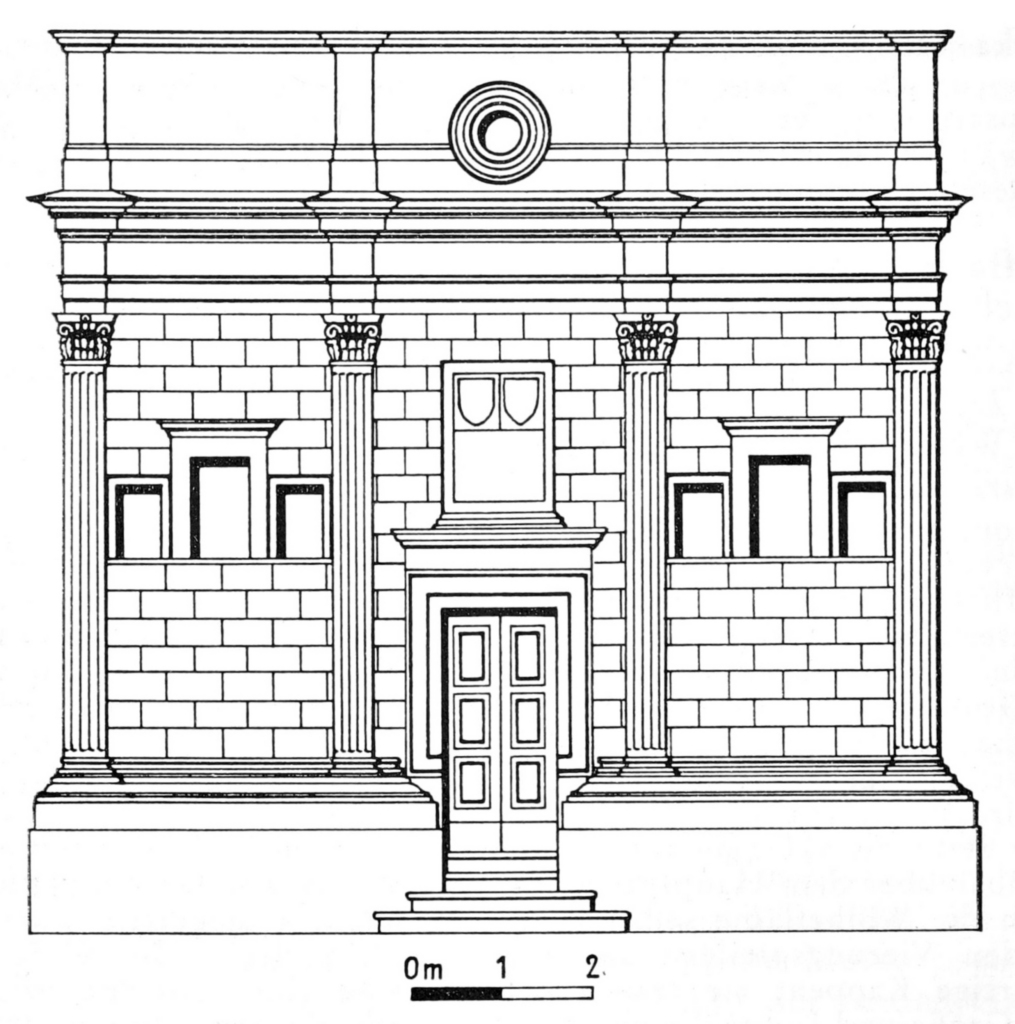 Cappella Fontana. Östl. Schmalseite
Cappella Fontana. Östl. Schmalseite
Einen anderen, bitter-skeptischen Ton schlägt die dialogisierte Grabinschrift auf den langjährigen Freund und »Compater« Pietro Golino an, den Pontanus 2 Jahre vor seinem eigenen Tode in seiner Kapelle bestattete: Das Leben ist Mühsal, Schmerz, Gram, Trauer; man muß hochmütigen Herren dienen, das Joch des Aberglaubens erdulden, die Liebsten begraben, die Zerstörung des Vaterlandes mit ansehen; einziger Vorzug des Junggesellen Pietro: die »uxoriae molestiae« sind ihm erspart geblieben. Auch antike lateinische und griechische Inschriften, die Pontano gesammelt hat, sind in die Wände eingemauert. Der stark beschädigte alte Fußboden hat hübsche Kacheln mit dem Pontano-Wappen und Figuren-und Ornamentmotiven; an der Altarwand ein verblichenes Fresko, Maria mit den beiden Johannes, neuerdings dem Cicino da Caiazzo zugeschrieben.
S. Potito (Via Tommasi, oberhalb der Via Enrico Pessina, zwischen Piazza Dante und Museo Nazionale; Zugang durch das Treppenhaus Via Pessina 31) wurde nach 1615 von Pietro de Marino erbaut und 1783 von G. B. Broggia restauriert. Das Untergeschoß der Fassade öffnet sich zu einer in 2 x 3 Joche unterteilten Pfeilervorhalle (darüber im Innern die Sängertribüne). Innen ein langgestreckter tonnengewölbter Kapellensaal mit Chorjoch und Apsis; die etwas zopfige Dekoration Broggias (korinthische Pflaster, Girlanden und Rahmen, feine Ge-
wölbekassetten) modern aufgefrischt und durch Marmorierung bereichert. — In der 1. Kapelle rechts ein schöner Luca Giordano (Madonna del Rosario); in der 3. Kapelle rechts Immacolata von G. Diana; an den Chorwänden Geschichten des Titelheiligen (er stürzt ein Idol und heilt eine Besessene) von demselben Meister (1784).
Santa Maria e San Giovanni, Capella Pontano, Südfassade, Neapel.
Santa Maria e San Giovanni, Capella Pontano, Ansicht von Südwesten, Neapel.
S. Raffaele (am Abhang von Materdei in der Salita Porteria S. Raffaele, nordwestl. des Nationalmuseums)
Die Kirche wurde zusammen mit einem Heim für gefallene Mädchen 1759 von dem Vaccaro-Schüler Giuseppe Astarita erbaut, im 2. Weltkrieg durch Bomben beschädigt und 1953 verständnisvoll restauriert.
Die ionisch-korinthische Eingangsfassade, im Dekor eher konservativ, erhält durch die eingerundeten Flanken, zwischen denen der Mittelteil etwas zurücktritt, einen freundlich einladenden Zug. Das vergitterte Oberfenster geht auf die über dem Eingang liegende Empore, von der aus die Heiminsassinnen dem Meßopfer beiwohnen konnten. — Der Grundriß des Innenraums folgt dem für Neapel charakteristischen Schema des in die Länge gezogenen griech. Kreuzes (kurze Querarme, längerer Eingangs- und Chorarm), mit leicht erweitertem Mittelraum (durch Abschrägung der Pfeilerkanten). Das Vierungsgewölbe setzt als »Hängekuppel« (ohne Zwickel und Tambourzone) unmittelbar über dem Hauptgesims an, so daß die Tonnen der Kreuzarme tief in die Wölbefläche selbst hineinschneiden. 4 diagonale Gurtbögen, von den Vierungspfeilern aus aufsteigend, zerlegen die Wölbung in segelartige Kappen; sie tragen den Fußring einer Laterne, die dank ihrer Größe und Lichtfülle gleichsam als nachgeholter Tambour fungiert. Pilaster, Rahmen und sparsam verteilte Stuckornamente bilden die einzigen dekorativen Akzente; die alte Ausstattung (Altarbilder von Bonito) scheint verloren.
Cappella Sansevero (Cappella del Sangro, eigentlich S. Maria della Pietà dei Sangro oder auch kurz »La Pietatella« genannt; gegenüber dem Palazzo Sangro in der Via Francesco de Sanctis, zwischen Via Nilo und S. Domenico Maggiore)
1590 hatte Giovanni Francesco di Sangro im Garten seines Palastes ein kleines Marienheiligtum eingerichtet; an der gleichen Stelle erbaute sein Sohn Alessandro 1608-11 die heute bestehende Kapelle als Grablege für sich und seine Familie. Seinen Ruhm verdankt der Bau dem Mäzenat des Raimondo di Sangro, Fürsten von Sansevero (1710-71), eines exzentrischen Sonderlings, der als »Philosoph« und Literat, dilettierender Naturwissenschaftler, Erfinder und Projektemacher zu den charakteristischen Figuren des neapolitan. Settecento zählte. Er berief zunächst den venezianischen Bildhauer Antonio Corradini, nach dessen Tode (1752) den Genuesen Francesco Queirolo und ließ durch sie im Verein mit einheimischen Künstlern das Innere seiner Familienkapelle neu gestalten.
Die Kapelle zählt zu den bekanntesten Denkmälern des neapolitan.
Barock. Der architektonisch sehr einfache tonnengewölbte Rechteckraum mit je 4 Seitenkapellen und quadratischem Presbyterium erhielt eine ungemein splendide Marmordekoration und ein effektvolles Deckenfresko (Heilige in einer Wolkenglorie in Anbetung des Hl. Geistes) von einem sonst nirgends bezeugten Francesco Maria Russo (1749; die komplizierten Architekturperspektiven deuten auf oberitalien. Schulung auch dieses Künstlers hin). Über dem Altar malte Russo eine Scheinkuppel; darunter wurde in einer stuckierten Engelsglorie das Gnadenbild (Madonna della Pietà) des 16. Jh. angebracht. Das große Beweinungsrelief des Hochaltars schuf Francesco Celebrano, die flankierenden Engel stammen von Paolo Persico.
Das Hauptgewicht der neuen Ausstattung lag auf dem Zyklus der Pfeilerfiguren, in denen, in barocker Metamorphose, der Grundgedanke mittelalterl. Fürstengräber wiederkehrt: Aus dem stereotypen Katalog der »Tugenden« ist die sinnbildliche Darstellung bestimmter, kennzeichnender Einzelzüge und moralischer »concetti« hervorgegangen, welche die betreffende Person zugleich verherrlichen und psychologisch charakterisieren sollen. — Die 1. Statue links, dem Corradini zugeschr., zeigt den Anstand (Decoro), personifiziert durch einen jugendlichen Tugendhelden in der Pose des Farnesischen Herkules mit Säule und Löwenfell als Symbolen der Stärke. Das der Säule eingeschriebene Motto preist die durch Schicklichkeit zur Blüte gebrachte Anmut der beiden Gattinnen Giovanni Francescos di Sangro, Isabella Tolfa und Laudomia Milano; das Sockelrelief mit der biblischen Erzählung von Susanna und den beiden Alten wurde später gegen eine Grabinschrift ausgetauscht, vermutl. weil es die Anfechtung, über welche die gefeierte Tugend den Sieg davontrug, allzu sinnfällig illustrierte. — Es folgen (von links nach rechts) die Freigebigkeit (Liberalità — dem Füllhorn entquellen Münzen und Preziosen, die Rechte aber hält 2 Medaillen und einen Zirkel: »Umsicht« und »Maß« müssen verhindern, daß »Großmut« zur »Verschwendungssucht« entartet) von Queirolo, viell. nach einem Bozzetto Corradinis, und der Glaubenseifer, ein strenger und ehrwürdiger Alter mit Lampe und Geißel — die Bücher der Häretiker, in denen die Schlangen der Irrlehren nisten, werden zu Boden getreten und verbrannt — von Queirolo oder Celebrano. — Das nächste Bildwerk, eine Frauengestalt mit 2 brennenden Herzen und einem aus Federn gebildeten Joch, geleitet von einem Putto mit einem Pelikan (dem Sinnbild der Elternliebe), stellt die »Leichtigkeit und Süße« (Soavità) des Ehelichen Joches dar; sign. und dat. von Paolo Persico 1768. — Am Ende der Reihe Corradinis berühmte Schamhaftigkeit (Pudicizia, 1751), nach dem Vorbild antiker Vestalinnen von Kopf bis Fuß in ein durchsichtiges Gewand gehüllt (die Darstellung muß zu den Sinnen sprechen, damit der volle Wert der Tugend dem Beschauer erfahrbar werde); als biblische Parallelfigur, Verkörperung unantastbarer Keuschheit, erscheint im Sockel Chri-
stus vor Maria Magdalena (Noli me tangere). — Das Pendant auf der rechten Seite, von Francesco Queirolo, ist von den Zeitgenossen als Nonplusultra virtuoser Marmortechnik grenzenlos bewundert worden; dargestellt ist die But-Täuschung (Disinganno), d. h. die Befreiung des Menschen aus den Netzen des Irrtums durch die Vernunft (L’umano intelletto); die falschen Bücher sind geschlossen, die Bibel geöffnet; das Sockelrelief zeigt, wie Christus den Blinden sehend macht. — Mit der Statue am nächsten Pfeiler rechts, der Aufrichtigkeit (Sincerità), hat Raimondo di Sangro seiner Frau Carlotta Gaetani ein bewegendes Denkmal gesetzt (von Queirolo); sie weist mit der Linken ihr Herz vor, in der Rechten hält sie den streitschlichtenden Stab des Merkur; friedfertig-zärtliche Täubchen umflattern den begleitenden Putto. — Es folgen die Selbstbeherrschung, ein bewaffneter Krieger, der einen Löwen an der Kette hält, von Celebrano, und die Erziehung von Queirolo. — Die Jünglingsfigur in der Ecknische schließlich, die ein brennendes Herz in die Höhe hält, ist eine Verkörperung der mystischen Gottes-Liebe (Amor divino), von unklarer Zuschreibung.
Für ein weiteres Hauptstück der neuen Kapellenausstattung, den Toten Christus, hatte Corradini ein Terrakottamodell hinterlassen (heute im Museum von S. Martino); die Ausführung aus Marmor begründete den Ruhm des damals 33jährigen Giuseppe Sammartino, der keine Bedenken trug, das Werk als Ganzes für sich zu reklamieren (sign. und dat. 1753). V. a. erregte seine Kunstfertigkeit in der Wiedergabe des durchscheinenden Leichentuches allgemeines Staunen; der glückliche Auftraggeber wußte nach Paris zu melden, er habe einen jungen Neapolitaner entdeckt, »qui promet de rendre son nome célébre dans l’art de la Sculpture«. Erst im 19. Jh. wurde das Werk an seinen jetzigen Platz im Schiff der Kirche verbracht; der urspr. Aufstellungsort war die Krypta hinter der 3. Seitenkapelle rechts (s. u.), deren Dämmerdunkel nur vom Schein einer von Raimondo erfundenen Ewigen Lampe erhellt werden sollte.
Von der Ausstattung des 17. Jh. wurden die Grabmäler in der 1. Seitenkapelle rechts, in der 1. Kapelle links (wahrscheinl. von Mencaglia), in der 2. Kapelle links und im Chor links übernommen; an neuen Grabmonumenten kamen dasjenige in der 2. Kapelle rechts (von Antonio Corradini) und die 3 an der Eingangswand (von Francesco Celebrano) hinzu. — Die letzten Kapellen auf jeder Seite erhielten Heiligenstatuen (S. Rosalia und S. Oderisio) von Francesco Queirolo; derselbe Meister schuf die Bildnismedaillons der 6 Kardinäle aus der Familie Sangro über den Scheiteln der Kapellenbögen. Oberhalb der zugemauerten linken Seitentür ein auf Kupfer gemaltes Bildnis von Carlo Amalfi, darstellend Raimondos Sohn Ferdinando di Sangro.
Die 3. Kapelle rechts öffnet sich zu einem Nebenraum, in dem das Grab Raimondos seinen Platz gefunden hat. Es wurde lt. einer rechts unten angebrachten Inschrift von Francesco Maria Russo
entworfen, der sich hier »pictor neapolitanus« nennt. Auf Statuenschmuck ist verzichtet; vom Ruhm des Kriegsmannes wie des Gelehrten künden nur die Trophäensammlung des Rahmens und eine große Inschrifttafel; über ihr das leider ganz verdorbene Bildnis des Verstorbenen von Carlo Amalfi. — Zur Rechten des Grabmals führt eine Treppe in eine von Raimondo angelegte, aber nicht zu Ende geführte Krypta hinab, die urspr. zur Aufnahme des »Cristo morto« von Sammartino bestimmt war (s. o.).
Giulio Mencaglia, Grabmal des Paolo Sangro - Statue des Paolo Sangro, 1750, Cappella Sansevero und Santa Maria della Pietà
dei Sangro und Pietatella (erste linke Seitenkapelle) in Neapel.
S. Sebastiano (am unteren Ende der gleichnamigen Straße, östl. vom Gesù Nuovo), ein Hauptwerk des neapolitan. Frühbarock, ist seit einigen Jahren spurlos verschwunden. Die Kirche, deren Gründung von der Überlieferung auf Konstantin (1. Gr. zurückgeführt wurde, gehörte im 5. Jh. einem Basilianerkonvent, der im 12. Jh. die Benediktinerregel annahm; 1426 gingen Kirche und Kloster in den Besitz der Dominikanerinnen über, zu Anfang des 17. Jh. wurde die Kirche von Fra Nuvolo (G. Donzelli) von Grund auf neu errichtet, und zwar als Längsovalbau von gewaltiger Höhenentwicklung mit je 3 Seitenkapellen, 2geschossiger Eingangshalle und tiefem Chor. Nach Aufhebung des Klosters diente die profanierte Kirche 1820 als Sitz des neapolitan. Parlaments; seither verlassen, stürzte der Bau 1939 ein; die Reste wurden kürzlich beseitigt, um einem geplanten Straßendurchbruch Platz zu machen.
SS. Severino e Sossio (Via B. Capasso, zwischen Universität und Via del Duomo, gegenüber von SS. Marcellino e Festo) Neapels vornehmste Benediktinerkirche ist v. a. wegen ihrer reichen plastischen Ausstattung aus dem 16. Jh. berühmt.
Ein seit 845 nachweisbares, auf der Anhöhe von Monterone gelegenes Oratorium bot den Mönchen, deren älteste Niederlassung in der Gegend des Castel dell’Ovo den Überfüllen von See her schutzlos preisgegeben war, den erwünschten Zufluchtsort. 902 wurden die Reliquien des hl. Severinus, des Apostels von Noricum (zwischen Wien und Passau), die seit dem Ende des 5. Jh. im »Castrum Lucullanum« geruht hatten, hierher überführt; 2 Jahre später kamen die des hl. Sosius dazu, der als Diakon von Pozzuoli 305 enthauptet (S. 446) und dann im 855 zerstörten Kastell von Misenum verehrt worden war. Die Geschichte der mittelalterl. Anlage läßt sich nicht mehr verfolgen. Der heutige Bau wurde 1490 begonnen und, nach längerer Unterbrechung, 1537 ff. von Giov. Francesco di Palma (»il Mormando«) fortgeführt; gleichzeitig wurde die daneben weiterbestehende alte Kirche einer gründlichen Umgestaltung unterzogen. Die Kuppel des Neubaus (1561) ist ein Werk: des Sigismondo di Giovanni. 1571 konnte die Kirche eingeweiht werden. Das Erdbeben von 1731 verursachte schwere Schäden, die eine durchgreifende Wiederherstellung durch Giov. del Gaizo erforderlich machten.
Der Außenbau zeigt an der linken Flanke (Vico S. Severino) noch die (barock restaur.) Gliederung des 16. Jh., eine korinthische Pilasterordnung auf hohem Sockel (vgl.
S. Caterina a Formiello), in den Wandfeldern abwechselnd Halbrund- und Rechtecknischen, darüber Rundfenster. Der urspr. 2geschossigen Eingangsfassade hat Gaizo eine kolossale Barockordnung vorgeblendet; das Portalgitter stammt von G. B. Nauclerio (1738). — Das Innere, ein tonnengewölbter Saalraum von bedeutenden Ausmaßen, mit je 7 Seitenkapellen, Kuppelvierung und langgestrecktem Rechteckchor, gehört in seiner heutigen architektonischen Erscheinung vorwiegend dem 18. Jh. an; nur in der rechts neben der Sakristei gelegenen alten Kirche (jetzt Cappella dei SS. Severino e Sossio, s. u.) haben sich die Formen der Renaissance einigermaßen erhalten.
Ausstattung. Die Fresken des Langhauses — an der Eingangswand SS. Severino e Sossio, Christus und Maria Magdalena, zwischen den Fenstern der Längswände die Päpste des Benediktinerordens, im Gewölbe die Geschichte des hl. Benedikt — bilden ein Hauptwerk des fruchtbaren Solimena-Schülers Francesco de Mura (1740); koloristisch zählen sie zu den schönsten Leistungen der neapolitan. Settecento-Malerei. Eine Skala klarer, milder Pastelltöne gibt die Grundstimmung an; das gewitterige Chiaroscuro Solimenas wird durch graugrünliche Halbschatten aufgelockert. Doch bleibt die Lichtführung immer noch auf Kontraste bedacht, wirkt stets körperhaft-modellierend: Zur raumlosen Hell-in-Hell-Malerei eines Tiepolo (wie der späte Giordano sie schon einmal anvisiert hatte) ist kein Neapolitaner mehr vorgedrungen. — Die Kuppelfresken stammen von dem Niederländer Paolo Scheffer (Paulus Schephen, 1566, übermalt 1746 und 1851), die der Querarme von Corenzio (1609).
Seitenkapellen links: 1. Geburt Christi von Marco Pino. — 2. Schönes Polyptychon (Madonna, Kreuzigung und Heilige) von Andrea da Salerno. — 3. Grablegung von Giovanni Bern. Lama. — 4. Madonna mit Engeln von D. Tramontano; Einzug Christi in Jerusalem von Agostino Ciampelli (um 1635). — 5. Immacolata von Antonio Stabile (1582). — 6. Madonna mit Heiligen von Gius. Marulli (1633). — Seitenkapellen rechts: 1. Geburt Mariae von Marco Pino. — 2. Der hübsche marmorne Wandaltar mit den Reliefs der Madonna, Gottvaters, des toten Christus und den beiden Johannes als Nischenstatuen ist wahrscheinlich, wie das Grabmal zur Linken (1546), von Giov. Antonio Tenerello. — 3. Assunta von Marco Pino (1571), Fresken von Corenzio. — 4. Nochmals Corenzio-Fresken; das aus 6 Goldgrundtafeln zusammengesetzte Altarbild (Madonna, hl. Severinus auf dem Bischofsthron und weitere Heilige) stammt von einem katalanisch beeinflußten neapolitan. Meister vom Ende des 15. Jh. — 6. Epiphanie von Marco Pino.
An den Vierungspfeilern Grabmäler der Familie Mormile (Anfang
17. Jh.). Im Querschiff links folgt eine Kreuzigung von Marco Pino (1577). Die anschließende Stirnwand wird von dem Grabmonument des Admirals Vincenzo Carafa (1611) eingenommen (von Michelangelo Naccherino): Der Verstorbene kniet in andächtiger Haltung, den Blick zum Hochaltar gewandt, in einer Nische mit schwerem dorischem Ädikula-Rahmen; seitlich Flachreliefs mit den Taten des Seehelden. Rechts und links davon Nischenfiguren (»Hoffnung« und »Glaube«) von Antonio del Medico. — Am rechten Querschiffaltar noch eine dem Marco Pino zugeschriebene Kreuzigungsdarstellung und ein Abendmahl aus dem Umkreis des Giovanni da Nola (1530-35); rechts davon eine Beweinung von einem unbekannten Neapolitaner des 16. Jh.
Der Hochaltar und seine Balustrade, mit überaus feinen Marmorintarsien, stammen von Cosimo Fanzago (der Altar 1783 restauriert).
Die Chorapsis hat ein fabelhaft reich geschnitztes doppelreihiges Gestühl von Benvenuto Tortelli aus Brescia (1560-73) und Bartolomeo Chiarini aus Rom, das sehenswerteste seiner Art in Neapel. Darüber Fresken von Corenzio, mit Themen aus dem Alten Testament und aus der Geschichte des Benediktinerordens; das Mittelbild des Gewölbes (Glorie des hl. Benedikt) stammt von Paolo Melchiorri; an der Stirnwand eine gewaltige Orgel von Seb. Solcito und Giov. Dom. di Martino.
Die linke Nebenchorkapelle (Cappella Gesualdi) enthält einen großen und prächtigen Marmoraltar (Pietà, Kreuzigung, hll. Blasius und Antonius von Padua) von Giovanni Domenico d’Auria. — Die rechte Nebenchorkapelle (Cappella Sanseverino), ein quadratischer Kuppelbau von hohen, steilen Verhältnissen, ist dem Andenken der 3 jungen Grafen von Sanseverino gewidmet, die i. J. 1516 auf einem Jagdausflug von ihrem Onkel Girolamo, der sich in den Besitz ihrer Güter setzen wollte, vergiftet wurden. Die Mutter Ippolita de’ Monti, die ihnen erst 30 Jahre später in den Tod folgte, hat unter der einfachen Grabplatte hinter dem spätbarocken Altar ihre Ruhestätte gefunden. Sie gab den Auftrag zur Errichtung der Kapelle, die 1539-45 von Giovanni da Nola und seinen Gehilfen (darunter Tenerello, Caccavello, Giov. Dom. d’Auria) ausgeführt wurde. Die 3 hohen Wandgräber sind in strengster Symmetrie aufeinander bezogen; die Inschriften der Sarkophage berichten mit fast gleichlautenden Worten das Schicksal der Ermordeten. »Wie es ihrem Rang entspricht«, schreibt Leo Bruhns, »sitzen die drei adligen Jünglinge gepanzert in steiler Höhe; aber mitten im Studienalter ist ihre Kraft gebrochen, das Buch entsinkt ihrer Linken, im jähen Schmerz greift die Rechte nach der Seite oder Brust, die ganze Gestalt knickt in sich zusammen — eodem fato, eadem hora, das gleiche Bild wiederholt sich dreimal«. Todesgenien und weibliche Heilige flankieren die Figuren; darüber erscheinen, zwischen weiteren Heiligenstatuen, der auferstandene und der verklärte Heiland und die Madonna.
Durch die 7. Seitenkapelle des Langhauses rechts gelangt man in den Vorraum der Sakristei. Zur Linken öffnet sich die Cappella Medici, mit Grabstätten des neapolitan. Zweiges dieser Familie; rechts das Grab des Camillo Medici von Girolamo d’Auria (1600), am Altar eine Madonna mit Heiligen von Fabrizio Santafede (1593). An der anderen Seite des Vorraums 2 schöne Grabmonumente aus der 1. Hälfte des 16. Jh. mit Grabinschriften von Sannazaro. Das linke ist ein vorzügliches Werk des Bart. Ordoñez; Roberto Bonifacio und seine Gattin Lucrezia Cicara haben es 1530 zum Andenken an ihren im Alter von 6 Jahren verstorbenen »filio dulcissimo« Andrea. gestiftet. Die Marmorfigur des Knaben liegt in friedlichem Todesschlaf in einem auf Löwenfüßen stehenden, girlandengeschmückten Kindersarg, dessen Deckel von weinenden Putten offengehalten wird; der Unterbau, mit überaus schöner schwellender Ornamentik, enthält vor einer Flachnische die kräftig bewegte Gestalt des hl. Andreas; das wohl von Donatello inspirierte großartige Sockelrelief zeigt Aufbahrung und Totenklage. Rechts gegenüber das Grab Giov. Battista Cicara (+ 1504) von Giovanni da Nola. — Die Sakristei hat nochmals feine Schnitzereien vom Ende des 16. Jh. (Türen mit den 4 Evangelisten, ringsumlaufendes Schrankwerk); an der Rückwand eine Hl. Dreifaltigkeit von Corenzio; die pompösen Gewölbefresken sind von Onofrio di Lione (1651); in einem Schrank links ein Holzkruzifix, das Pius V. vor der Schlacht von Lepanto dem Don Juan d’Austria zum Geschenk gemacht hatte.
Durch eine Tür in der rechten Seitenkapelle des Vorraums der Sakristei zwischen dem Bonifacio- und dem Cicara-Grab (vom Sakristan öffnen lassen) erreicht man über eine Treppe einen tiefergelegenen Korridor, der in die leider entsetzlich verwahrloste Cappella dei SS. Severino e Sossio führt. Es handelt sich um die in got. Zeit entstandene alte Kirche, die in der 1. Hälfte des 16. Jh. umgebaut und im 17. Jh. restauriert wurde. Der Architekt des Cinquecento — wahrscheinl. Giov. Fr. di Palma — hat die je 5 Seitenkapellen des einfachen Rechtecksaals rundbogig gerahmt und durch dazwischengelegte korinthische Pilasterpaare auf Piedestalen zu einer fortlaufenden Pfeilerarkade zusammengefaßt, eine Lösung, die von ferne an das Untergeschoß der S. Maria delle Grazie a Caponapoli erinnert. Das wohl barock erneuerte Tonnengewölbe, von großen Fensterstichkappen zerschnitten, ruht auf Konsolen unmittelbar über dem Gebälk der Erdgeschoßordnung. Ein hölzernes Kruzifix aus der 1. Hälfte des 14. Jh., das von den Guiden hier genannt wird, soll sich in Restaurierung befinden.
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Monte della Misericordia. M. Caravaggio: Die sieben Werke der Barmherzigkeit
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
S. Pietro Martire. Colantonio(?): S. Vincenzo Ferrerio
In den Konventsgebäuden ist seit 1845 das neapolitan. Staatsarchiv untergebracht. Durch den Eingang im Vico S. Severino 44 erreicht man zunächst den großen Kreuzgang (Chiostro grande), einen feinen toskanischen Säulenhof von 7 x 7 Arkaden, erb. 1598 und restaur. 1783; zugänglich sind ferner die Klosterapotheke und das Refektorium, mit Fresken von Corenzio. — Der angrenzende Chiostro del Platano (Mitte 15. Jh.) führt seinen Namen nach einer riesigen orientalischen Platane, die St. Benedikt selber gepflanzt haben soll; ihr Alter wird heute auf etwa 1000 Jahre geschätzt.
Unter den Arkaden der N- und O-Seite befindet sich der berühmte Freskenzyklus des Antonio Solario (»lo Zingaro«) mit Szenen aus dem Leben des hl. Benedikt. Um 1500 entstanden, wurden die der Witterung ausgesetzten Bilder im 16.‚ 18. und 19. Jh. vielfach übermalt und ausgebessert, bilden aber immer noch das bedeutendste Denkmal der Renaissancemalerei in Neapel. Im Stil prägt sich deutlich die venezianische Herkunft des Künstlers aus (Carpaccio, Bellini); die Behandlung der Landschaftshintergründe läßt außerdem umbrischen Einfluß erkennen (Perugino, Pinturicchio).
Die Erzählung (nach der Benedikts-Vita in den Dialogen Gregors d. Gr.) beginnt an der N-Wand links: 1. Der jugendliche Heilige zieht in Begleitung seines Vaters und seiner Amme von Norcia (Nursia) nach Rom, das im Hintergrund rechts erscheint; das Ganze in Chiaroscuro-Technik mit weiß schraffierten Lichthöhungen und grünlichen Schatten. — Die folgenden Bilder sind farbig: 2. Auf der Suche nach Einsamkeit gelangt er nach Alfidena (Effide); das Stadttor im Zentrum gibt nach neuesten Vermutungen die 1494/95 von B. da Maiano für Alfons II. erbaute »Porta Reale« in der westl. Stadtmauer von Neapel wieder; im Hintergrund abermals eine Rom-Vedute. — 3. Das erste Wunder: Benedikt stellt ein zerbrochenes Sieb wieder her; die zusammengelaufenen Gläubigen befestigen es an der Kirchentür. — 4. Der hl. Romanus übergibt ihm in der Waldeinsamkeit von Subiaco das Mönchsgewand. — 5. Leben der Einsiedler unter den Tieren des Waldes; der Teufel zerstört das Seil, durch das Romanus seinen Genossen mit Nahrung versorgt. — 6. Ein Kleriker bringt ihm auf Geheiß eines Engels sein Ostermahl in die Höhle. — 7. Er wird durch den Teufel in Gestalt einer Amsel versucht, entkleidet sich und wirft sich in die Dornen. — 8. Ein von übelwollenden Mönchen gereichter Becher mit vergiftetem Wein zerspringt vor den Kreuzeszeichen. — 9. Placidus und Maurus, Benedikts künftige Mitbrüder, werden von ihren Vätern dem Heiligen zugeführt. — Der Anteil der Werkstattgehilfen, der schon seit dem 4. Bild bemerklich war, tritt von nun an stark hervor. 10. Teufelsaustreibung, darüber in der Lünette die Madonna mit den hll. Severinus und Sosius. — Weiter auf der
O-Wand: 11. Benedikt schlägt Wasser aus dem Felsen. — 12. Er schafft einem Bauern die ins Wasser gefallene Sichel zurück. — 13. Errettung des ertrinkenden Placidus durch Maurus, der auf Benedikts Geheiß über das Wasser wandelt. — 14. Ein neuer Mordanschlag wird durchschaut und vereitelt: Benedikts Rabe fliegt mit dem vergifteten Brot davon. — 15. Zerstörung des Apollon-Tempels und Bau der Kirche von Montecassino; der Heilige bekehrt die Heiden. — 16. Er vertreibt den Teufel von einem Stein, der zum Bau des Klosters dienen soll. — 17. Ein Schüler hat, vom Teufel verführt, das Fasten gebrochen und wird von Benedikt ermahnt. — 18. Wieder von hoher Qualität (soweit noch erkennbar): Benedikt erweckt einen Mönch zum Leben, den die einstürzende Mauer der Kirche (im Hintergrund) erschlagen hat. — 19. und 20. (letzteres auf der S-Wand) sind so gut wie verloren; dargestellt waren Szenen aus der Begegnung Benedikts mit dem Gotenkönig Totila.
S. Severo al Pendino (Via del Duomo, gegenüber von S. Giorgio Maggiore, neben dem Palazzo Cuomo), das vermutl. früheste selbständige Werk des Architekten Giov. Giac. Conforto (Anfang 17. Jh.). 1schiffiger Bau mit Tonnengewölbe und Vierungskuppel; im Innern (wegen Kriegsschäden verschlossen) Teile des großen Grabmals des Alfonso Bisballo, Generals Karls V. und Philipps II., von Girolamo d’Auria (1619).
S. Severo alla Sanità (oder ai Pirozzoli; Piazza S. Severo nordöstl. der S. Maria della Sanitär) führt ihren Namen nach der ersten Grabstätte des hl. Bischof Severus (ca. 362-408) in der angrenzenden Katakombe (vgl. S. 147). Die Kirche wurde 1573 von den Franziskanern gegründet und 1687 durch Dionisio Lazzari neu gebaut. Ein hübsches Detail des 1schiffigen Innenraums bilden die den kuppeltragenden Vierungspfeilern vorgelegten Säulenpaare (vgl. dazu auch Lazzaris S. Maria dell’Aiuto). — Am Altar ein Tafelbild (Madonna mit Heiligen) des 16. Jh. — Die derzeit unzugängliche Katakombe enthält Gräber und. Malereien vom Anfang des 5. Jh.
Spirito Santo (Via Roma, zwischen Piazza Carità und Piazza Dante)
1758-75 an Stelle eines nicht fertig gewordenen Vorgängerbaus aus der 2. Hälfte des 16. Jh. errichtet. Entwerfender Architekt war Mario Gioffredo (1718-85), der letzte große neapol. Barockbaumeister, Schüler Solimenas, Medranos und Buonocores und glückloser Rivale so überragender Talente wie Ferdinando Fuga und Luigi Vanvitelli. Als praktischer Architekt nur ungenügend beschäftigt, ließ er 1768 den 1. Band eines großangelegten Regelbuches erscheinen, in dem die neoklassizist. Tendenzen der Epoche einen ersten theoretischen Niederschlag fanden.
Die Spirito-Santo-Kirche darf schon ihren äußeren Ausmaßen nach als architektonisches Hauptwerk Gioffredos gelten. Höhepunkt des Außenbaus ist die Kuppel, bei deren Entwurf Pietro da Cortonas röm. Kuppelbauten —
v. a. S. Carlo al Corso — Pate gestanden haben (gut zu sehen vom Ende der Via dei Banchi, die rechts an der Kirche entlangführt). Die Fassade wurde erst 1929 hinzugefügt; das Eingangsportal gehört noch dem 16. Jh. an. — Das frisch verputzte Innere — ein gewaltiger tonnengewölbter Saal mit Seitenkapellen, Kuppelvierung und querrechteckigem Chorraum hinter der Apsis — wirkt im ersten Eindruck eigentümlich kahl und leer; das Gliederwerk der Wände, an sich von höchst energischer, ja kolossaler Bildung, scheint gleichwohl nicht imstande, den Riesenraum organisch zu beleben. Die
architektonischen Hauptmotive entstammen Vanvitellis etwa gleichzeitig entstandener Annunziata-Kirche, und man wundert sich nicht, aus den Bauakten zu erfahren, daß Vanvitelli selbst Gioffredos Entwurf begutachtet und gebilligt hat.
Allein die große Säulenstellung mit dem durchlaufenden Gebälk, bei Vanvitelli mit unendlichem Feingefühl zu Raum und Wand in Beziehung gebracht, hat hier etwas künstlich Aufgesetztes; zumal das offenbare Mißverhältnis zwischen Ordnung und Kapellenöffnungen (deren Abmessungen viell. durch den Vorgängerbau festgelegt waren) läßt das Wandsystem in seine Bestandteile auseinanderfallen. Ähnlich ungelöst erscheint der Gegensatz zwischen der engen, kurzatmigen Jochfolge des Schiffes und der licht und weiträumig angelegten Vierungszone — wird doch der Gelenkpunkt des Raumes, der Kuppelpfeiler, nur ganz unentschieden markiert, das großmächtige Säulengebälk gerade dort, wo die Kräfte sich ballen müßten, in flachen Pilasterverkröpfungen
aufgesplittert. Das Detail zeigt auch hier noch manche Anklänge an den röm. Hochbarock, v. a. an Carlo Rainaldi (S. Maria in Campitelli).
An der Eingangswand und in der 4. Kapelle links Grabmäler von Michelangelo Naccherino. — 1. Kapelle links: Geschichte des hl. Paulus von Fedele Fischetti. — In der 4. Kapelle links eine Madonna del Soccorso von Fabrizio Santafede. — Querschiffaltäre: links Assunta von Francesco Celebrano, rechts Madonna mit Heiligen, wiederum von Fischetti (1773). — In der Apsis ein großes Pfingstbild von Francesco de Mura.
Zur Linken der Kirche (Via Roma 402) das Conservatorio dello Spirito Santo, 1563 als Mädchenheim gegr.; der hübsche Innenhof gewährt noch einen Blick auf Gioffredos Kuppel.
S. Teresa a Chiaia (Via dei Mille, Parallelstraße zur Riviera di Chiaia)
Die Kirche wurde 1650-62 von Cos. Fanzago erbaut, später mehrfach verändert und restauriert. Aus dem 18. Jh. stammt die 3geschossige Eingangsfassade, über und über mit Obelisken, Kartuschen, Fruchtgehängen und einem ganzen Figurenprogramm in Nischen und Medaillons geschmückt — ein Aufwand, angesichts dessen das melancholische Motto »Aut mori aut pati« sonderbar deplaziert wirkt. Dahinter steckt eine höchst individuelle Hochbarockarchitektur, Kreuzkuppelbau mit 2geschossigen Nebenräumen (Kapellen und Coretti) in den Pfeilerecken, von reicher Raumwirkung (im Settecento weitergebildet: Chiesa della Concezione, SS. Giovanni e Teresa — vgl. auch S. Maria ai Monti), aber rechtwinklig-streng in der Körperbehandlung.
Am Hochaltar eine hl. Theresa, ebenfalls von Fanzago, von einem szenographischen Säulenapparat umgeben. Über dem Eingang und an den Seitenaltären Bilder von Luca Giordano: die Titelheilige beim hl. Petrus von Alcantara beichtend, Maria mit ihren Eltern Anna und Joachim und die zartfarbige Nachtszene der Geburt Christi in atmosphärisch belebter Landschaft.
S. Teresa degli Scalzi (S. Teresa agli Studi, auch La Madre di Dio; Via S. Teresa, oberhalb des Museo Nazionale)
Ein spanischer Karmeliterpater, Fra Pietro della Madre di Dia, hatte i. J. 1602 mit so viel Erfolg in Neapel gepredigt, daß die ihm zufließenden Kollekten ihm den Erwerb des Palastes der Herzöge von Nocera ermöglichten, wo er alsbald einen Karmeliterkonvent errichtete. Als Architekt der wenig später erbauten Kirche wird G. G. Conforto genannt.
Der untere Teil der großen Rampentreppe vor der konventionellen Zwei-Ordnungs-Fassade entstand 1835, nachdem die Anlage einer Fahrverbindung nach Capodimonte eine beträchtliche Tieferlegung des alten Straßenniveaus mit sich gebracht hatte. — Das Innere ist ein geräumiger 1schiffiger Kreuzbau vom »Gesù-Typ«, mit Tonnengewölbe, Vierungskuppel, Doppelpilastergliederung und jeweils 4 Seitenkapellen. — In der Apsis 2 große Bilder von Paolo de Matteis: Die Madonna vom Berge Karmel gibt dem hl. Simon Stock das Skapulier (Schulterkleid); die hl. Theresa von Avila schreibt ihre Ordensregel. Die linke Nebenchorkapelle (Cappella S. Teresa) zählt in Architektur und Dekoration zu den besten Leistungen Cos. Fanzagos. Die großen Altarbilder im Querschiff (der hl. Johannes vom Kreuz reitet in die Schlacht von Prag; Flucht nach Ägypten) sind von Giacomo del Pò (1708).
S. Tomaso a Capuana (am östl. Ende der Via dei Tribunali) wird als S. Gregorio in Regionario schon im 12. Jh. erwähnt. Der heutige Bau entstammt dem 18. Jh. Die hohe und schmale Rokoko-Fassade mit knorpeligen Stuckdekorationen zeigt Anklänge an den Stil D. A. Vaccaros. — Der Innenraum bildet ein griech. Kreuz mit verlängerten Hauptarmen und flacher Vierungskuppel; am rechten Seitenaltar eine Grablegung Christi von Paolo de Maio.
SS. Trinità delle Monache (am oberen Ende der Via P. Scura, gegenüber von S. Maria dei Sette Dolori)
Die Kirche eines 1608 gegründeten Nonnenklosters, das dank seiner Kunstschätze wie auch seiner herrlichen Lage am Abhang des Vomero zu den größten Sehenswürdigkeiten des barocken Neapel gehört haben muß. Die Insassinnen rekrutierten sich aus den ersten Familien des städtischen Patriziats (nobilità di sedile); ein hochexklusives Erziehungsinstitut für adlige Töchter war dem Kloster angegliedert. Üppig ausgestattete Baulichkeiten und mit Blumen und Fruchtbäumen, Bosketts und Orangenhainen bepflanzte hängende Gärten, Fontänen, Fischteiche und ein künstlicher See für Gondelfahrten lieferten den angemessenen Rahmen für einen in jeder Hinsicht fürstlichen Lebensstil; von dem Empfang, den die Damen für die Schwester des spanischen Königs Philipp IV. gaben, die 1630 Neapel besuchte, wurde in der Stadt noch lange gesprochen.
Die 1621 begonnene Kirche, ein Zentralbau über griech. Kreuz, ging angebl. auf einen Entwurf des 1613 verstorbenen Padre Francesco Grimaldi zurück; nach 1630 führte Cos. Fanzago den Bau zu Ende. I. J. 1806 wurde das Kloster säkularisiert und in ein Militärhospital umgewandelt. Die seitdem völlig verwahrloste Kirche stürzte 1897 ein.
Den einzigen Überrest des Ganzen bilden das polygonale Atrium und die höchst originelle Eingangsfassade mit halbrund einschwingender Freitreppe, beides von Fanzago.
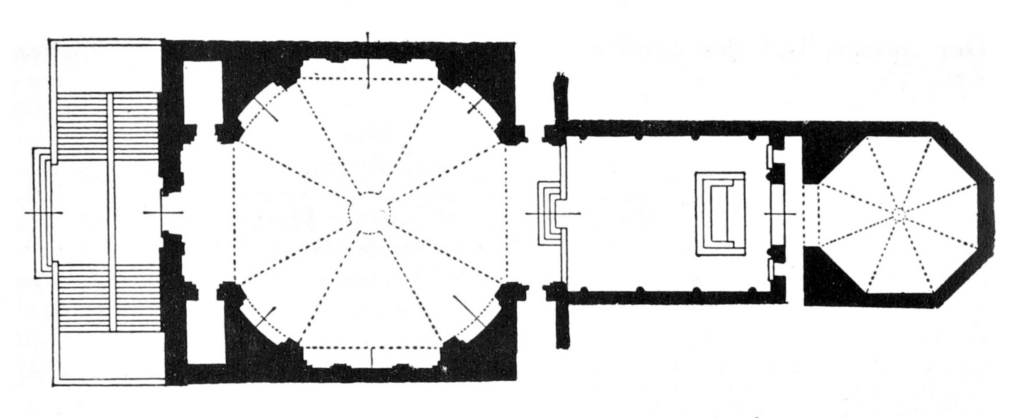 SS. Trinità dei Pellegrini. Grundriß
SS. Trinità dei Pellegrini. Grundriß
SS. Trinità dei Pellegrini (Strada Nuova dei Pellegrini, am Montesanto, oberhalb der Chiesa dello Spirito Santo; Inneres nur vormittags geöffnet)
Der Bau gehörte einer 1550 in Rom gegründeten Bruderschaft, die sich der zum Hl. Jahr herbeiströmenden Pilger annahm und später auch der Armenpflege widmete. 1573 stiftete Fabrizio Pignatelli ihr in Neapel ein großes Pilgerhospiz (vgl. S. Maria Mater Domini), als dessen Hauptkirche unser Bau 1769 neu errichtet wurde. Der erste Entwurf scheint noch auf Luigi Vanvitelli zurückzugehen. Nach einer Bauunterbrechung von 1776-91 führte dessen Sohn Carlo das Werk in leicht veränderter Form zu Ende; eine genauere Abgrenzung der beiden Bauphasen wäre für die Kenntnis der »ultima maniera« des großen Spätbarockarchitekten von höchster Wichtigkeit.
Die Eingangsfassade mit kühl-korrekter korinthischer Pilasterordnung und Giebel erhebt sich über einer großen doppelläufigen Rampentreppe; die Trinità-Gruppe im Tympanon und die Nischenfiguren (SS. Gennaro und Filippo Neri) schuf Angelo Viva. — Das Innere folgt in seiner eigentümlichen Grundrißfigur, deren Dreiteiligkeit viell. auf den Titel der Kirche anspielt, sicherlich noch dem Entwurf Luigis. Als Schiff fungiert ein weit ausladender Rundraum mit 4 breiten, flach abgeschnittenen Kreuzarmen, deren leicht gedrückte Schildbögen das Pilastergebälk unterbrechen und mit Stichkappen in die Kuppel eingreifen. Daran schließt sich als Presbyterium ein tonnengewölbter Rechtecksaal mit 3/4-Säulen-Gliederung; im Zentrum der rückwärtigen Schmalwand befindet sich ein offener, von einem Segmentgiebel überfangener Bogen, durch den man in den achteckigen Chorraum blickt; davor der frei stehende Trinitätsaltar mit reicher Wolkenbildung aus Holz und Stuck,
von einem gewissen Giovanni Conti. Das architektonische Detail zeigt überall den zum Klassizismus tendierenden Geschmack des ausgehenden 18. Jh.
Altarbilder : Im Hauptraum zur Linken des Eingangs ein fürbittender S. Gennaro mit einer wohlgelungenen Ansicht Neapels aus der Vogelschau, von Onofrio Palumbo; rechts vom Eingang der hl. Antonius von Padua, von Giacomo Farelli; an der linken Seitenwand ein großangelegter, brillant gemalter Tod des hl. Joseph von Francesco Fracanzano (1652). Links vom Presbyterium die Kreuzigung Christi mit den 3 Marien und Joseph von Arimathia, ein hervorragendes Werk des Andrea Vaccaro, stark unter dem Einfluß Riberas. Das Presbyterium enthält 4 schöne Kompositionen Giacinto Dianas (1778): links der Teich von Bethesda und S. Filippo Neri unter Kranken und Gefangenen; rechts Fußwaschung Christi und Fußwaschung der Pilger durch Angehörige der Bruderschaft von SS. Trinità. Im Chor die 4 Evangelisten von Paolo de Maio und eine Dreifaltigkeit von Fr. de Mura.
SS. Trinità degli Spagnuoli (S. Maria del Pilar; am oberen Ende der Via Trinità degli Spagnuoli zwischen Toledo und Corso Vittorio Emanuele) wurde gegen Ende des 16. Jh. gegründet und 1794 restauriert. Vorhallenfassade mit 3 Arkaden auf prächtigen antiken Säulen aus schwarzem Marmor. Das Innere, modern renoviert, enthält nichts Bemerkenswertes.
S. Vincenzo dei Paoli (Chiesa dei Padri della Missione oder auch dei Padri Crociferi; Via Vergini)
Mitsamt dem dazugehörigen Konvent wurde die Kirche in den 60er Jahren des 18. Jh. von den Missionaren von S. Vincenzo de’ Paoli erbaut, 1788 vollendet. Die Entwürfe lieferte Vanvitelli, die Ausführung lag in den Händen eines Michelangelo Giustiniani.
Giustiniani allein scheint für die kümmerliche Fassade verantwortlich; dagegen stammen das überaus schöne ovale Eingangsvestibül mit rhythmisch gruppierter Pilasterordnung und großem Oberlicht und die angrenzenden Räumlichkeiten des Konvents ohne Zweifel von der Hand Vanvitellis.
Ein reifes Meisterwerk des großen Architekten ist das Innere der Kirche. Man betritt, nachdem man ein 2. Kuppelvestibül passiert hat, zunächst ein quadratisches Vorjoch mit Flachkuppel und tonnengewölbten Seitenarmen. Der anschließende Hauptraum bringt über längsovalem Grundriß Vanvitellis Version eines in der 1. Hälfte des 18. Jh. kanonisch gewordenen Zentralbautypus (vgl. Turin, Superga; Rom, SS. Celso e Giuliano und SS. Nome di Maria):
8 Kolossalpilaster tragen ein ringsumlaufendes Gebälk, über dem sich die von seitlichen Fenstern und einer großen Laterne durchbrochene Kuppelkalotte erhebt; in den 4 Hauptachsen des Ovals öffnen sich Kreuzarme, in den Diagonalen 2geschossige Nebenräume (Kapellen und Coretti). Ein genial durchdachtes Wandsystem regelt Form und Proportion der Öffnungen nach dem Prinzip der »rhythmischen Travee«; das Kämpfergesims der großen Bögen läuft hinter den Pilastern durch und bildet in den Nebenachsen geschoßteilende Architrave. Der dadurch bewirkte Wechsel von Rechteck- und Rundbogenöffnungen findet sein Widerspiel in der Folge der Kuppelfenster: diejenigen der Nebenabschnitte sind oval, die der Hauptachsen geradlinig konturiert (der leichte Bogenstich der letzteren ist so bemessen, daß für den Blick von unten her die konkave Krümmung der Kuppelschale, die einen horizontal geführten Sturz im Scheitel einsinken lassen würde, in etwa ausgeglichen wird). In der Längsachse schließt sich eine Altarkapelle an, in der Vanvitelli das Kunststück fertiggebracht hat, einen reinen Rundraum mit einer auf 4 Stützpunkten ruhenden Pendentifkuppel (die mit der des Eingangsjoches korrespondiert) zu überspannen. Die Seitenwände setzen sich aus Segmenten zweier konzentrisch ineinanderstehender Zylinder von verschiedenem Radius zusammen: dem inneren gehören die Stirnflächen der 4 Eckpfeiler an, dem äußeren die dazwischenliegenden Seitenwände; diese bilden seichte, von Apsiskalotten geschlossene Nischen, deren Schildbögen die laternenbekrönte Flachkuppel tragen. Im präzisen Ineinandergreifen der Raum-und Körperformen offenbart sich der Stil des großen Rationalisten, der sich auch im dekorativen Beiwerk keine Capricen gestattet hat. Vom Fußbodenmuster über Gesims und Balustraden, Altar- und Fensterrahmungen bis zu den sechseckigen Kassetten der Kuppelschale ist alles streng geometrisch durchkonstruiert, dabei stets mit unfehlbarem Takt aufs Ganze des Raumes bezogen; ein einheitlich weiß-blauer Anstrich vollendet das kühle und klare Bild dieser Architektur.
Im Eingangsjoch finden sich Altargemälde von Antonio Sarnelli (Christus und die Apostel; Bekehrung Pauli), am Hochaltar ein schöner Fr. de Mura (Glorie des hl. Vincenzo de’ Paoli).
Die Privatpaläste werden hier in der Regel mit dem Namen des ersten Bauherrn bzw. Besitzers aufgeführt. Die dabei in beunruhigender Anzahl auftretenden Herzogstitel stammen meist aus der Zeit der österreichischen Herrschaft zu Beginn des 18. Jh. und waren damals ohne weiteres käuflich zu haben (de Brosse überliefert dazu das hübsche Diktum: »Ja, Herzog mag er wohl sein, aber nicht adlig!«). Um die Identifizierung der Bauten zu erleichtern, haben wir uns in jedem Fall um möglichst genaue Adressenangaben bemüht; der Leser möge allerdings bedenken, daß in Neapel auch Straßennamen und Hausnummern einem unablässigen Wandel unterliegen. Zwischen reinen Stadtpalästen und Vorstadtvillen wird kein Unterschied gemacht; auch sind die Grenzen zwischen Einzel- und Mietshaus nicht streng zu ziehen, zumal seit der Mitte des 18. Jh., als die bourbonische Verwaltung die feudalen Renditen einschneidend zu verkürzen begann, viele Adelspaläste in Zinshäuser umgewandelt wurden.
Eine Spezialität des neapolitan. Palastbaus bilden die Treppenhäuser, denen in Italien allenfalls Genua Vergleichbares an die Seite zu stellen hat. Dabei liegt der Akzent hier weniger auf der großen barocken Repräsentationstreppe (wichtige Beispiele dafür bieten die Palazzi Reale, Serra di Cassano, Spinelli di Laurino) als vielmehr auf dem Stiegenhaus des Bürgerpalastes, dessen ästhetische wie funktionelle Durchbildung die neapolitan. Architekten seit dem 15. Jh. beschäftigt hat. Es bildet die ideale Bühne des großen Volkstheaters, das Gassen, Plätze und Häuser des Stadtinnern durchzieht und die Grenzen von Innen- und Außenbau zum Verschwinden bringt. »In allem wahrt man den Spielraum, der es befähigt, Schauplatz neuer unvorhergesehener Konstellationen zu werden«, schreibt Walter Benjamin. »Niemals ganz freigelegt, noch weniger aber in den dumpfen nordischen Hauskasten geschlossen, schießen die Treppen stückweise aus den Häusern heraus, machen eine eckige Wendung und verschwinden um wieder hervorzustürzen.« Zahlreiche anonyme Bauten dieser Art sind den Zer-
störungen des Krieges und der modernen Stadtsanierung zum Opfer gefallen; einige heute noch sichtbare Monumente, deren alte Namen sich nicht mehr ermitteln lassen, seien im folgenden aufgezählt.
In die Zeit der noch katalanisch beeinflußten Anfänge der Entwicklung gehören die in Bögen geöffneten Treppenhäuser Via dei Tribunali 234 (an der Piazzetta Sedil Capuano, Anfang 15. Jh., restaur.) und Via dell’Ecce homo 19 (an der Piazzetta Monticelli in der Nähe des Palazzo Penna, in einem finsteren Höfchen). Von besonderem Reiz ein Palast in der Via S. Arcangelo a Baiano 44 (an der Vicaria Vecchia zwischen 3. Giorgio Maggiore und S. Agostino); Portal und Vestibül katalanisch (Flachbogen, Rundstabprofile, got. Blattkapitelle); das Treppchen im Hof rechts hat Renaissance-Kapitelle und oben eine Doppelloggia, durch die man 2 kleine Pendentifkuppeln über dem Treppenabsatz erblickt.
Reine Renaissanceformen und monumentale Ausmaße zeigen die Paläste Via Sedil Capuano 16, Via dei Tribunali 246 und Via dei Banchi Nuovi 8, die Treppen hier jeweils zum Hof wie auch zur Straße hin offen (vgl. dazu die Palazzi Mormando, Traetta, Beccadelli, Spinelli di Laurino und Carafa di Belvedere sowie, schon aus der Mitte des 16. Jh., Pinelli und Giasso).
Das 17. Jh. hat zur Entwicklung der Treppe wenig beigetragen, dafür aber der Gestaltung der Hofrückwand mit offenen Loggien und Terrassen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Beispiel dafür in der Via Settembrini 26 (hinter SS. Apostoli); die Treppe hier zur Linken des 2geschossigen Vestibüls, von dem aus man durch eine Bogenöffnung den oberen Treppenabsatz erblickt (Überreste ähnlicher Hofloggien in den Palazzi Fondi und Venezia; cinquecenteske Vorformen zeigen der Palazzo Gravina und der genannte Palazzo in der Via dei Bachi Nuovi). In der Nachfolge dieses Typus steht im 18. Jh. das bezaubernde Höfchen Salita Pontecorvo 26; die Terrasse ist dort überfangen von einer 2geschossigen gewölbten Halle mit durchbrochener Rückwand, durch deren vielfach geschweifte, mit Voluten, Vasen und Zierobelisken verstellte Öffnungen man in den dahinterliegenden Garten schaut. Ein Palast in der Via SS. Filippo e Giacomo 14 hat im Hofgrund eine geräumige 3-Bogen-Loggia mit Terrasse, in der sich die Antritte einer
großen Doppeltreppe genuesischen Typs befinden, die dann allerdings ganz unscheinbar fortgesetzt wird (vgl. dazu auch die Kombination von Quertrakt und Freitreppe im Hof des Palazzo Marigliano).
Der entscheidende Einfall des 18. Jh., sicherlich auf Sanfelice zurückgehend, war die Ausbildung der ganzen Hofrückwand als offenes Stiegenhaus. Die großartigsten Beispiele des neuen Motivs bilden der Palazzo dello Spagnuolo und Sanfelices eigener Palast in der Via Arena della Sanitär; andere Treppen Sanfelices oder seiner Nachfolger in den Palazzi Di Maio, De Sinno, Palmarice, Lauriano, Pignatelli-Strongoli, Capuano, Casamassima. An anonymen Bauten dieses Umkreises wären zu nennen: Via S. Giuseppe dei Nudi 25 (bei S. Potito), ein fast intakter Mietspalast des Settecento, vom Typ des Palazzo dello Spagnuolo, mit fabelhaft reichem Stuck, vorzüglich erhalten. Via S. Liberia 1 (Piazza della Carità) von ähnlichem Typus, aber über schmalerem Grundriß, daher mit abweichender Führung der Treppenläufe (2 seitliche Antritte, die schräg ansteigenden Zwischenöffnungen auf ganz enge Intervalle zusammengedrängt); das ganze Haus innen wie außen prächtig dekoriert. Im Nachbarpalast (Piazza della Carità 6) ein konvex vortretendes Stiegenhaus, in dem von einem mittleren Antritt aus 2 kurvig geschwungene Rampen aufwärtssteigen. Eine im Typus vergleichbare, aber noch vertracktere Anlage in Via Nilo 30 (zwischen Via dei Tribunali und S. Biagio dei Librai); im Aufstieg ergibt sich hier eine Fülle überraschender Perspektiven, v. a. dank der von Absatz zu Absatz wechselnden Gewölbeformen. Ein anderer Doppelpalast (vgl. dazu den Palazzo Sanfelice) in Via Salvator Rosa 98-103: links ein kreisrundes Treppenhaus, darin eine offene Spindel aus 4 Pfeilern in Form eines übereck gestellten Quadrates, der Anstieg der Treppe in Abschnitte von je 5 geraden, diagonal geführten Stufen zerlegt; im rechten Hof eine 21äufige Treppe von dreieckiger Grundgestalt. Ein besonderes Kabinettstück, leider gänzlich verwahrlost, bildet das zierliche Stiegenhaus Via Foria 234: Eine offene Pfeilerhalle enthält 2 in die Tiefe gerichtete gegenläufige Rampentreppen, die oben in einen gemeinsamen Mittellauf einmünden; über den viertelkreisförmigen seitlichen Antritten liegen ebensolche Zwischenpodeste, die gleich Theaterlogen in den Hof hinabschauen. Die große, wellenförmig ausgeschnittene Öffnung
der Hofwand gibt hier den Blick auf die ganze Vielfalt der Schrägen und Wölbungen frei.
Bescheiden, aber sehr originell die auf Säulen ruhende luftige Spindeltreppe in Via Costantinopoli 33, mit feinem, zartem Stuck und. hübschen Eisengittern. Erwähnt sei an dieser Stelle noch ein großer, heute ganz verkommener Settecento-Palast in der Via S. Pantaleone 16-18 (zwischen S. Caterina da Siena und S. Anna di Palazzo) mit offener Spindeltreppe im Hof rechts. Den Geschmack der 2. Jahrhunderthälfte zeigt das lichte und weiträumige, streng rechtwinklig angelegte Treppenhaus in Via Foria 242 (gegenüber dem Haupteingang des Botanischen Gartens) von Pompeo Schiantarelli (vgl. dazu auch die Palazzi Cavalcanti, Carafa Cantelmo Stuart und Ottaino). Von den Treppen an der Via Roma nennen wir noch: Nr. 289-92, ein Doppelpalast mit geschweiften Rustika-Portalen, rechts eine große Treppe in breiten Flachbögen zum Hof geöffnet, reizvoll durch den Lichteinfall im Zentrum der offenen Spindel. Nr. 282, ein Treppenhaus durch 6 Geschosse, die seitlichen Läufe diagonal abgewinkelt. Schon ins 19. Jh. gehören die beiden großen Treppen des Palazzo de Rosa und die des Palazzo Tappia.
Hauptsehenswürdigkeiten: Pal. Angri (Vanvitelli), S. 285 — Pal. Carafa di Maddaloni (15. Jh.), S. 291 — Pal. Cellamare (16. Jh. / Fuga), S. 294 — Pal. Cuomo (15. Jh.), Museo Filangieri, S. 297 — Pal. Donn’Anna (Fanzago), S. 301 — Villa Floridiana (Niccolini), Museo Duca di Martina, S. 304 — Pal. Gravina (16. Jh.), S. 306 — Pal. Maddaloni (Fanzago), S. 308 — Pal. Marigliano (Mormando), S. 308 — Pal. Penna (15. Jh.), S. 310 — Villa Pignatelli-Acton (Valente), Museo Pignatelli, S. 311 — Pal. Sanfelice (Sanfelice), S. 313 — Pal. Serra di Cassano (Sanfelice), S. 321 — Pal. dello Spagnuolo (Sanfelice), S. 322.
Palazzo Albertini (Principe di Cimitile, vormals Duca di Atri; Via S. Teresa 76), erb. Ende 18. Jh. von Carlo Vanvitelli. Das vorgezogene Untergeschoß entstand erst bei der Tieferlegung der Straße im 19. Jh.; darüber eine prächtige Zwei-Ordnungs-Fassade, unten Rustika, oben komposite Pilaster, Mittelachse und Ecken durch mehrfache Verdoppelungen und Bündelungen hervorgehoben, auch das Kranzgesims verkröpft. — Der querrechteckige Hof, auf dem alten Niveau, hat eine Strenge Lisenengliederung ohne die übliche Auflockerung durch offene Stiegenhäuser. Im Piano nobile einige Säle mit etwas zopfigen Dekorationen.
Palazzo Angri (im Winkel zwischen Via Roma und Via S. Anna dei Lombardi)
1755 für Marcantonio Doria, Principe d’Angri, errichtet; den Entwurf lieferte Luigi Vanvitelli, die Bauleitung hatte sein Sohn Carlo. Eine historische Rolle hat der Palast in den Tagen der Diktatur Garibaldis (1860) gespielt, der hier sein Hauptquartier aufschlug und vom Balkon aus die Vereinigung des Reiches beider Sizilien mit dem neuen italien. Königreich proklamierte.
Als Eingangsfront dient die Schmalseite, deren exponierte Lage zwischen 2 Arterien der Innenstadt Vanvitelli zu einer seiner besten profanen Fassaden inspiriert hat. Ihr besonderer Reiz liegt in der Darstellung höchster individueller Würde im Rahmen eines intakten Sozialgefüges: Die urbanistische Situation wird beherrscht durch vollkommene Anpassung an ihre Gegebenheiten. Höhe und sonstige Abmessungen, wie auch die geschlossene »Haus«-Form des Blockes, folgen dem konventionellen Typus des Stadtpalastes; allein die für Neapel obligatorische Vielzahl der Stockwerke, Haupthindernis jeder monumentalen Gestaltung, hat Vanvitelli an der Eingangsseite mit energischem Griff auf 2 dorisch-ionische Hauptgeschosse und eine Attika mit statuenbekrönter Dachbalustrade reduziert. Dem entspricht in der Horizontalen eine Aufteilung in 3 Achsen, die eine einzige rhythmische Gruppe bilden: im Mittelfeld unten das rundbogige, von Doppelsäulen flankierte Portal; darüber, als beherrschendes Zentrum des ganzen Systems, ein gleichfalls rundbogiges Balkonfenster, dessen Ädikula-Rahmen mit Segmentgiebel und Wappen in die Attika-Zone hinaufreicht; die seitlichen Achsen sind nur Begleitung, in denen das Hauptmotiv ausklingt. Dieser klare und große Grundgedanke wird in der Durchführung äußerst fein nuanciert, das Pathos der plastischen Glieder durch zarteste Flächenteilung im Sinne der französ. Klassik gedämpft und dekorativ herabgestimmt (keine Kolossalordnung). So entsteht ein ungemein formenreiches, aber auch lückenlos durchkomponiertes Gebilde, in dem jeder Teil seinen festen Stellenwert hat; mit den dabei auftretenden Einzelproblemen — etwa: frei stehende Doppelsäulen bruchlos in eine Flächenordnung zu überführen — ist Vanvitelli auf gewohnt souveräne Weise fertig geworden.
Die Seitenfronten wirken demgegenüber sehr zurückhaltend. Als hauptsächliches Gliederungsmittel dient die
(aus der Eingangsfassade vollständig verbannte) Quader-Rustika; dem traditionellen Motiv des Wechsels zwischen Segment- und Dreiecksgiebel hat Vanvitelli durch alternierende Halbsäulen und Pilaster noch eine neue Note abgewonnen (jeweils runde und kantige Formen einander zugeordnet).
Das Innere bietet eine überraschend reiche Folge axial angeordneter Räumlichkeiten. Durch das Hauptportal gelangt man zunächst in ein relativ enges, aber großartig streng behandeltes Vestibül; von da in einen hexagonalen Lichthof mit Blendbogengliederungen in Putzquaderwerk; ein 2. Vestibül, von gleicher Gestalt wie das 1., gewährt links Zugang zu einer repräsentativen 2läufigen Treppe, die sich in einer Pfeiler-Bogen-Stellung gegen den quadratischen Haupthof öffnet, wiederum mit Rustika-Blenden nach Art der Höfe von Caserta gegliedert. Ein 3. Vestibül verbindet den Hof mit einem Portal an der Rückfront des Gebäudes.
Palazzi Aquino di Caramanico und Giordano (Ruffo, Caracciolo di Forino; Via Medina 61 und 63)
2 vorzügliche späte Fassaden Fugas, durch flache Lisenen in hohe und schmale Vertikalabschnitte zerlegt, mit scharfkantig-eleganten Portal- und Fenstergehäusen, alles unter Verzicht auf die traditionelle Grammatik der »Ordnungen«. Von höchster Finesse die Behandlung der »Rustika« im Untergeschoß des Palazzo Aquino: an den Kanten urban geglättete Bossenquader, in den Wandfeldern einfache Lagerfugen, deren durchlaufende Horizontalen dem Vertikalismus des Ganzen wirksam entgegentreten; nicht minder fein die chromatische Rechnung mit dem Grau des Peperins, mattorangen Backsteinflächen und grünen Fensterläden. - Das Innere gänzlich verbaut; nur das geräumige, aber konventionelle Treppenhaus des Palazzo Aquino hat sich erhalten.
Palazzo Atri (Via Atri 37, bei S. Maria Maggiore), ein wuchtiger Bau des 17. Jh., zeigt an der 5achsigen Fassade das energische Bestreben, die Vielzahl der Stockwerke einem einzigen Hauptgeschoß unterzuordnen. Das kolossale Eingangsvestibül mündet in eine Pfeilerloggia im »Palladio-Motiv«; links geht die gegenläufig geführte Treppe ab, deren Absätze zum Hof in Bögen geöffnet sind. An 2 weiteren Hofseiten Spuren von Pfeilerarkaden.
Palazzo d’Avalos (Marchese del Vasto; Via dei Mille 48-50)
Im 16. Jh. als Wohnsitz des Ferdinando Francesco d’Avalos erwähnt, der in der Schlacht von Pavia Franz I. gefangennahm und dafür von Karl V. die berühmte Teppichserie (s. S. 403) zum Geschenk erhielt. Seine jetzige Gestalt erhielt das Gebäude in der 2. Hälfte des 18. Jh. durch Mario Gioffredo; zu Beginn des 19. Jh. wurde der links vorspringende Flügel eingesetzt und der rvor dem Palast liegende Platz gärtnerisch gestaltet.
Die 11achsige Fassade hat 3 durch Quaderkanten angedeutete Risalite; das Erdgeschoß ist durchgehend rustiziert (eingetiefte Lagerfugen), 4 Marmorsäulen tragen einen Balkon, der sich über die ganze Breite des Mittelteils zieht; die Obergeschosse haben Fenster mit Segment-und Dreiecksgiebeln. Ein Blick durch das Portal zeigt ein schönes 2teiliges Vestibül mit Säulen, Nischen, Flachkuppeln und feinlinig-magerem Stuckdekor. — Das Innere ist seit jeher absolut unzugänglich, soll aber eine reiche alte Ausstattung enthalten.
Palazzo Bagnara (Via Roma 89, an der Piazza Dante), errichtet nach 1660 viell. nach einem Entwurf Carlo Fontanas für Fabrizio Ruffo, Herzog von Bagnara. 5achsige Fassade mit großer Pilasterordnung und reicher Dekoration, gelb-rot verputzt. Die Pilasterordnung setzt sich im Hof fort; an der Eingangsseite eine Loggia mit architravierter Säulenstellung, gegenüber das Treppenhaus mit geräumiger Mittelnische. — An der Ecke des Palastes die Kapelle, mit einem vorzüglichen Altarbild von Solimena (Glorie des hl. Rufo).
Palazzo Beccadelli (Via Nilo 26, am Largo Corpo di Napoli)
Der Bau gehörte im 15. Jh. Antonio degli Beccadelli aus Palermo (»il Panormita«, 1394-1471), dem berühmt-berüchtigten Dichter (»Hermaphroditus«)‚ Humanisten und Hofhistoriker Alfons’ I. Als Architekt und ausführender Baumeister wird ein gewisser Filippo de Adinolfo genannt; 1483 war das Gebäude noch unvollendet; seine heutige Gestalt scheint es erst im 16. Jh. durch Giovanni Donadio und dessen Schwiegersohn Giovanni Francesco di Palma erhalten zu haben.
Die wuchtige Fassade, zu 6 Fensterachsen und 4 Geschossen (das entstellende 5. später aufgesetzt), gehört zu den interessantesten Leistungen der neapolitan. Renaissance. Die Disposition der Stockwerke — über dem Sockelgeschoß ein Mezzanin, erst dann der Piano nobile und ein weiteres Obergeschoß — ist der Enge und Düsternis der städtischen Straßen angepaßt und daher im neapolitan. Stadtpalast bis ins 19. Jh. wiederholt worden. In der Gliederung zeigen sich Möglichkeiten und Grenzen einer humanistisch orientierten Architektur, die nicht den in Florenz entwickelten Kanones folgt. Kräftige Gebälke über jedem Geschoß markieren die Horizontalen. Die Fenster sitzen jeweils für sich in gerahm-
ten Wandfeldern, die durch flache Lisenen voneinander getrennt sind. Mit den Peperinquadern dieses Gliedergerüstes und des Sockels kontrastiert ein aus Tuff und Backstein gebildetes Füllmauerwerk nach Art des antiken »opus reticulatum«. Die Fensterformen wechseln geschoßweise zwischen Rundbogen und Rechteck, mit jeweils verschiedenen Rahmenmotiven. Das Portal hätte urspr. wohl, wie der innere Bogen zeigt, mit einem Architrav auf korinthischen Pilastern eingefaßt werden sollen; es führt in ein großes tonnengewölbtes Vestibül mit ionischer Ordnung; rechts die Treppe mit langen Laufen parallel zur Hofwand, in den Absätzen durch stufenweise versetzte Bögen geöffnet. An der linken Hofseite noch einige alte Fenster, denen der Fassade entsprechend.
Giovanni Donadio, Palazzo Beccadelli da Bologna und Palazzo Panormita, 1451/1500, Neapel.
Palazzo Berio (vormals Perelli; Via Roma, gegenüber der Galleria Umberto) erhielt seine heutige Gestalt zu Anfang des 19. Jh., nachdem Luigi Vanvitelli 1772 ein großartiges Umbauprojekt entworfen hatte. Die Front 3geschossig mit zurückgesetzter Attika, gegliedert durch Quaderwerk, Rahmenfelder und im Obergeschoß eine ionische Pflasterordnung mit Girlandenfries und Konsolgesims; der Hof ohne Portiken, an der Rückwand eine Ädikula mit bernineskem Felsbrunnen, ein allerdings klassizistisch gedämpftes Überbleibsel des Vanvitelli-Entwurfs.
Palazzo Bonifacio (Via Portanuova 15) bewahrt vom alten Bestand aus dem Anfang des 15. Jh. nur das Portal, vom katalanischen Typus (Flachbogen, in den Zwickeln heraldische Reliefs), ähnlich wie am Palazzo Penna.
Palazzo Calabritto (Via Calabritto / Piazza dei Martiri), seit Beginn des 18. Jh. im Bau und von L. Vanvitelli umgestaltet und vollendet. Der
Palast besteht aus 2 Flügeln von enormen Ausmaßen, welche die S-Seite der Piazza dei Martiri und mit 19 Fensterachsen die ganze Via Calabritto ausfüllen. Als Werke Vanvitellis gelten das riesige ionische Hermenportal (Via Calabritto 20) mit dem dahinter sich öffnenden Vestibül und der rechts abzweigenden Treppe, mit großlinigen grauen Gliederungen auf gelbem Putz, sowie Fassade und Vestibül an der Piazza dei Martiri; hier noch ein schönes ionisches Portal (Halbsäulen mit Pilastern gekoppelt); die 13achsige Front durch einfache Lisenen in Gruppen von 4-5-4 Achsen unterteilt.
Palazzo Capuano (Via S. Pellegrino 24, hinter S. Paolo Maggiore, am Ende der Via S. Paolo links) wurde von Ferd. Sanfelice umgebaut und hat ein Treppenhaus mit polygonal in den Hof vorspringender Front (3 Seiten des Achtecks). In der Mitte Rundbogenöffnungen mit hübschen Balkongittern, seitlich längliche Achteckfenster; die Treppe hat 2 symmetrisch um eine oktogonale Spindel aufsteigende Läufe.
Palazzo Caracciolo d’Avellino, ein Komplex von Palästen am Largo S. Giuseppe dei Ruffo, 1616 von Camillo Caracciolo erweitert und umgebaut. 2 über die Straße geführte Bögen schließen die verschiedenen Gebäudeteile zusammen. Der Palast an der N-Seite gehörte vordem der Porzia de’ Rossi, deren Sohn Torquato Tasso hier seine Jugendjahre verbrachte. Die Fassade zeigt noch die Formen des 16. Jh.; im Hof links ein großes luftiges Treppenhaus. Die westl. anschließende Via dell’Anticaglia (der alte Decumanus Superior) führt unter großen Schwibbögen hindurch; sie wurden in nachantiker Zeit errichtet, um den Ringportikus des griech.-röm. Theaters abzustützen (vgl. S. 18). Von diesem selbst sind in der Hauswand zur Linken 2 Bogenstellungen zu sehen. Das Halbrund der Sitzreihen füllte etwa den Raum zwischen dem Vico Giganti und der Via. S. Paolo; das Proszenium verlief in der Gegend des Knickes des Vico Cinquesanti. Nördl. der Via dell’Anticaglia hat man Überreste der Thermen gefunden, westl. der Via S. Paolo lag das Odeon.
Palazzo Carafa di Belvedere (Vico S. Geronimo 29 / Piazza S. Domenico) zeigt von altem Bestand nur noch das Sockelgeschoß, mit Profilen des frühen 16. Jh., und an der Rückwand des Hofes aus der gleichen Zeit Überreste einer zierlichen Wandgliederung mit 3 gestaffelten Bogenfenstern sowie eine durch 5 Geschosse gehende Treppe mit gegenläufigen Rampen, in Doppelbögen zum Hof geöffnet.
Der gleichnamige Nachbarpalast (Nr. 34) 1846 neu errichtet.
Palazzo Carafa di Belvedere (Ruffo della Scaletta, heute Sitz des deutschen Goethe-Instituts; Riviera di Chiaia 202)
Im 16. oder 17. Jh. gegr. und ehemals berühmt wegen eines ausgedehnten Gartens an der Rückseite des Palastes. Architektonisch interessant der Umbau von 1832-34 durch Francesco Saverio Ferrari und Guglielmo Bechi, dem der Palast seine heutige Gestalt verdankt.
Nach Passieren des schmucklosen Hofes gelangt man in ein Vestibül mit flachbogigem kassettiertem Tonnengewölbe über dorischen Säulen- und Pfeilergruppen; es folgen ein querrechteckiger Zwischenraum und das große oktogonale Treppenhaus, durch das eine beiderseits offene Kolonnade mit geraden Architraven über korinthischen Säulen und Pfeilern hindurchführt und eine reizvolle Perspektive auf den im Hintergrund
liegenden Garten bildet. 2 symmetrische Treppenläufe, von Karyatidengruppen gestützt, steigen an den Wänden des Achtecks bis ins 2. Stockwerk auf; darüber wölbt sich eine fein stuckierte Kuppel mit einer Laterne aus verglastem Eisengitterwerk.
Palazzo Carafa Cantelmo Stuart (Via dei Mille 60), erb. 1769, hat eine einfache Putzquaderfassade; 1geschossige Vorbauten mit Loggien und Terrassen flankieren das Eingangsportal; innen ein luftiges Treppenhaus mit Pfeilern und Kreuzgewölben.
Palazzo Carafa di Maddaloni (Colubrano, Santangelo; Via S. Biagio dei Librai 121)
Lt. Inschrift über dem Portal 1466 von Diomede Carafa »zu Ehren des Königs und des Vaterlandes« erbaut. Als einer der frühesten Parteigänger der Aragonesen, Freund und politischer Ratgeber Alfons’ I., aber auch als Dichter, Schriftsteller, Antikenkenner und -sammler hat Carafa (um 1406-87) im Neapel der Renaissance eine glänzende Rolle gespielt. Alfons’ Nachfolger Ferrante erhob den treuen Gefolgsmann zum Grafen von Maddaloni und vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder Alfonso, Eleonora und Beatrice an. Sein Grabmal befindet sich in der Carafa-Kapelle am rechten Seitenschiff von S. Domenico Maggiore (S. S. 100).
In der Architektur des Palastes stehen, ähnlich wie im Castel Nuovo, spätgot.-katalanische Formen und solche der Frührenaissance unvermittelt nebeneinander. Die Außenwände sind ringsum mit regelmäßigem Quaderwerk überzogen, ohne vertikale und horizontale Teilungen; ein schmales Konsolgesims bildet den oberen Abschluß. Das Portal (Tafel S. 320), auffallend breit und niedrig proportioniert, wird bekrönt von einem aus antikisierenden Zierelementen zusammengestückten Gebälk; im Fries Carafa-Wappen und die Embleme der Familie (eine Waage und ein im Kreis ausgespanntes Stück Leder; die gleichen Motive in den rein gotisch anmutenden Schnitzereien der Türflügel); obenauf 2 spätantike Kaiserbüsten und in der Mittelnische eine Herkules-Statue. Die Friese über den Rechteckfenstern des Obergeschosses tragen Inschriften mit moralisierenden Sinnsprüchen des Bauherrn; in den Kanten der Fassade dicht unter dem Kranzgesims 2 Porträtköpfe, wohl Diomede Carafa und seine Frau. — Vestibül und Hofportikus zeigen wieder katalanische Formen (Flachbögen mit Rundstabprofilen, gebündelte Pfeilervorlagen, Blattkapitelle); doch hat eine antike Marmorsäule im Hofdurchgang links einen Ehrenplatz erhalten (am Piedestal Wappen und In-
schrift in Hexametern). Die linke Hofwand zeigt Reste eines Portikus mit Achteckpfeilern und Bögen wie im Hof des Castel Nuovo, darüber noch 2 Geschosse mit rundbogigen Loggien. Rechts gegenüber befand sich urspr. ein Gärtchen, lt. Inschrift über der Seitenpforte ein Aufenthalt süßer Nymphen und Ort wollüstiger Versuchungen, vor denen die Eintretenden ausdrücklich gewarnt wurden.
Den eigentlichen Ruhm des Palastes bildete Diomede Carafas große Antikensammlung, die im 18. und 19. Jh. in alle Winde zerstreut wurde. Noch Winckelmann hat sie oft aufgesucht; Goethe wurde von Tischbein hergeführt, um den berühmten bronzenen Pferdekopf zu studieren, dessen Nachbildung in Terrakotta heute noch im Hof zu sehen ist (das Original seit 1809 im Museo Nazionale, Saal 36). Es handelt sich um das Fragment einer wahrscheinl. späthellenistischen Kolossalstatue, das aus dem Besitz der Medici stammt und als Geschenk des Lorenzo Magnifico an Carafa 1471 nach Neapel gelangte. Von Antiquaren des 16. Jh. wurde der Kopf mit dem sagenhaften Zauberroß des Vergil zusammengebracht, das einstmals vor dem Poseidon-Tempel, dann auf dem Domplatz gestanden haben soll, bis 1322 ein Bischof, um dem abergläubischen Treiben ein Ende zu machen, die Figur bis auf den Kopf habe einschmelzen lassen. Andere Autoren (darunter auch Vasari) bezeichnen ihn als Arbeit Donatellos, der das Stück übrigens wohl gekannt und als Vorbild für seinen Gattamelata benutzt hat. Goethe fand sich angesichts des von der heutigen Archäologie recht zurückhaltend beurteilten Werkes mit der Antike in ihrer ganzen Größe konfrontiert. »Dieses Kunstwerk«, schreibt er, »setzt in Erstaunen; was muß das Haupt erst mit den übrigen Gliedern, zu einem Ganzen verbunden, für eine Wirkung getan haben! Das Pferd im ganzen war Viel größer als die auf der Markuskirche, auch. läßt hier das Haupt, näher und einzeln beschaut, Charakter und Kraft nur desto deutlicher erkennen und bewundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die aufmerkenden Ohren, die starre Mähne! Ein mächtig aufgeregtes, kräftiges Geschöpf.« Gegenüber stand damals in einer Nische die berühmte Tänzerin oder Nymphe, die 1788 nach Rom verbracht und dort Goethe zum Kauf angeboten wurde; sie wurde dann von Papst Pius VI. erworben und im Gabinetto delle Maschere des Vatikanischen Museums aufgestellt.
Palazzo Carafa di Montorio (Via S. Biagio dei Librai 3-8) ist das Geburtshaus des nachmaligen Papstes Paul IV. (Giov. Pietro Carafa, 1476 bis 1559). Den heutigen Bau ließ der Kardinalnepote Carlo Carafa errichten (1540); erhalten, aber gänzlich verwahrlost, die einfache Fassade mit mächtig vorspringendem Kranzgesims.
Palazzo Carafa di Noia (Via Monte di Dio 66 [Pizzofalcone]), als Bau ohne Interesse, besitzt einen herrlichen Garten und darin ein von
Pompeo Carafa 1831 erbautes Casino (später Villa Wenner), 1geschossig mit Säulenvorhalle und hübschen Stuckdekorationen, derzeit im Umbau und wohl mehr oder weniger in Zerstörung begriffen. Höchst überraschend der Blick nach Westen in den trichterförmigen Steilabsturz des Kraters von Ecchia, der den vulkanischen Ursprung des Pizzofalcone-Hügels offenbart.
Palazzo Carafa di Policastro (Duca di Forli; Largo Ferrandino [Chiaia]). Ende 18. Jh. Fassade in ganz großem Stil in der Art Ferd. Fugas, aber schon etwas schematisch und trocken; die 3 1/2 Geschosse in 2 Ordnungen zusammengefaßt: unten ionisch mit Rustika, oben korinthisch mit einer Blendrahmengliederung; seitlich noch niedrige Flügel mit Terrassen und Statuen.
Palazzo Carafa di Sanseverino (heute Archivio Militare; am Ende der Via Egiziaca a Pizzofalcone)
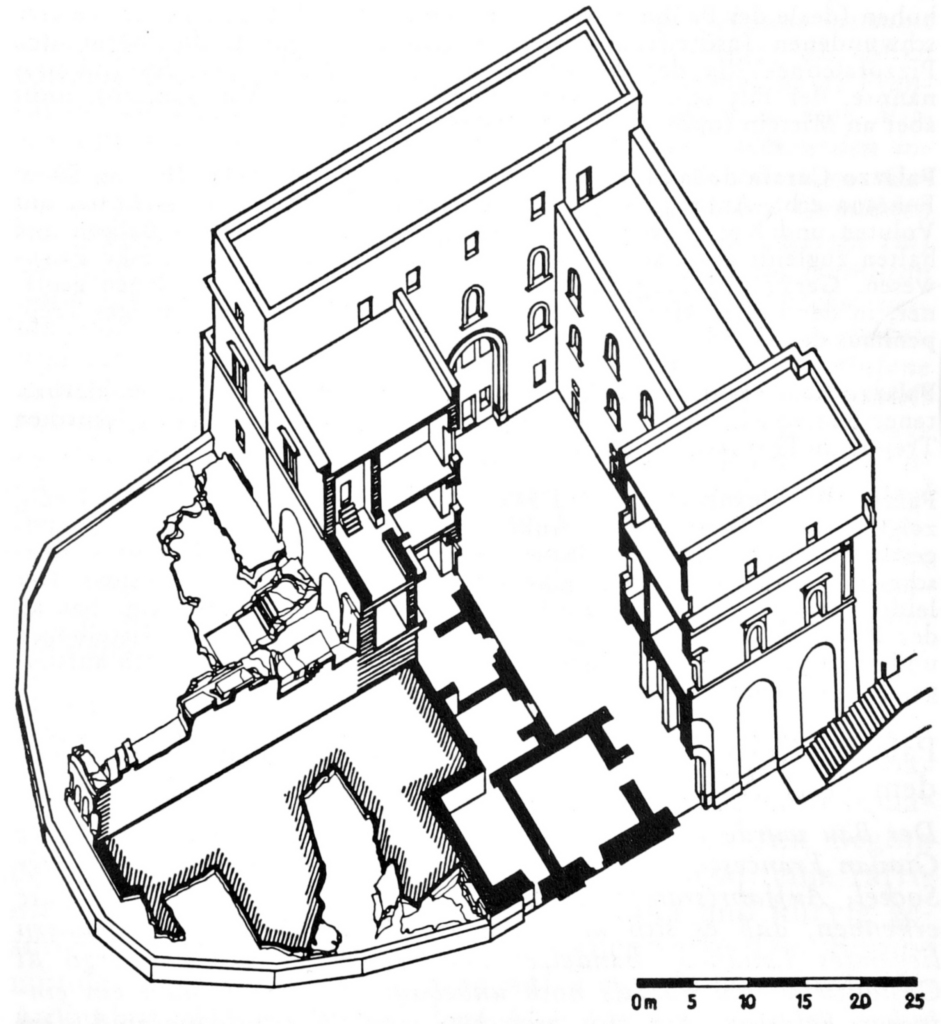 Palazzo Carafa di Sanseverino. Schnitt
Palazzo Carafa di Sanseverino. Schnitt
1512 durch Andrea Carafa della Spina, Duca di S. Severino erbaut, 1526 von Ferrante Loffredo erworben und vergrößert. Die unvergleichliche Situation auf der Höhe des Pizzofalcone inspirierte den Erbauer zur Anlage ausgedehnter Gärten, die aber bald wieder verfielen; gegen Ende des 16. Jh. entstanden auf ihrem Gelände Kasernen für die spanischen Okkupationstruppen, deren wüstes Treiben die Gegend für lange Zeit in Verruf brachte.
Carafas Villenpalast, dessen Hauptlinien in dem heute stehenden Bau leicht erkennbar sind, ist (nach dem Maßstab der Hochrenaissancezeit) von geringem Interesse und jedenfalls weit entfernt von dem, was man im Neapel der Aragonesen unter einer Villa verstanden hatte: ein geschlossener 4-Flügel-Bau mit rechteckigem Innenhof, ohne Portiken, Loggien oder andere Kennzeichen des Villenbaus; rundbogig gerahmte Fenster von eher quattrocenteskem Zuschnitt; ebensolche Portale und einfach profilierte Gesimse bilden die einzigen Gliederungsmittel. Die hohen Ideale des Bauherrn drückten sich vornehmlich in einer heute verschwundenen Inschrift aus, in der Carafa eingedenk der berühmten Pizzofalcone-Villa des Altertums sich einen Nachfolger des Lukullus nannte, der mit seinem Vorbild allerdings nur an Mut (animo), nicht aber an Mitteln (opibus) hätte wetteifern können.
Palazzo Carafa della Spina (Via G. B. Croce 45), Ende 16. Jh. von Dom. Fontana erb.‚ Anfang 18. Jh. eingreifend verändert. Enormes Portal mit Voluten und Knorpelwerk; 2 grinsende Satyrn stützen den Balkon und halten zugleich das Carafa-Wappen; auf den Prellsteinen groteske Fabelwesen. Geräumige Treppen mit gegenläufigen Rampen, in Bögen geöffnet, in der linken Hofecke. — Gegenüber, Nr. 23, schönes luftiges Treppenhaus des 18. Jh.
Palazzo Casamassima (Via Atri neben S. Maria Maggiore), ein wohlerhaltener Bau von F. Sanfelice, mit einfacher Putzfassade und einer hübschen Treppe im Hof rechts.
Palazzo Cavalcanti (Via Roma 348), errichtet 1762 von Mario Gioffredo, zeigt in der Fassade starke Anklänge an Vanvitelli: über dem Sockelgeschoß ionische Kolossalpilaster vom »Michelangelo-Typ«, gutes dorisches Säulenportal, darüber eine Balkontür in flacher Bogennische. Der leider stark veränderte Hof, im Grundriß querrechteckig, hat an der Rückseite einen Portikus mit weitgespanntem flachem Mittelbogen und architravierten Seitenöffnungen, unter denen 2 symmetrisch aufsteigende Treppenläufe sichtbar werden.
Palazzo Cellamare (Carafa di Stigliano, Francavilla; über dem westl. Ausgang der Via Chiaia)
Der Bau wurde zu Anfang des 16. Jh. (vor 1533) von dem Abate Giovan Francesco Carafa errichtet. Seine Grundform — geböschter Sockel, Auffahrtsrampe, halboffener Vorplatz — läßt noch heute erkennen, daß es sich urspr. um ein weit vor den Stadtmauern liegendes Landhaus handelte: Die Hügel westl. des »Largo di Castello« waren damals noch unbebaut, die Via Chiaia ein einfacher Feldweg, der sich zwischen dem Pizzofalcone und dem Abhang des Vomero (»Collina delle Mortelle«) hindurchschlän-
gelte. Als Gast des Luigi Carafa, Fürsten von Stigliano, hat der junge Torquato Tasso hier glückliche Tage verlebt. Auch in der offiziellen Geschichte des Königreichs taucht der Name des Palastes auf: So diente er nicht selten den neuernannten spanischen Statthaltern als Aufenthalt, bevor sie in den Palazzo Reale einzogen. 1636 wurde hier die berühmte Hochzeit zwischen Donn’Anna Carafa und dem künftigen Vizekönig Ramiro de Guzman gefeiert (s. S. 301). Während des Masaniello-Aufstands und der folgenden Reaktion, 1647/48, wurde der Palast von den spanischen Soldaten als Stützpunkt benutzt und heftig umkämpft; z. Z. der Pest von 1656 beherbergte er ein Lazarett. Nach dem Aussterben der Familie des Gründers, 1686, fiel der Besitz zunächst an den Fiskus zurück und wurde dann 1696 von Antonio del Giudice, Principe di Cellamare erworben, der eine umfassende Restaurierung durch Ferd. Fuga veranlaßte (1726-29). 1733 ging das Gebäude mitsamt dem Fürstentitel an die Caracciolo del Gesso über; als deren Mieter richtete sich 1760 Don Michele Imperiale, Principe di Francavilla, im Palast ein und machte ihn für 2 Jahrzehnte zum Mittelpunkt des eleganten Lebens der Stadt. Die Gärten wurden instandgesetzt, die Innenräume im neuesten »französischen« Geschmack dekoriert und mit den kostbarsten Möbeln und Gemälden ausgestattet. Auf den berühmten Karnevalsbällen des Fürsten traf sich die europäische Lebewelt; von einer mit Sir William Hamilton und Lady Elizabeth Chudleigh, Duchess of Kingston, höchst vergnüglich verbrachten Einladung hat Giacomo Casanova berichtet. 1784 bezog die von der Königin Karoline nach Neapel gerufene Angelika Kauffmann ein Appartement des Palastes; 1786 erhielt Philipp Hackert einen Flügel eingeräumt, den er nach dem Zeugnis Goethes »mit Künstlergeschmack möblieren ließ und mit Zufriedenheit bewohnte«. Seit 1799 beherbergte der Palast die »Real Galleria di Francavilla«, eine Kollektion von Bildern, die Ferdinand I. in Rom hatte zusammenkaufen lassen, um die in der Revolutionszeit entstandenen Verluste der königlichen Kunstsammlungen auszugleichen; sie enthielt Hauptstücke wie Guido Renis »Atalanta«, Claude Lorrains Egeria-Landschaft u. a.
Heute steht der Palast von allen Seiten beengt inmitten der Häuser des Chiaia-Viertels; im Souterrain hat sich ein Kino eingenistet. Die Außenmauern zeigen unter dem barocken Verputz noch die Strukturen des Cinquecento (Quadersockel, Arkaden, Lisenen, Rechteckfenster). Am Beginn der Auffahrt erhebt sich Fugas Eingangsportal, eine raffinierte Mixtur von streng dorischer Rustika und kurvig geschwungenem Voluten- und Kartuschenwerk. Die Rampe mündet nach schrägem Anstieg auf einem längsrechteckigen Außenhof. Dessen linke, dem Meer zugewandte Seite ist unbebaut geblieben; 3 prächtige Roßkastanien ersetzen hier
die schattenspendende Loggia. An der hinteren Schmalseite ein niedriger Portikusflügel mit Dachterrasse; die angrenzende Längsfront des Palastes hatte im Untergeschoß gleichfalls Bögen, die aber von Fuga geschlossen wurden (dahinter die Palastkapelle, s. u.); auch die dekorativen Details der Fassade verraten die Hand des Settecento-Architekten. (Eine Vedute vom Anfang des Jahrhunderts, in röm. Privatbesitz, zeigt die Bogenhallen noch geöffnet und von glatten Peperin-Archivolten gerahmt, im Obergeschoß die heutige Lisenengliederung, jedoch wiederum in grauem Peperin, vor weiß verputzten Wandflächen.) Der an der O-Seite vortretende Hauptblock des Baues umschließt einen engen, arkadenlosen Innenhof, dahinter das geräumige Treppenhaus mit großen Bogenfenstern, die urspr. viell. eine zur Stadt geöffnete Loggia bildeten.
Eine Erlaubnis zur Besichtigung der Innenräume (4 große Säle mit Stuck und Fresken von Fischetti, Diana u. a.) ist derzeit nicht zu erhalten, wird aber für eine nicht näher bestimmte Zukunft in Aussicht gestellt.
Dafür eröffnet ein Trinkgeld an den Pförtner den Zugang zur Kapelle, die unter den oben erwähnten vermauerten Arkaden des Vorhofs ihren Platz gefunden hat. Als Fugas erstes gebautes Werk stellt sie eine beachtenswerte Talentprobe des jungen, in Rom geschulten Florentiners dar. Der Eingang befindet sich in der Mittelachse der Hof-Fassade. Das dahinterliegende Portikusjoch hat Fuga als Vestibül behandelt (ausgekehlte Eckpilaster, Flachkuppel). Die rechte der 4 Türen führt in die Kapelle: Sie nimmt 2 weitere Joche des Portikus ein und schließt mit einer flach ausschwingenden, seitlich in Durchgänge und Coretti aufgelösten Apsiswand. Nach Art Borrominis werden die Wandgliederung und ebenso das Altargehäuse durch eine ringsumlaufende korinthische Pilasterordnung gebildet; auch das ornamentale Detail — aufgebogene Spitzgiebel, Rahmenfelder, Festons und Kartuschen — zeigt den Einfluß des großen Barockmeisters. 2 stehende Ovalfenster an der Hofseite sorgen für reichliches Licht. Über dem Gebälk hat Fuga in jedem der beiden Kompartimente eine niedrige Hängekuppel eingezogen; im Scheitel befindet sich jeweils eine vierpaßförmige Öffnung, durch die man auf ein Gemälde an der darüberliegenden Flachdecke blickt. Kleine Fenster über der Wölbschale, nur von außen sichtbar, dienen der Beleuch-
tung der Deckenbilder. Ähnliche Effekte hatte schon um die Mitte des 17. Jh. in Frankreich J. Hardouin-Mansart erprobt; Fugas Vorbild war vermutl. die Cäcilienkapelle in S. Carlo ai Catinari zu Rom, von dem Cortona-Schüler Antonio Gherardi (1691).
Der an der Rückseite des Palastes liegende Terrassengarten (Aufgang vom Hof aus links), heute ganz verwildert, gehörte schon zum Bau des 16. Jh. Aus der Zeit Luigi Carafas (Mitte 16. Jh.) stammt die marmorne Brunnenfassung mit Masken, Meerwesen und heraldischen Symbolen. — Über der rückwärtigen Futtermauer mit seitlich aufsteigenden Rampen erheben sich 2 hübsche Villen-Casini des 19. Jh.; das weiter hangaufwärts liegende Gelände, das noch z. Z. Francavillas ausgedehnte »orti rustici« enthielt, ist jetzt anderweitig bebaut.
Palazzo Cilento (Duca di Rodi; Via dei Tribunali 231, gegenüber dem Palazzo Traetta) bewahrt noch die Fassade vom Anfang des 16. Jh. Rundbogenportal auf Pfeilern mit ionischen Kapitellen, Fenster unten rundbogig, oben gerade gesschlossen.
Palazzo Cirella (Via Roma 228), ein Bau aus der Vanvitelli-Nachfolge vom Ende des 18. Jh. Nüchterne Fassade mit dorischem Portal; der enge Hof wird durch eine Nischenarchitektur mit Terrasse gegliedert.
Palazzo Cuomo (Via del Duomo 288, schräg gegenüber von S. Giorgio Maggiore)
Zwischen 1464 und 1490 für den neapolitan. Kaufmann Angelo Cuomo errichtet. 1587 ging der Bau in den Besitz des benachbarten Konvents ’von S. Severo über. Bei Anlage der Via del Duomo (1880) wurde der Palast abgebrochen und in einer neuen Fluchtlinie wiederaufgebaut, unter steingerechter Rekonstruktion der Fassaden; das Innere wurde damals völlig neu gestaltet und dient seitdem als Museum (s. u.).
Die wuchtige Haupt-Fassade an der Via del Duomo zeigt die für jene Epoche ortsübliche Mischung katalanisch-traditioneller Formen mit den neuen Ideen der Florentiner Frührenaissance. Bemerkenswert ist die Beschränkung auf 2 Geschosse; das oberste Stockwerk hat keine Fenster, so daß zwischen dem Piano nobile und dem krönenden Konsolgesims ein unverhältnismäßig hohes, kahles Wandstück aufsteigt. Die derbe Rustika des Erdgeschosses und die Fassung des Rundbogenportals müssen auf florentinische Vorbilder zurückgehen; dagegen entsprechen das glatte Quaderwerk der Oberzone wie auch die Sims- und Sockelformen einheimischer Überlieferung (vgl. Palazzo Carafa di Maddaloni). Die unregelmäßige Disposition der Fenster läßt auf eine wechselvolle Baugeschichte schließen; die Profile der Kreuzsprossenfenster an der südl. Seitenfassade zeigen noch
spätgot. Zuschnitt, die der Hauptfront reine Renaissanceformen.
Das Museo Civico Filangieri
ist eine Stiftung des Fürsten Gaetano Filangieri, aus der berühmten Politiker-und Gelehrtenfamilie (s. S. 303), der auch die Kosten für den Neuaufbau des Palastes übernahm (1880-82). Während des letzten Krieges waren seine Bestände zusammen mit den älteren Urkunden des Staatsarchivs in eine Villa hei Nola ausgelagert; ein 1943 von deutschen Soldaten gelegtes Feuer vernichtet fast sämtliche Archivdokumente und einen Teil der Museumsschätze (Bilder von Botticelli, Luini, Stanzione, Preti, Giordano, Solimena u. a.).
Ein vollständiges Verzeichnis der Sammlung gibt der Katalog von F. Acton (1961); wir heben nur einzelnes hervor. Eingangssaal: Die großartige Terrakottabüste Ferdinands I. von Bourbon, von Antonio Canova (1804 — Studie für das Reiterdenkmal des Königs auf der Piazza del Plebiscito, s. S. 111); eine weibliche Büste aus dem Umkreis der Caffieri (französ.‚ Ende 18. Jh.); Skulpturenfragmente des 14. und 15. Jh., u. a. von Jac. della Pila und Tomm. Malvito; ein antiker weiblicher Kopf, in der Lokalgeschichte berühmt als »Capa di Napoli« (vgl. S. 103); chinesische und japanische Waffen und Fahnen.
Obergeschoß: 2 hübsche Landschaften von Frans van Bloemen; hl. Praxedis von Bernardino Luini; Guercino, La Maddalena; Ruinenphantasien und Veduten von Pannini und Marieschi; Anbetung der Hirten von Fr. de Mura; 2 exzellente Bozzetti von Giordano (Gastmahl des Balthasar und Triumph der Galathea); ein Bozzetto von Fischetti für die Glorie Alexanders d. Gr., jetzt im Museum von Capodimonte; Boucher, Venus und Amor; hl. Agathe und Magdalena von A. Vaccaro; ein sehr großartiges Ecce homo von G. B. Caracciolo; Anbetung der Hirten von Stomer; 3 erstrangige Riberas: Kopf Johannes’ d. T. (1647), Ägyptische Maria (1651), Gottvater mit Engeln; M. Preti, Begegnung von Peter und Paul vor den Toren Roms; 2 Ansichten von Neapel (17. Jh.); eine vorzügliche Terrakottabüste des Abbé Galiani von Gius. Sammartino (Vitrine 35, im Treppenwinkel). — In den Vitrinen eine reichhaltige Sammlung von Kleinplastik, Stoffen, Majolika, Porzellan u. a.
Die Bibliothek enthält wertvolle Autographen (Ladislaus von Ungarn, Pedro di Toledo, Karl V., Johanna I. u. a.) und eine umfangreiche Münzsammlung.
Palazzo Del Balzo (Petrucci; Piazza S. Domenico 3), als Wohnhaus des Antonello Petrucci, Sekretär Ferrantes I., um 1470 im Bau; nach dem Erdbeben von 1688 erneuert. Das Portal eine vereinfachte Nachbildung desjenigen am Palazzo Carafa di Maddaloni. Weitere Überbleibsel der urspr. Anlage im Innern: ein kreuzgratgewölbtes Vestibül mit flachem Stich, im Hof flachbogige Arkaden auf polygonalen Pfeilern und Reste zweier Obergeschoßloggien.
Palazzo De Rosa (Via Roma 424-29) wurde gegen Ende des 18. Jh. für den Fürsten von Monteleone begonnen, 1826-34 von Pietro Valente zu Ende geführt. Das geschickt disponierte Treppenhaus fand einen Bewunderer in dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der sich für die Werke Valentes interessierte und während seines neapolitan. Aufenthaltes (1828) den Palazzo De Rosa besuchte.
Palazzo De Sinno (Via Roma 206, gegenüber der Funicolare Centrale)
Ein sechsgeschossiger Mietspalast des 18. Jh., mit vornehm dekorierter Fassade im Stil F. Fugas. Ein Vestibül mit Flachkuppel führt in den Hof; in der schmucklosen Rückwand öffnet sich in weitem Bogen eines der abenteuerlichsten
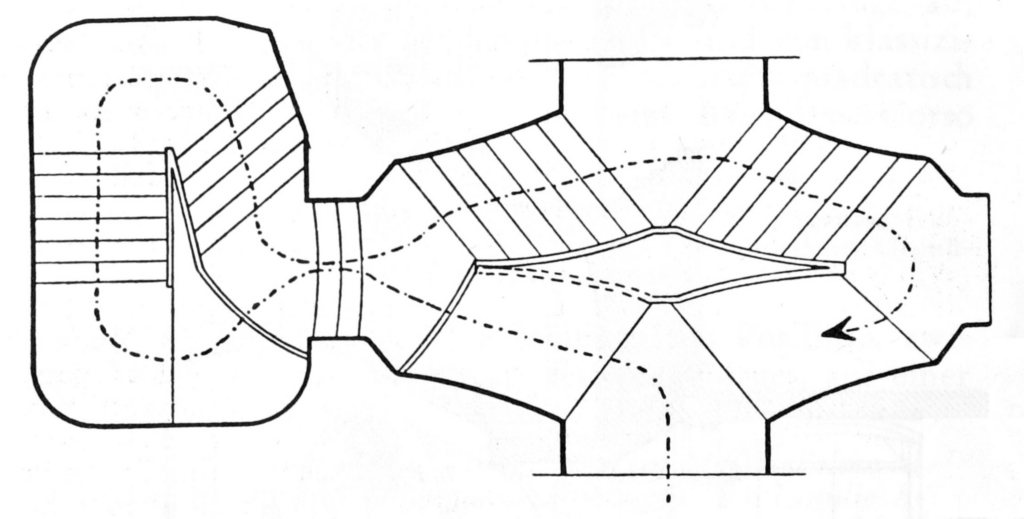 Palazzo De Sinno. Treppenhaus, Grundriß
Palazzo De Sinno. Treppenhaus, Grundriß
Treppenhäuser Neapels. Wie in Sanfelices Palazzo Di Maio (s. u.) ruhen die kurzen, kurvig geschwungenen Läufe auf frei tragenden Halbgewölben; der Aufstieg führt schräg unter dem Eingangsbogen hindurch und windet sich dann in verwirrendem Zickzack um 2 offene Spindeln von einmal rautenförmiger, das andere Mal dreieckiger Grundgestalt.
Der Reichtum der Durchblicke, die sich von Absatz zu Absatz eröffnen, ist nicht zu beschreiben; Wände und Wölbflächen, Podeste und Treppenläufe bilden ein Netz ineinanderschwingender Kurvaturen, die mit jeder Wendung in neuen Konstellationen erscheinen. Die Asymmetrie des Ganzen mag durch wer weiß welche topographischen Mißhelligkeiten bedingt sein, wirkt aber vollkommen freizügig und erweckt den Eindruck einer kunstvoll stilisierten »Nature
treppe« aus einem der amalfitanischen Küstenorte. Die Dekoration auch hier von betonter Strenge und Nüchternheit.
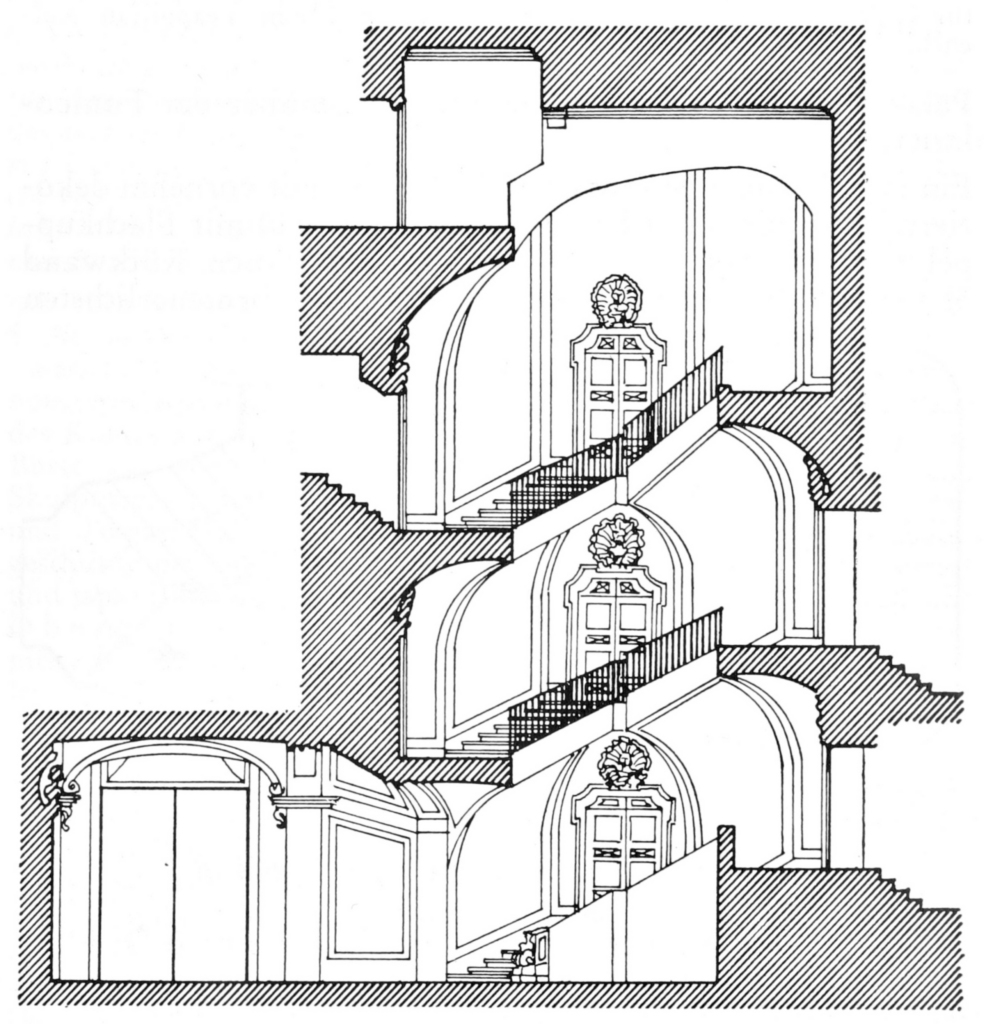 Palazzo Di Maio. Wendeltreppe, Schnitt
Palazzo Di Maio. Wendeltreppe, Schnitt
Palazzo Di Maio (Discesa della Sanità 68, parallel zur Via S. Teresa)
Ein charakteristischer Bau Sanfelices, mit höchst skurrilem Portal und einem der schönsten Treppenhäuser des Meisters (links vom Vestibül): Eine offene Wendeltreppe über rhombischem Grundriß, mit konvex einschwingenden Seiten und abgeplatteten Ecken, steigt an den Wänden empor, wobei 7stufige Läufe mit dreieckigen Absätzen wechseln. Die Zeitgenossen bestaunten v. a. die technische Kühnheit der Kon-
struktion, die auf Mittelpfeiler verzichtet und stattdessen mit gegenseitig sich abstützenden »einhüftigen« Gewölben arbeitet. Dabei gehen Wand und Wölbung jeweils ohne Absatz ineinander über, so daß für den Blick von unten her das Ganze sich als ein System fächerförmig ineinandergreifender, windschief verzogener Flächen darstellt. Jedes Feld ist einheitlich weiß verputzt und mit einem dunkel getönten Rahmenband eingefaßt; das durch große Fenster einfallende Sonnenlicht wird je nach Winkel und Krümmungsgrad der beleuchteten Flächen verschieden reflektiert, wodurch sich bei einfachstem Formbestand ein zauberhaft reiches Raumbild ergibt. Kein überflüssiger Dekor lenkt das Auge ab; selbst die Eisengeländer der Treppenläufe sind von klassizistisch anmutender Schlichtheit. — Der Hof, urspr. quadratisch mit ausgerundeten Ecken, wurde beim Bau des »Corso Napoleone« (Via S. Teresa) halbiert.
Palazzo Di Maio (Piazza della Vittoria 6), ein ehemals eleganter frühklassizist. Wohnpalast mit offener Spindeltreppe von elliptischer Grundform, heute leider zum Fahrstuhlschacht degradiert.
Palazzo Donn’Anna (Duca di Medina; Via Posillipo, zwischen Mergellina und dem Kap des Vorgebirges, auf einer dem Ufer vorgelagerten Tuffbank; Tafel S. 321)
Seit dem 16. Jh. trug der zu Villeggiatur einladende Felsen einen »La Sirena« genannten Villenpalast, der urspr. der Familie Bonifacio gehörte und zu Anfang des 17. Jh. an die Carafa di Stigliano überging. 1630 wurde die 23jährige Anna Carafa Universalerbin der unermeßlich reichen Familie und damit, nach dem Urteil der Zeitgenossen, eine der begehrtesten Partien Europas. Ganz Neapel nahm Anteil an dem sich nun entwickelnden Aufmarsch der Rivalen, unter denen sich Träger berühmtester Namen befanden (Medici, Barberini, d’Este); ein einheimischer Bewerber, Don Ciccio di Loffredo, steigerte seine Leidenschaft zu solchem Grade, daß er durch vizekönigliches Edikt aus der Stadt entfernt werden mußte. Die Frage entschied sich am Ende auf der Ebene höchster Politik, zugunsten des designierten Vizekönigs Ramiro de Guzman, Herzog von Medina de las Torres, der 1636 mit einer Flotte von Prunkgaleeren vor dem Palazzo Cellamare vorfuhr und seine dort residierende Braut mit Kanonen- und Musketenschüssen begrüßte. Nach der dortselbst gefeierten Hochzeit zog das Paar zunächst in die Villa Sirena; ab 1637 entfalteten der neue Herrscher und seine Gemahlin eine glänzende Hofhaltung, allerdings um den Preis einer skrupellos ausbeuterischen Mißwirtschaft, die sich selbst von dem damaligen Zeithintergrund düster abhebt. 1642 beschlossen
sie, die alte Posillipo-Villa abreißen und durch einen ihren Ambitionen genügenden Neubau ersetzen zu lassen. Mit 400 Arbeitern führte Cosimo Fanzago das riesige Gebäude in 2 Jahren bis zu seiner heutigen Höhe empor; dann setzte die Abberufung Guzmans 1644 dem Unternehmen ein jähes Ende. Don Ramiro reiste nach Spanien zurück, seine Gemahlin ging nach Portici, wo sie ein Jahr später, vereinsamt und von Melancholie befallen, an einer ekelerregenden Krankheit starb. Beim Masaniello-Aufstand von 1647 wurde der Palast des verhaßten Statthalters gründlich ausgeplündert und verwüstet. Das Erdbeben von 1688 verwandelte den immer noch unvollendeten Bau in eine Ruine; Brandung und salzige Meeresluft, denen die unverputzt gebliebenen Tuffmauern vielfache Angriffsflächen boten, setzten das Zerstörungswerk fort.
Eine teilweise Restaurierung von 1711 konnte den Verfall nicht aufhalten. Hundert Jahre lang boten die Gewölbe des Palastes nur Landstreichern und Flüchtlingen Unterschlupf; das Volk verband seinen Namen (»Dognanna«) mit der skandalumwitterten Königin Johanna I. von Anjou und sah deren Gespenst in ihm umgehen. In diesem Zustand hat Karl Blechen den Bau gezeichnet und als Hintergrund seines Bildes »Mönch in einer Felsgrotte« verwendet. 1824 wurde im Untergeschoß eine Glasfabrik eingerichtet; nach 1870 ging das Gebäude durch die Hände verschiedener Spekulanten und wurde partienweise im Stil eines Mietshauses für gehobene Ansprüche restauriert. Die Innenräume sind seitdem unzugänglich.
Als Motiv utopischer Landschafts- und Architekturmalerei (Claude Lorrain) hat der frei am Meeresstrand liegende Villenpalast in der Kunst des Barock eine bedeutende Rolle gespielt; in Wirklichkeit aber war seit dem Niedergang des Römerreiches keinem italien. Architekten von Rang mehr ein solcher Auftrag zuteil geworden. Ob Fanzago der Mann war, das Besondere dieser Situation zu erfassen, mag hier dahingestellt bleiben; jedenfalls zeigt sein Entwurf die Grenzen, die der Geist der Epoche dem vielfach begabten Künstler setzte: »decorum« und spanische Grandezza triumphieren über das humanistische Villenideal des 15. und 16. Jh., in dem die sinnlich verfeinerte Lebenskunst der Antike sich regeneriert hatte. So präsentiert Fanzagos Bau sich vom Land wie von der See her als ein massiver Palast von 11 x 13 Fensterachsen, dessen Fronten allerdings so abwechslungsreich wie möglich gegliedert werden. Im Zentrum öffnen sich jeweils 3bogige Pfeilerloggien; weitere Bogenöffnungen erscheinen in den Außenachsen. Die Kanten des Blockes sind abgeschrägt und im Piano nobile als geräumige offene Nischen ausgebildet (man denkt an die Ecknischen im
Hof des Farnese-Palastes zu Piacenza, von Vignola); darüber springen die Wände des (nur teilweise ausgeführten) Obergeschosses rechtwinklig ein und lassen dreieckige Aussichtsterrassen frei. Aufwendige Fenster-Ädikulen und mit Rücklagen gebündelte Pflaster, unten rustiziert, oben in frei variierten dorisch-ionischen Formen, verleihen den Wänden kräftiges Relief.
Durch die Uferlage bedingt, ist das Innere des Gebäudes auf 2 Ebenen zugänglich: Von der eigens angelegten Küstenstraße konnte man zu Wagen direkt in den Hof des Hauptgeschosses einfahren, der mit der seewärts geöffneten Loggia der SO-Seite kommuniziert; darunter, in der Loggia des Sockelgeschosses, stieg eine Treppe zum Anlegeplatz der Boote hinab. Auf diese Weise hielt der Vizekönig, wie ein zeitgenössischer Poet sich ausdrückt, »mit einem trockenen, einem nassen Fuß, die Flechten der Sirene in den Händen« (ave no pede asciutto e n’autro nfuso, e tene la serena pe le trezze).
Villa Doria d’Angri (Istituto S. Dorotea; Via Posillipo 408) wurde 1833 von Bartolomeo Grasso für Marcantonio Doria, Fürst von Angri und Herzog von Eboli, errichtet. Das heute durch eine Aufstockung entstellte und von modernen Wohnbauten eingeengte Gebäude ist ein schönes Beispiel für die großzügige Architektur der Posillipo-Villen des frühen 19. Jh. Der zum Meer abfallende Felsenhang ist durch Rampen und Gartenterrassen gegliedert; ein Sockelgeschoß mit vorspringendem Mittelcorps und rundbogigen Pfeilerarkaden trägt den Hauptpalast, einen breitgelagerten Block mit ionischen Säulenportiken in der Art des englischen Palladianismus. Auf einem Söller am W-Rand des Grundstückes steht ein zierliches »Caffé-Haus« in Form einer Pagode.
Palazzo Filangieri d’Arianiello (Via Atri 23, bei S. Maria Maggiore) Ein stattlicher Bau aus der 1. Hälfte des 18. Jh., mit geräumigem Vestibül und quadratischem Innenhof, der an 3 Seiten von Portiken eingefaßt wird (rechts vermauert); an der Rückwand das durch 5 Geschosse gehende Treppenhaus, wie üblich in offenen Pfeilerloggien; das Ganze weiß verputzt, mit dunkelgrauen Peperinpilastern und belebt von zahlreichen Grünpflanzen.
Der berühmteste Bewohner des Palastes war gegen Ende des 18. Jh. Gaetano Filangieri, Autor eines damals grundlegenden staatsrechtlichen Werkes (»Scienza della Legislazione«) und Mitschöpfer der amerikanischen Verfassung. Eine schwungvoll stilisierte Inschrift an der Fassade erinnert an sein Zusammentreffen mit Goethe, der schon von Deutschland aus mit ihm korrespondiert hatte und mit den politischen Anschauungen des neapolitan. Gelehrten tief sympathisierte (»Er gehört zu den ehrwürdigen jungen Männern, welche das Glück der Menschen und eine löbliche Freiheit derselben-
im Auge behalten«). Bei seinen mehrfachen Besuchen im Palast lernte Goethe nicht nur die Werke Giambattista Vicos kennen, sondern auch Filangieris Schwester Teresa, die »Prinzessin« der »Italienischen Reise« (s. S. 320), deren Verhältnis zu ihrem Bruder durch die famose Maxime charakterisiert wird: »Wenn man alle Gesetze studieren wollte, so hätte man gar keine Zeit sie zu übertreten.« Der Zettel, auf dem Goethe sich diesen Ausspruch notiert hatte, geriet später irrtümlich mit anderen, ganz seriösen »Sprüchen in Prosa« in Druck, und der alte Geheimrat und Staatsminister sah sich zu einem Kommentar veranlaßt, in dem er die Identität der Urheberin preisgab. Die Gestalt Filangieris, der ein Jahr nach dieser Begegnung starb (sein Grab in Vico Equense, s. S. 561), hat Goethe den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen; noch in »Wilhelm Meisters Wanderjahren« (l, 6) hat er ihrer gedacht.
Palazzo Filomarino della Rocca (Sanseverino di Bisignano; Via G. B. Croce 12)
Von Giov. Francesco di Palma 1512 für Bernardino Sanseverino, Principe di Bisignano heg.‚ im 17. und 18. Jh. mehrfach verändert; Wohn- und Arbeitsstätte des großen neapolitan. Philosophen und Historikers Benedetto Grace (1866-1952) und Sitz des 1947 von ihm gegründeten Istituto Italiano per gli Studi Storici.
Das Eingangsportal stammt von Ferd. Sanfelice (Anfang 18. Jh.). — Im H of hat sich die Architektur des 16. Jh. erhalten; für Neapel ungewöhnlich splendide der ringsumlaufende Pfeilerportikus; der Bogen des tonnengewölbten Vestibüls greift nach Art eines »Palladio-Motivs« in das Obergeschoß hinein; seine größere Spannweite wird auf der gegenüberliegenden Seite durch 2 verdoppelte Pfeiler wettgemacht.
Palazzo Firrao (Via S. Maria di Costantinopoli 98), große Fassade zu 7 Achsen und 4 Geschossen, urspr. wohl aus der Mitte des 16. Jh. (vgl. das Kranzgesims sowie die Pilaster und Balkons des Piano mobile), aber in der 1. Hälfte des 17. Jh. aufs üppigste neu dekoriert. Die Gliederung des Untergeschosses, mit ionischen Quaderpilastern und gesprengten Segmentgiebeln über Fenstern und Portal, erinnert stark an Fanzago; über den Fenstern des Piano mobile Ovalnischen mit Büsten der spanischen Könige.
Villa Floridiana, in unvergleichlicher Position am S-Hang des Vomero (Collina di Chiaia), zwischen Via Cimarosa und Corso Vittorio Emanuele.
Das Grundstück wurde 1816 von König Ferdinand I. erworben und seiner morganatischen Gemahlin Lucia Migliaccio Partanna, Herzogin von Floridia, zum Geschenk gemacht; im Laufe weniger Jahre schuf Antonio Niccolini hier eine der schönsten Villen des Neapler Klassizismus.
Die Anlage des Parks (Eingänge Via Cimarosa 77, unweit der Bergstation der Funicolare di Chiaia, und Via Aniello
Falcone 171) folgt dem »englischen« Typus; vielfach verschlungene Wege zwischen säkularem Baumbestand — Pinien, Steineichen, Platanen, Zedern, Zypressen und zahlreiche Palmenarten, dazwischen prachtvolle Magnolien und Kamelien — führen zu künstlichen Ruinen, Rundtempelchen und einem halbrunden »Naturtheater«.
Am unteren Ende liegt der Palazzo, ein 2geschossiger Breitbau mit sparsamer dorisch-ionischer Pilastergliederung; seine Architektur hält die Mitte zwischen der Rückbildung spätbarocker Motive und dem strengen und reinen Klassizismus der 20er Jahre des 19. Jh. (Villa Pignatelli). Die N — Fassade wird von 2 schmalen Eckrisaliten eingefaßt; über dem Mittelcorps liegt ein Dreiecksgiebel; eine rundbogig geöffnete Eingangshalle tritt vor das Portal.
Als Hauptschauseite fungiert die dem Golf zugewandte S-Front. Hier bildet die Dachkante eine reine Horizontale; die Attika-Balustrade mit ihren (großenteils verlorenen) Vasen und Kandelabern ruft eine festlich-heitere Stimmung hervor. Der Rhythmus der Fensterachsen (3 engstehende im Zentrum, je 3 weite in den Flügeln) wirkt etwas schematisch, doch sind die dekorativen Details — zarter Quaderputz, Gesimse und Fensterrahmungen, Balkongitter und hölzerne Klappläden — mit glücklichstem Takt aufeinander bezogen. Interessant die Zusammenziehung der 3 mittleren Fenstertüren zu einer einheitlichen Arkatur bzw. architravierten Pfeilerloggia (vgl. die Weiterbildung dieses Motivs in G. Becchis Palazzo Santeodoro). Dank der Hanglage ergibt sich hier noch ein Sockelgeschoß; eine Folge von Treppen führt weiter abwärts zu einer brunnengeschmückten Terrasse, die einen weiten Blick über den Golf und die westl. Stadtteile bietet.
Das südlich angrenzende Gelände (heute als »Parco Grifeo« in Privatbesitz und nicht zugänglich) wurde kurz nach 1816 vom König dazugekauft; Niccolini legte hier einen romantisch-wilden »bosco« an und errichtete das reizende dorische »Coffee-house« (Villa Lucia), weiter östl. eine höchst skurrile spitzbogige Brücke über eine Schlucht.
Im späteren 19. Jh. ging die Villa durch mehrere Hände und wurde schließlich zum reinen Spekulationsobjekt. Ihre Rettung wird dem deutschen Zoologen Anton Dohrn (S. 366) verdankt, der 1892 seinen amerikanischen Freund und Gönner Major Davis zum Kauf des schon in Baulose aufgeteilten Grundstücks bewog und sich dafür als »intellektueller Mitbesitzer ... des herrlichen Gartens« fühlen durfte. Einige Jahre später wurde hier eines der
ersten von Ernst Abbe in Jena konstruierten Scherenfernrohre aufgestellt, das Dohrn zum Geschenk erhalten hatte. Nach Davis’ Tod (1913) kam die Villa in Staatsbesitz. Im 2. Weltkrieg schwer verwüstet, wurde sie seither gründlich restauriert.
Der Palast dient heute als Sitz des Museo Nazionale della Ceramica »Duca di Martina«; es ist aus einer in der 2. Hälfte des 19. Jh. von Placido di Sangro, Herzog von Martina, zusammengebrachten Sammlung hervorgegangen, die 1931 dem italien. Staat gestiftet wurde. Ihren Kern bildet eine staunenswert reiche Kollektion erstrangiger Porzellane aus allen europäischen Werkstätten (Obergeschoß); dazu kommen italien., französ. und spanisch-islamische Majoliken, Gläser, Goldschmiedewerke, Elfenbein, Emaillen sowie ausgezeichnete Möbel (Erdgeschoß); eine reiche Sammlung von Ostasiatica — japanisches und bes. chinesisches Porzellan, Bronzen, Lackarbeiten, Jade und Bergkristall (Sockelgeschoß); außerdem Gemälde von Micco Spadaro, Giac. del Pò u. a. In Saal 21 (Erdgeschoß) ein interessanter Christus-Kopf, jetzt dem Marco Cardisco zugeschr. (Anfang 16. Jh.); in Saal 22 eine Miniatur von Giulio Clovio nach Barocci (Grablegung), in einem phantastischen Rokoko-Rahmen mit Einlegearbeit aus Elfenbein, Perlmutt, Korallen und Pietra dura. Einige Räume haben noch hübsche Stuck-und Freskodekorationen des frühen 19. Jh.
Palazzo Fondi (Genzano; Via Medina 24), restaur. nach der Mitte des 18. Jh. von L. Vanvitelli; diesem werden zugeschrieben an der Fassade das prächtige ionische Eingangsportal, im Innern die große 2läufige Treppe zur Rechten des Vestibüls; älterer Bestand zeigt sich in der Gliederung der Schmalseiten des Hofes, mit »Palladio-Motiven« und darüber, an der Rückwand, einer Terrasse mit Loggia auf toskanischen Säulenarkaden.
Palazzo Girifalco (Duca di Girifalco; Via Salvator Rosa 315) von Ferd. Sanfelice. Die prächtige Fassade, von 3 x 3 Achsen, rot verputzt und mit grauen Peperinlisenen gegliedert, ist mit viel Witz der Straßenbiegung eingepaßt: Die Seitenflügel sind schräg nach vorn geknickt, die Mitte in sich nochmals dreifach gebrochen; im Zentrum springt ein polygonales Vestibül vor. Das Innere in seinem jetzigen Zustand ohne Reiz.
Palazzo Giusso (Duchi della Torre; Sitz des Istituto Universitario Orientale; am Largo S. Giovanni Maggiore), erb. 1549. Die 3geschossige Fassade hat eine rein dekorativ aufgefaßte Pilasterordnung; das Portal, mit scheitrechtem Bogen in Rustika, zeigt schon den Einfluß der Theoretiker (Serlio, Vignola). Der Hof ohne Portiken, dafür dem Eingang gegenüber eine 3-Bogen-Gruppe; unerwartet üppiges Treppenhaus zur Linken, mit gegenläufigen Rampenpaaren bis ins 2. Obergeschoß aufsteigen .
Palazzo Gravina (Via Montoliveto 3)
Zwischen 1513 (Grundstückskauf) und 1549 (Vollendung des Daches) für Ferdinando Orsini, Duca di Gravina, errichtet. Ein sonst nicht bekannter Gabriele d’Angelo wird als erster Architekt
genannt; später scheint Giovanni Francesco di Palma mitgearbeitet zu haben. Die (modern erneuerten) Marmorbüsten über den Fenstern des Hauptgeschosses stammen von Vittorio Ghiberti, einem wenig bedeutenden Urenkel des großen Lorenzo. Eine Restaurierung zwischen 1762 und 1772 stand unter Leitung von Mario Gioffredo; nach 1839 wurde der Palast durch allerlei Umbauten verändert, im 20. Jh. soweit als möglich der alte Zustand wiederhergestellt; der Bau beherbergt heute die Architekturfakultät der Universität.
Die Bedeutung der 9achsigen Fassade liegt in dem allerdings folgenlos gebliebenen Versuch, das in Rom von Bramante entwickelte 2-Geschoß-System — ein Piano nobile mit Pilasterordnung über rustiziertem Sockelgeschoß — in Neapel einzuführen. Bemerkenswerterweise hat noch Gioffredo dieses System respektiert, als er sein dorisches Eingangsportal mit größter Zurückhaltung in das Erdgeschoß einsetzte; erst der Umbau des 19. Jh. brachte mit der Anlage eines Mittelbalkons, eines 2. Obergeschosses anstelle der Büstennischen und eines 3. über dem Kranzgebälk eine gewisse »Neapolitanisierung« des Ganzen zustande. Spurlos beseitigt wurde dabei eine monumentale Inschrift im Fries über dem Sockelgeschoß, in welcher der Bauherr mit berechtigtem Stolz seine »cospicuam domum« rühmte, leider ohne eine Jahreszahl mitzuteilen. — In stilistischer Hinsicht hat das Vorbild der röm. Renaissance sich gegen die lokale Gewohnheit nicht durchsetzen können. Trotz des relativ starken Reliefgrades einzelner Elemente (etwa der Rustika-Quadern des Erdgeschosses) wirkt die Konzeption des Ganzen immer noch eher graphisch als plastisch; jene körperhafte Organik, die das Einheitsmoment echter Hochrenaissancebauten bildet, erscheint hier zurückgenommen in starrer Flächendekor; zumal die Pilasterschäfte mit ihren »riquadri« wirken durchaus schmuckhaft und atektonisch. Was die Fassade vom Quattrocento trennt, ist einmal das in allen Verhältnissen durchgehaltene monumentale Format, zum andern ein Ausdruck gemessenen Ernstes, der wesentlich vom Charakter des Steinmaterials bedingt ist: düster grauer Peperin und ein jetzt stark verschmutzter, urspr. aber rein weiß zu denkender Marmor.
Der quadratische Hof von 5 x 5 Achsen ist auf allen 4 Seiten von Pfeilerportiken der in Neapel üblichen Form umzogen (quadratische Pfeiler mit Rahmenfeldern dekoriert); in den Bogenzwickeln Tondi mit Bildnissen von Mit-
gliedern der Familie Orsini. An der Eingangsseite im Obergeschoß noch eine Blendarkatur mit kompositen Pilastern; anstelle zweier Fenster zur Seite der Mittelachsen schöne Muschelnischen, wohl zur Aufstellung von Statuen gedacht.
Die dem Eingang gegenüberliegende Hofwand, mit verdoppeltem Portikus, war bis 1849 1geschossig und gewährte über eine Terrasse den Blick in den dahinterliegenden Garten.
Palazzo Lauriano (Duca di Lauriano; Vico Zuroli 42, zwischen Via Vicaria Vecchia und Via dei Tribunali) hat im Innern ein polygonales Treppenhaus in der Art Sanfelices, von bescheidenen Ausmaßen, aber fein und originell im Detail.
Palazzo Lieto (Via Roma 318), 1754 errichtet und 1794 von Pompeo Schiantarelli umgestaltet; 3achsige Fassade mit hübsch durchgeführter Übereinanderstellung der 3 Ordnungen im Mittelteil.
Palazzo Maddaloni (Via Maddaloni, zwischen Via Roma und S. Anna dei Lombardi, hinter dem Palazzo d’Angri)
1582 gegr. und um die Mitte des 17. Jh. von Cos. Fanzago für den Herzog von Maddaloni, Diomede Carafa, umgebaut; 1943 von Bomben getroffen und schwer beschädigt.
Die 4geschossige Fassade quillt über von Balkons mit bauchig geschweiften Eisengittern und reich verzierten Fensterrahmen; im Zentrum das großmächtige, 2 Geschosse umfassende Eingangsportal mit gebündelten Diamantquaderpilastern und gebrochenem Segmentgiebel, darin vielfaches Rahmen- und Schnörkelwerk. Zur Rechten des nur fragmentarisch erhaltenen Hofes öffnet sich der Zugang zu einer großen gegenläufigen Treppe, gleichfalls von Fanzago. In den Räumen des Piano nobile (der Pförtner führt) eindrucksvolle Ausstattung aus der 2. Hälfte des 18. Jh.: Spiegel, Paneele, Fresken von De Maria, Del Pò, De Mura und Fischetti; von letzterem der Einzug Alfons’ I. in Neapel unter der Decke des 2geschossigen Salone. Von hier aus tritt man auf eine Terrasse über dem rückwärtigen Trakt des Gebäudes, mit einer sehr feinen Säulenloggia aus grau-weißem Marmor, in der Art des Chiostro Grande von S. Martino, alles im Zustand schlimmster Verwahrlosung.
Palazzo Marigliano (Via S. Biagio dei Librai 39)
Erb. 1512/13 von Giovanni Donadio (»il Mormando«) für Bartolomeo di Capua, Conte di Altavilla, später mehrfach verändert.
Die 5achsige Fassade gibt ein gutes Bild von den Fähigkeiten Mormandos, der nach dem Bericht seines Zeitgenossen Pietro Summonte als Orgelbauer begann, sich dann aber der Architektur und der »totale imitazione di cose antique« zuwandte. Zwischen durchlaufendem Basament und Kranzgesims bilden 2 Ordnungen von Pilastern (unten komposit, oben korinthisch) ein regelmäßiges Rahmen-
gerüst, dessen vertikaler Zusammenhang durch Verkröpfung des Zwischengebälks unterstrichen wird; die Fassade wird also noch immer grundsätzlich als Fläche behandelt und nicht (wie in Rom) als Substrat eines scheintektonischen Organismus, dessen einzelne Glieder als »tragend« und »lastend« charakterisiert werden. Dementsprechend ist jedes Wandfeld für sich nochmals mit einer fein profilierten Rahmenleiste umzogen. Neapolitan. Herkommen entspricht die verhältnismäßige Größe und Vielzahl der Fensteröffnungen, welche die Mauerfläche weitgehend aufzehren. Die untere Ordnung umfaßt 2 Geschosse: Urspr. saß über dem Basisprofil jeweils ein quadratisches Fenster, darüber ein weiteres mit Rundbogenabschluß. Das Piano nobile hat eine Reihe großer, schön proportionierter Rechteckfenster; in den Friesen wiederholt sich das Motto des Bauherrn: »Memini«. Um das Portal zog sich urspr., nach Ausweis alter Zeichnungen, eine Rahmung aus 2 unmäßig kurzen ionischen Pilastern mit Gebälkstücken und antikisch profilierter Archivolte; darüber ein Relief mit wappenhaltenden Putti. — Der H o f entstammt einem Umbau vom Anfang des 18. Jh.; an der Rückwand eine hübsche Freitreppenanlage, darüber ein Quertrakt mit Terrasse und einer auf die Wand gemalten Doppelsäulenloggia.
Giovanni Danadio, Palazzo Marigliano, Fassade Via San Biagio dei Librai 39, 1512-1513, 1745, Neapel.
In der Nähe, Nr. 31, der Buchladen (jetzt Bilder-und Rahmenhandlung) des Antonio Vico, Vater des berühmten Philosophen Giambattista Vico (1668-1744), der in der darüberliegenden Kammer geboren wurde und, wie die Inschrifttafel sagt, bei nächtlicher Lektüre die ersten 17 Jahre seines Lebens verbrachte.
Palazzo Monaco (Via Roma 306) hat eine schöne Fassade vom Ende des 18. Jh. mit grauer Lisenengliederung vor gelbem Putz und großen Ädikula-Fenstern mit Büsten in Segmentgiebeln; im Innern ein durch 5 Geschosse aufsteigendes offenes Treppenhaus.
Palazzo Mormando (Via S. Gregorio Armeno 28). Das Wohnhaus des Architekten Giovanni Donadio (»il Mormando«), um 1500 erbaut, hat im Hof rechts eine durch 5 Geschosse laufende Wendeltreppe mit kurzen Läufen und geschlossenem Kern, zum Hof hin geöffnet in jeweils 3 Bögen, mit klassischen Hochrenaissance-Balustern.
Palazzo Orsini (Via dei Tribunali 189) bewahrt das inschriftlich 1471 datierte Portal mit Rundbogen zwischen dünnen Säulchen, immer noch eher katalanisch als renaissancemäßig anmutend; das Innere im 19. Jh. zur Kirche S. Maria del Rifugio umgebaut.
Palazzo Ottaiano (Miranda; Via Chiaia 142), erbaut 1783/84 an Stelle des 1782 niedergelegten Stadttors aus dem 16. Jh. (Porta Chiaia), von Gaetano Barba, wohl nach einem Entwurf Carlo Vanvitellis. Einfache früh-
klassizist. Fassade (nur die unteren 2 Geschosse ursprünglich); die Rückwand des Hofes öffnet sich in voller Breite (Flachbögen) gegen das geräumige Treppenhaus mit der in 3 Abschnitten aufsteigenden Haupttreppe — ein letzter Ausläufer barocker Traditionen (Baluster vom Typ des Palazzo Serra di Cassano, ionische Pilaster und Halbsäulen in der Art L. Vanvitellis).
Palazzo Palmarice (Piazzetta Teodoro Monticelli 1, gegenüber dem Palazzo Penna) ist ein Bau Ferd. Sanfelices mit konvex ausgebuchteter Fassade und großem rundbogigem Rustika-Portal; im Innern eine hübsche offene Spindeltreppe mit dreieckigen Absätzen, bekrönt von einer kleinen Achteckkuppel.
Daneben (Via dei Banchi Nuovi 3) noch ein großer Palast des 18. Jh.
Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri, W-Seite) wurde 1746 von dem jungen Mario Gioffredo für Baldassare Coscia, Herzog von Paduli erbaut, dann von Ferdinand I. erworben, der ihn seiner morganatischen Gemahlin Lucia Migliaccio, Fürstin von Partanna, schenkte. Ein gründlicher Umbau durch den Neoklassizisten Antonio Niccolini, Anfang des 19. Jh., ließ von der Anlage Gioffredos nur das ionische Säulenportal übrig.
Palazzo Penna (Piazzetta Teodoro Monticelli 11, unterhalb von S. Chiara)
Der Erbauer Antonio Penna (sein Grab in S. Chiara, s. S. 82) entstammt einer Familie von Juristen und Verwaltungsbeamten, die seit Robert d. Weisen im Dienste des Königs standen. Die Inschrift über dem Portal nennt als Gründungsdatum das 20. Jahr der Regierung König Ladislaus’, also 1406.
Eines der seltenen leidlich erhaltenen Monumente katalanisch-got. Profanbaukunst. Die fensterlose Front des zum Platz gelegenen Eingangsvestibüls ist mit zierlichem Quaderwerk überzogen; den oberen Abschluß bildet ein Konsolgesims mit Dreipaßbögen und heraldischen Emblemen. Das Portal zeigt in rechteckigem Rahmenprofil die charakteristische Stichbogenöffnung, darin noch die alten hölzernen Türflügel mit maßwerkartiger Schnitzerei. Auf dem um die Öffnung gewundenen Spruchband ein Distichon Martials, das den Bewunderer boshaft abfertigt: »Der du die Miene verziehst und mit Unlust dieses betrachtest / alle beneide du, keiner beneidet dich.« — Im Vestibül noch Teile des alten Kreuzrippengewölbes. Der folgende 1. Hof im 16. Jh. umgebaut; rechter Hand führen ein paar Stufen hinab in den W-Flügel des Urbaus (längs des Pendino S. Barbara) mit interessanten Überresten der alten Struktur: ein großer Hofportikus mit Rundbögen auf Rechteckpfeilern mit Eckdiensten und einer von Querbögen getragenen Holzdecke; rechts 3 fein profilierte Türrahmen.
Villa Pignatelli-Acton (Riviera di Chiaia 256, schräg gegenüber der Zoologischen Station) Den Zugang an der Straßenseite bilden 2 niedrige terrassengedeckte Pavillons, dazwischen verläuft ein Gitterzaun, der kein Tor enthält, dem Vorübergehenden aber einen höchst überraschenden Durchblick bietet: Umstellt von den Häusermassen des neuen Chiaia-Viertels, halb verdeckt vom subtropischen Pflanzenwuchs ihres Parkes, erscheint die weiße Säulenfront der Villa als ein klassizist. Dornröschenschloß, verblassendes Nachbild jenes glücklicheren Neapel, das Veduten und Reiseberichte des frühen 19. Jh. uns überliefern.
Der hinter der Villa aufsteigende Hang war damals noch unbebaut; nur von den Hügelkuppen grüßten links Villa Lucia, weiter rechts die heute verschwundene Villa des Fürsten Carafa di Belvedere. Schon 1825 hatte ein in Neapel residierender Engländer, Lord William Drammond, hier eine Ufervilla geplant: Nach einem Entwurf Giuseppe Giordanos sollte ein 3geschossiger Breitbau entstehen, davor ein offener Gartenhof, eingefaßt von Kolonnaden mit Kopfpapillons im Stil des englischen Palladianismus. Ein Jahr später gelangte das Anwesen in den Besitz von Sir Ferdinand Acton. Dieser stammte aus einer englischen Adelsfamilie, die seit der Mitte des 18. Jh. in Italien ansässig war; wie sein Vater Joseph und sein Onkel John Acton, der berühmte Minister Ferdinands IV., stand auch Sir Ferdinand als Militär und Diplomat im Dienst des Bourbonenkönigs. Sein Architekt war Pietro Valente, der sich beim Wettbewerb für S. Francesco di Paola rühmlich hervorgetan hatte. Er soll für die Villa über 20 Entwürfe gezeichnet haben; auch nach Baubeginn griff der schwer zufriedenzustellende Sir Ferdinand noch in die Planung ein. Das Resultat war ein seltsamer Kompromiß zwischen dem pompejanisch gestimmten Klassizismus der Zeit Ferdinands IV. und der Palladio-Verehrung des Engländers; dazu kam die Tradition der Neapler Villenbaukunst des Barock, die etwa das Motiv der Aussichtsterrasse über einem dem Bau vorgelagerten Hofportikus schon ausgebildet hatte (Palazzo Spinelli di Tarsia, Villa Campolieto in Resina). Als »englisch« erkannten die Zeitgenossen @. a. die von der Straße zurückgenommene Lage des Villenpalastes; übrigens zeigt die Geländesituation auf alten Ansichten gewisse Anklänge an Palladios Villa von Maser.
Die sanft ansteigende Rasenfläche zwischen Straße und Haus wird durch keinen Weg unterbrochen; auch ihre Baumgruppen und Ziersträucher, die man heute bewundert (Araukarien, Palmen, Rhododendren, Magnolien, Kamelien, Hibiskus, Bambus u. a.) gehören nicht zur ursprüngl. Anlage.
Quer vor dem Bau liegt eine Kolonnade aus 2 x 10 dorischen Marmorsäulen, flankiert von tempelartigen Risaliten mit je 2 Säulen, Antenpfeilern und flachen Dreiecksgiebeln; das Ganze um einige Stufen über den Rasenplatz hinausgehoben. Die Säulenreihen bilden den Zugang zu einem von niedrigen Seitenflügeln begrenzten Vorhof; dahinter erhebt sich die 2geschossige Front des Wohngebäudes. Ihr Mittelcorps hat 6 ionische Kolossalpilaster; sie tragen einen großen Giebel, der die Linien der seitlichen Vorbauten aufnimmt. Die (nachträgliche) Einführung dieses Zentralmotivs war ein Einfall des Bauherrn, über den Valente nicht glücklich war; auch von damaligen Kritikern wurde die daraus resultierende Überschneidung von kleiner und großer Ordnung scharf getadelt. Eine tiefgreifende Veränderung dieses Bildes brachte die wohl um 1900 vorgenommene Verglasung des Vorhofs; sie hob den an sich sehr reizvollen Transparenz-Effekt der Fassade weitgehend auf, zerschnitt die fein graduierten Übergänge von Innen- und Außenraum und verwandelte überdies die kühlungverheißende Marmorhalle in eine Art Treibhaus, das im Sommer ganz unerträgliche Temperaturen erreicht.
Die von den Zeitgenossen gerühmte »griechische Delikatesse« Valentes entfaltet sich ungestört an den Flanken des Baues und an der sehr feinfühlig durchkomponierten Rückfassade, durch die man heute ins Innere des Gebäudes tritt. Seine Ausstattung wurde, nachdem Valente sich mit seinem Bauherrn endgültig zerstritten hatte, von Guglielmo Bechi weitergeführt; 1830 war der Bau vollendet.
In den folgenden Jahren bildete die Villa Acton einen Mittelpunkt internationaler Geselligkeit. Nach Sir Ferdinands Tod (1837) kehrte seine Witwe nach England zurück; für die Villa fand sich 4 Jahre später ein Käufer in Karl Meyer v. Rothschild, dem jüngsten der 5 Erben des großen Frankfurter Bankhauses, der seit 1821 als Finanzier des Königs in Neapel wirkte. Rothschild ließ das Innere des Palastes durch einen Pariser Architekten gründlich umgestalten; auch Gaetano Genovese war an den neuen Ausstattungsarbeiten beteiligt. 1861, nach der Abdankung der Bourbonen, verließen auch die Rothschilds Neapel; 1867 kam die Villa in den Besitz der Familie Aragon-Pignatelli-Cortez und gelangte schließlich 1952 durch Stiftung an den italien. Staat.
Seit 1960 ist das Gebäude als Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortez dem Publikum zugänglich. Die Absicht der Stifterin wie der Museumsleitung ging dahin, den reichen Kunstbesitz
der Familie in der Form zur Schau zu stellen, wie er die Räume des Hauses geschmückt hat; so ist auch das wunderliche Gemisch aus den Überresten der klassizist. Ausstattung und dem »zweiten Rokoko« der Rothschild-Zeit nicht angetastet worden. Den wichtigsten Teil der Sammlungen bildet das Porzellan: Serien und schöne Einzelstücke aus Capodimonte, Neapel und den anderen europäischen Manufakturen; feine chinesische und japanische Vasen und Figuren; abruzzesische Majoliken. Vom Anfang des 18. Jh. stammen 2 Marmorbüsten des Papstes Innozenz XII. Pignatelli (1691-1700) und seines Nachfolgers Clemens XI. Albani; von Papst Innozenz noch eine große Bronzebüste aus der gleichen Zeit. Unter den Gemälden verdienen Beachtung 3 Predellenbilder von Giov. Filippo Criscuolo (Mariengeburt, -vermählung und Darstellung im Tempel).
Palazzo Pignatelli (Piazzetta Nilo, N-Seite rechts), um 1500 für Cesare Pignatelli erb.; kleine 3achsige Fassade, die beiden Untergeschosse als Sockel behandelt, darüber ein niedriges Piano nobile mit korinthischen Miniaturpilastern; die Fensterrahmungen barock.
Palazzo Pignatelli-Monteleone (an der Calata Trinità Maggiore 53) verdankt einer Restaurierung durch Ferd. Sanfelice (1718) sein prächtiges Eingangsportal mit Diamantquader-bandagierten Säulen und Kapitellen aus Blattmasken mit ionisch gerollten Haarwülsten; die Säulen sind ganz leicht nach außen gedreht, der oben aufgesprengte Segmentgiebel entsprechend verkantet und in sehr feinen Linienzügen verkröpft.
Palazzo Pignatelli-Strongoli (Riviera di Chiaia 256), ein Doppelpalast des 18. Jh., 1820 von Antonio Niccolini restaur. (Fassade links); in den Höfen große, 5geschossige Treppenanlagen in der Art Sanfelices.
Palazzo Pinelli (Via G. B. Croce 38) wurde 1544/45 von Giov. Fr. di Palma für den genuesischen Bankier Cosimo Pinelli errichtet, später mehrfach verändert. An der Rückwand des Hofes 2 Ordnungen von je 3 schlanken Pfeilerarkaden, dazwischen ein Mezzanin mit kleinen Bogenfenstern; rechts davon die Treppe, hier parallel zur Hofwand angeordnet, so daß die Bogenöffnungen der Absätze jedesmal um ein halbes Geschoß versetzt erscheinen.
Villa Roseberry (Maria Pia; Via Ferdinando Russo) liegt inmitten eines weiten Parkes mit herrlichem Baumbestand auf der Uferbank des Kaps von Posillipo. An Stelle einer Villa des 18. Jh. errichtete Prinz Louis von Bourbon, der Bruder Ferdinands II., 1835 das Casino Reale, einen großen klassizist. Würfelbau mit ionischer Säulenvorhalle, und 2 geräumige Gästehäuser. Gegen Ende des 19. Jh. gelangte die Villa in den Besitz des ehem. britischen Premierministers Archibald Philip Primrose, Graf von Roseberry; seit 1932 gehört sie dem italien. Staat und steht jetzt dem Präsidenten der Republik zur Verfügung.
Palazzo Sanfelice (Via Arena della Sanitär 2-6)
Von Ferdinando Sanfelice 1728 als Wohn- und Mietshaus für die eigene Familie errichtet; ein Zeugnis bürgerlichen Wohlstandes ans
dem Neapel des Settecento, heute traurig verwahrlost und wie das ganze Stadtviertel zum Armenquartier herabgesunken.
Die Fassade des Doppelpalastes präsentiert sich im großen Stil: 8 Fensterachsen, 3 Risalite, 2 Portale in Diamantquader-Rustika, mit paarweise angeordneten Seejungfrauen einladend geschmückt; Lisenen und Horizontalgesimse bilden ein durchgehendes Feldernetz, feines Stuckrahmenwerk von vielfach wechselnder Gestalt umzieht die Fenster, vom Obergeschoß blickt eine Reihe von Büsten herab. Das rechte Portal (Nr. 6) führt durch ein oblonges Vestibül — am Gewölbe verkündet noch eine verblassende Fama den Ruhm des Künstlers — in den längsrechteckigen Haupthof. Eingangs-und Langseiten bilden geschlossene Fensterfronten, immer mit feinstem Stuckdekor. Die Rückwand aber ist in ganzer Breite gegen das Treppenhaus geöffnet, das zu den prächtigsten Anlagen seiner Art in Neapel zählt. 2 symmetrisch angeordnete Spindeltreppen mit offenen Kernen, in je 4 geradlinig geführte Läufe von wechselnder Stufenzahl unterteilt, steigen durch die 3 Stockwerke auf; dabei liegen die Wohnungseingänge an den seitlichen Zwischenpodesten, während die Mittelabsätze, in denen die Treppenarme wieder zusammenkommen, jeweils die halbe Geschoßhöhe bezeichnen. Die Schauwand zum Hof ist dementsprechend in 5 vertikale Streifen zerlegt. Im Mittelfeld öffnen sich breite, in den Seitenfeldern schmale Arkaden, die mit den auf verschiedenen Niveaus liegenden Absätzen korrespondieren; die Zwischenfelder, den seitlich aufsteigenden Treppenläufen zugeordnet, haben Fensteröffnungen von der Form schräg verzogener Rechtecke (Parallelogramme) mit ausgerundeten Ecken. Das gleiche Schema wiederholt sich an der Rückwand des Treppenhauses, durch deren Öffnungen man den Ausblick in das dahinterliegende Gärtchen genießt. Die Bögen sind hier, im Vergleich zur Vorderwand, in der Höhe versetzt, die Richtung der Schrägen in den Zwischenfeldern vertauscht, so daß sich vom Hof aus die vielfältigsten Perspektiven ergeben. Gewölbe und Bogenlaibungen, die gleichfalls in ständig wechselnden Konstellationen erscheinen, sind durch einfache breite Rahmenbänder gegliedert; die fein gedämpfte Farbigkeit — weiß gegen schiefergrau, entsprechend dem Marmor-und Schieferbelag des
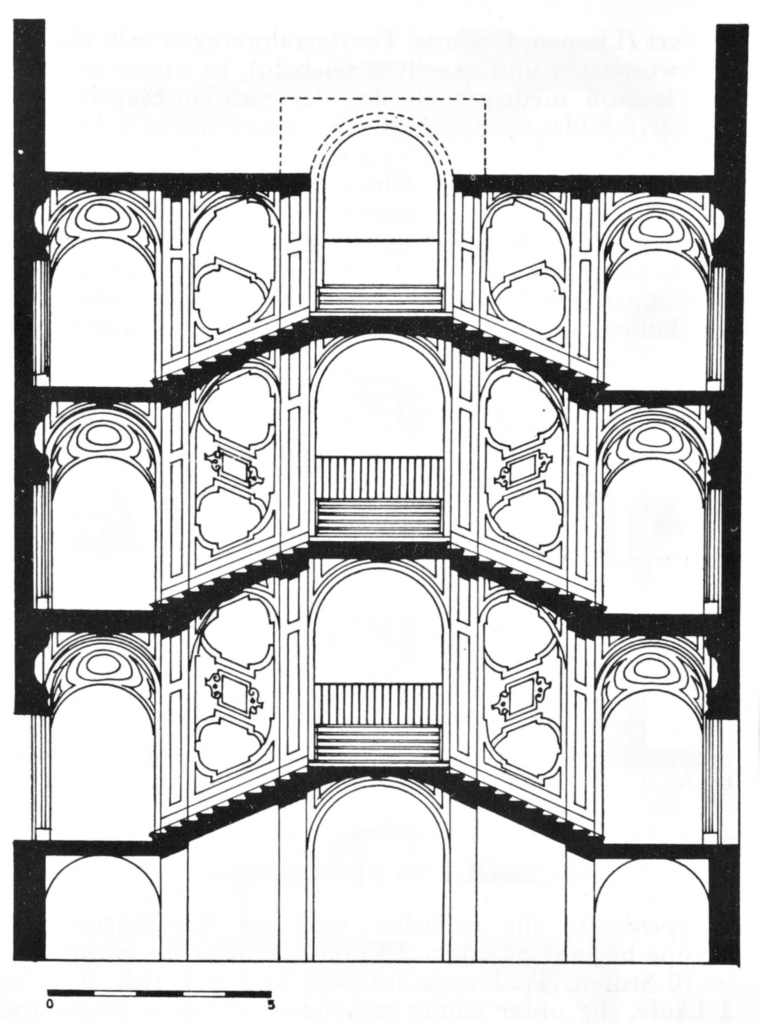 Palazzo Sanfelice (Nr. 6). Treppenhaus, Querschnitt
Palazzo Sanfelice (Nr. 6). Treppenhaus, Querschnitt
Fußbodens — wird durch die reichlich einfallende Mittagssonne zu schönster Wirkung gebracht.
Ferdinando Sanfelice, Entwurf für den Eingangsbereich des Palazzo Sanfelice, 1562, Bleistift, Museo e Gallerie Nazionali di
Capodimonte in Neapel.
Der Nachbarpalast zur Linken (Nr. 2) ist auf einen etwas bescheideneren, sozusagen privaten Ton gestimmt. Der Hof, allseitig geschlossen und wieder mit feinem Stuck
verziert (Lisenen, Gesimse, Fensterrahmungen mit vielfach geschwungenen und gerollten Giebeln), ist enger und um ein Geschoß niedriger als der des rechten Flügels. Sein Grundriß bildet ein Quadrat mit abgeschrägten Ecken, das aber leicht in die Länge »verzogen« ist (vgl. hierzu den Grundriß von Vaccaros Chiesa della Concezione); man kann die Längswände zusammen mit den Schrägen als zweimal geknickte 3achsige Fronten auffassen, während Eingangs- und Rückwand jeweils in 2 Achsen unterteilt sind.
Der Eingang ist dementsprechend aus der Mitte nach rechts verschoben. Ihm gegenüber öffnet sich der Zugang zum
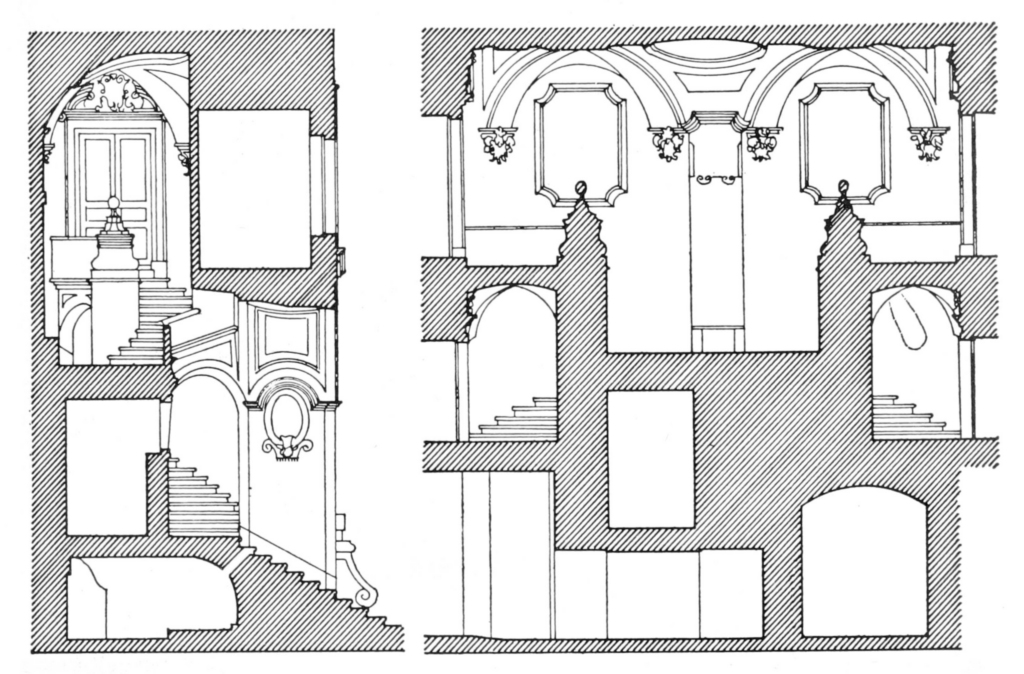 Palazzo Sanfelice (Nr. 2). Treppenhaus, Schnitte
Palazzo Sanfelice (Nr. 2). Treppenhaus, Schnitte
Treppenhaus: ein einfacher niedriger Rundbogen; die Treppe beginnt zwischen 2 Volutenwangen im Hof, führt in 10 Stufen geradewegs aufwärts und teilt sich dann in 2 Läufe, die unter schräg stehenden seitlichen Bögen geheimnisvoll im Innern des Gebäudes verschwinden. Erst beim Hinaufgehen entpuppt sich die singuläre Struktur einer Zwillingswendeltreppe, die das distributive Schema des großen Treppenhauses zur Rechten ins Intime abwandelt und dabei auf kleinstem Raum einen fast unglaublichen Reichtum an Formen und Perspektiven bietet. Das Grundrißbild ließe sich etwa mit einer Brezel vergleichen:
 Palazzo Sanfelice (Nr. 2). Treppenhaus, Grundrisse
Palazzo Sanfelice (Nr. 2). Treppenhaus, Grundrisse
Aus den Seitenarmen entwickeln sich 2 um geschlossene Spindeln kreisende Rundtreppen, unterteilt in Abschnitte von je 5 Stufen und dreieckige bzw. im Mittelteil rautenförmige Podeste. Wiederum gehen die Türen der Apparte-
ments von den Außenseiten ab, während die mittlere Plattform, auf der die Kreise miteinander kommunizieren, in halber Höhe zwischen den Geschossen liegt. Eine beinahe dramatische Note erhält das Ganze durch die von Absatz zu Absatz wechselnde Lichtführung, deren technische Einzelheiten der Besucher an Ort und Stelle studieren mag.
Der entscheidende Überraschungseffekt liegt darin, daß die unteren Läufe je für sich abgeschlossen unter schraubenförmig gewundenen Ringtonnen aufsteigen; hat man aber die erste Kreisbahn durchmessen und den Mittelpodest erreicht, so öffnet sich ein beide Hälften der Anlage umfassendes Treppenhaus: Die Spindeln enden in dicken, mit Messingkugeln bekrönten Knäufen; die Treppenarme, nun freiliegend, beschreiben noch je eine halbe Drehung, um dann vor den Wohnungstüren des 2. Stockwerks ihr Ziel zu finden. Das Gewölbe ist aus mulden- und halbtonnenförmigen Kappen zusammengesetzt; über dem geraden Mittelteil schwebt in leicht schiefer Lage eine kleine kreisrunde Flachkuppel, während die seitlichen Rundräume von diagonal gekreuzten Gurtbändern mit tiefen Stichkappen überspannt werden. Der Verputz ist einheitlich weiß, die Dekoration beschränkt sich auf sparsam verteilte Profilleisten, Kartuschen und Konsolen mit Stuckornamenten von schon rokokohafter Feinheit. Vom Standpunkt der heutigen Architektur wäre der beachtliche funktionelle Nutzwert der Anlage zu betonen, die nicht zuletzt für Zank- und Klatschkomödien im Stil Goldonis eine ideale Simultanbühne abgeben würde; Mathematiker mögen sich das Vergnügen gönnen, Zahl und Verlauf der möglichen Wege zwischen dem Eingang und den 4 Wohnungen zu berechnen.
Palazzo Sangro, Duchi di Casacalenda (Piazza S. Domenico 17)
1766 von Mario Gioffredo erb. und bald darauf von Vanvitelli umgestaltet.
Die etwas trocken und klobig wirkende, aber durchaus originelle Fassade, wohl in der Hauptsache dem Gioffredo gehörig, besitzt 8 Achsen und 2 symmetrisch angeordnete Portale (das linke blind); im Untergeschoß rustizierte Blendbögen, darüber eine 2 Stockwerke umfassende Ordnung von Michelangelo-Pilastern (ionische Kapitelle
mit Festons), zwischen diesen eckig gebrochenes Rahmenwerk, das die Fenster-Ädikulen an die Fläche bindet. — Der Umbau des Hofes durch Vanvitelli scheint veranlaßt durch den Wunsch, eine Serie röm. Säulen, die man beim Ausheben der Fundamente gefunden hatte, in gebührender Form zur Schau zu stellen. Sie erscheinen zunächst in den Seitenwänden des Hofes zwischen je 3 seichten, flachbogigen Nischen; 4 weitere Säulen gliedern die Wände des Treppenvestibüls, das die Rückseite des Hofes einnimmt und sich in voller Breite mit einem einzigen Flachbogen gegen den Hofraum öffnet. Zwischen den ausgerundeten Stufen der seitlich ansetzenden Treppenläufe wölbt sich die Wand dem Beschauer entgegen; ein kompliziertes Kappengewölbe überspannt den überaus reizvollen Raum. — Die Deckenfresken von Fischetti wurden 1950 in das Museum von Capodimonte verbracht (Säle 87, 89, 95).
Palazzo Sangro, Duchi di Torremaggiore (Principe di Sansevero; Piazza S. Domenico 9), erb. Anfang des 16. Jh., restaur. 1621 von Bartolomeo Picchiatti und Vitale Finelli; 1943 durch Bomben beschädigt. Picchiatti entwarf die kolossalen »Bugnato«-Gliederungen am Portal, im Vestibül und im Hof; für Raimondo del Sangro, den Erbauer der berühmten Cappella Sansevero, schuf Gius. Sammartino im Vestibül Stuckreliefs mit mythologischen Szenen.
Palazzo Sangro, Duchi di Vietri (Corigliano Saluzzo; Piazza S. Domenico 12) wurde Anfang des 16. Jh. von Giov. Donadio für Giovanni del Sangro errichtet, 1688 und 1850 durchgreifend restauriert. Die 7achsige Fassade zeigt in den beiden Untergeschossen noch die dorisch-korinthische Pilasterordnung des ersten Baues; das 3. Geschoß erst später hinzugefügt. Im Innern einige Säle mit guten Stuckdekorationen, derzeit wegen Baufälligkeit geschlossen.
Palazzo Santeodoro (Riviera di Chiaia 281) Von Guglielmo Bechi 1826 erb., gibt der Palast auch noch in seinem gegenwärtigen Zustand den glücklichsten Begriff vom neapolitan. Wohnbau des frühen 19. Jh. Bechi habe hier, so berichtet ein Zeitgenosse, »einen Stil erproben wollen, den er selbst als pompejanisch, d. h. der Manier der Griechen zuneigend bezeichnete«. Sein erstes Merkmal ist der Verzicht auf den traditionellen Hochbau zugunsten freizügigster Breitenentwicklung, das zweite ein neuer Sinn für die Fläche, in dem Bechi sich mit den fortschrittlichsten Tendenzen des europäischen Klassizismus trifft; möglicherweise hat Schinkel, als er sich 1824 in Neapel aufhielt, den Palast schon im Bau gesehen und daraus Anregung für sei-
nen »Neuen Pavillon« in Charlottenburg geschöpft (vgl. S. 92).
Von der rot verputzten Fassade hebt sich in ehemals leuchtendem Weiß das Netzwerk der Gliederungen ab. 3 über die ganze Front hin laufende Gebälke — dorisch — ionisch — korinthisch — markieren die Stockwerke. Im Mittelteil ist eine 3achsige Loggia ausgespart: Zwischen je 2 in die Wandflucht gestellten Säulen öffnet sich unten das Atrium; oben sind die betreffenden Felder in vollem Umfang verglast und mit hölzernen Klappläden abgeschirmt (das Vorbild Niccolinis Villa Floridiana). Die Seitenflügel haben in jedem Geschoß 5 Fenster, zu Gruppen von 1 — 3 — 1 Achsen zusammengeordnet; eine leichte Verschiebung der Gruppenzentren nach außen (d. h. aus den Symmetrieachsen der Flügel heraus) stellt die Beziehung der Seitenteile zur Mitte her und bringt den übergeordneten Rhythmus des 3teiligen Grundschemas auf subtile Weise zur Geltung. Das Detail ist von wohltuender Klarheit und Schärfe, durchweg auf rein lineare Wirkung abgestellt, so daß auch bei höchstem Mittagslicht nur ganz dünne Schattenkanten entstehen; besonders reizvoll die anmutig-strengen eisernen Balkongitter.
Das Innere ist vielfach verändert, so daß von dem urspr. Grundriß kein rechtes Bild zu gewinnen ist. Die 2 seitlich angeordneten Höfe sind rückwärts durch eine Wagendurchfahrt verbunden; zwischen ihnen liegt ein in die Tiefe führender Mitteltrakt, der die zum 1. Stockwerk hinaufführende Prunktreppe enthält (bis zur halben Höhe ein gerade aufsteigender Mittellauf, dann 2 parallel zurückführende Seitenläufe, mit hellfarbiger Marmor- und Stuckdekoration, darüber ein großes oblonges Oberlicht). Ferner finden sich zahlreiche Nebentreppen im ganzen Gebäude verteilt, so daß die Appartements der verschiedenen Geschosse jeweils für sich zugänglich sind. Die Räume des Piano mobile sollen die alte Ausstattung bewahren, werden aber streng verschlossen gehalten.
Palazzo Satriano-Ravaschieri (Riviera di Chiaia 287) wurde lt. Wappeninschrift über dem Portal 1605 erbaut und um die Mitte des 18. Jh. von Ferd. Sanfelice erweitert; von diesem die Obergeschosse mit ihren Balkönchen und den büstengeschmückten Fenstergiebeln. »Bauart die bekannte heitere neapolitanische, so auch die Färbung« — mit diesen Worten charakterisiert Goethe den Palast in einer der inspiriertesten Episoden der »Italienischen Reise«‚ dem Souper beim »Prinzeßchen« Teresa Fieschi Ravaschieri, geb. Filangieri (s. S. 304), deren bizarre Persönlichkeit dem Dichter noch im Alter lebhaft gegenwärtig war. Heute ist das Innere durch vielfältige Umbauten verwüstet, nur noch das geräumige Treppenhaus rechts vom Eingang teilweise erhalten.
Palazzo Scorziatis (Vico Cinquesanti 10, rechts neben S. Paolo Maggiore) hat ein schönes marmornes Renaissanceportal (ca. 1490); die flankierenden
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Palazzo Carafa di Maddaloni. Portal (1466)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Palazzo Donn’Anna (C. Fanzago). Radierung von L. Germain nach Hubert Robert (1781)
Säulen sind spätere Zutat (1. Hälfte 16. Jh. ); aus der gleichen Zeit Reste einer monumentalen Pfeilerarkade im Hof. Der erste Bauherr Giulio de Scorziatis war einer der wichtigsten Ratgeber Ferrantes I. von Aragon.
Palazzo Serra di Cassano (zwischen Via Monte di Dio 12 bis 15 und Via Egiziaca a Pizzofalcone)
1725/26 von Ferdinando Sanfelice erb., nach dem Tode des Herzogs unvollendet geblieben und neuerdings restaur.‚ ist der Palazzo der anspruchsvollste Profanban dieses sonst eher dem bürgerlichen »barocchetto« zuneigenden Meisters.
Die Fassade hat 16 rhythmisch angeordnete Achsen und 2 Portale, ein Typus, dessen reiche Variationsmöglichkeiten damals bes. in Oberitalien erprobt wurden. Sanfelice zieht hier die äußerste Konsequenz durch die Wahl einer geraden Zahl von Fensterachsen, so daß im Zentrum ein leeres breites Wandfeld zu stehen kommt. Es wird gerahmt von 2 eng gestellten 3-Fenster-Gruppen, die zusammen das Mittelcorps der Fassade bilden. Die folgenden Achsen, welche die Portale enthalten, sind durch flache Risalite mit korinthischen Kolossalpilastern hervorgehoben; daran schließen sich wiederum 3achsige Flügel, nun aber mit weiten Fensterabständen; an den Flanken endlich wiederholen sich Risalitbildung und Pilasterstellung. Die Erdgeschoß-Rustika und die sehr einfachen Fensterrahmungen (mit alternierenden Giebeln) sind auf zarteste Flächenwirkung abgestimmt, die Fenster in flache Putzfelder eingespannt, die Balkons mit vielfach geschwungenen, aber ganz ornamentlosen Eisengittern versehen; besonders hübsch die Kurvung der Hauptbalkons über den beiden Portalen.
Der Eingang zur Linken (rechts nur ein Scheinportal) führt durch einen langgestreckten Pfeilerportikus in das Treppenhaus, das selbst im treppenfreudigen Neapel einen besonderen Rang beanspruchen darf. Der Typus der in einem überwölbten Saal aufsteigenden doppelläufigen Freitreppe, deren Arme nach mehreren Wendungen über einem mittleren Durchgang zusammentreffen, ist auch im deutschen Schloßbau jener Jahre anzutreffen (Pommersfelden, Ebrach — als Vorstufe gilt Perraults Louvre-Entwurf). Die Besonderheit liegt hier darin, daß die Treppenantritte unter dem Mittelbogen plaziert sind und die unteren Treppenabschnitte rückläufig geführt werden, so daß man auf halber Höhe des Anstiegs eine 180°-Wendung zu beschreiben hat.
Vom Standpunkt der zeitgenössischen Architekturtheorie
wäre dies fehlerhaft, insofern der Besucher die Anlage nicht mit einem Blick übersieht und den Anfang der Treppe erst suchen muß. Es ist aber zu bedenken, daß der Mittelgang hier als Wagendurchfahrt angelegt ist; der Ankömmling entstieg also erst am Fuß der Treppe seiner Karosse, die dann durch den anschließenden Portikus in den rechter Hand liegenden Remisenhof weiterfuhr. Tatsächlich ist die Perspektive des Ganzen für die Einfahrt zu Wagen berechnet, die von der etwas tiefer gelegenen Via Egiziaca aus erfolgte. Die dortige Rückfront des Baues zeigt eine einfache 7achsige Rustika-Architektur; ihr enormes Bogenportal führt direkt in die Cour d’honneur, einen Hof von quadratischer Grundgestalt, mit abgeschrägten Ecken, dessen Rückwand sich in einer zweiten, noch höheren Bogenstellung zwischen ionischen Kolossalpilastern gegen das Treppenhaus öffnet. Denkt man sich die moderne Verglasung weg, so geht der Blick vom Eingang her direkt auf die Treppe und die darüber sich auftuende Tür des Festsaals — mit der Wagenauffahrt im Hof und dem Zug der Gäste die Treppe hinauf ein glänzendes Bild neapolitan. Adelsfeste des Rokoko.
Die architektonischen Einzelformen sind verspielt bis zur reinen Burleske. Im Treppenhaus eingerollte Bogenlaibungen, Riesenvoluten und krauses Blattwerk; die Baluster der Treppenläufe folgen in ihren Profilen nicht nur der Schräge des Anstiegs, sondern sind obendrein noch in die Diagonale gedreht, wodurch ganz bizarre Winkel zustande kommen. Das Gewölbe über der Treppe hätte wohl ausgemalt werden sollen. In den leider versperrten Sälen des Piano nobile sollen sich noch einige Fresken von Giacinto Diana befinden.
Palazzo Sirignano (Via Medina 47) bewahrt von der urspr. Struktur (1. Hälfte 16. Jh.) ein schönes Portal mit dorischem Gebälk auf Halbsäulen, alles mit reichstem Reliefschmuck überzogen, mit starken Anklängen an die Arkaden von S. Maria delle Grazie. Der Rest wurde im 19. Jh. umgebaut.
Palazzo dello Spagnuolo (Via delle Vergini 20), einer der prächtigsten Wohnpaläste Sanfelices. Die Fassade, zu 7 Achsen und 5 Geschossen, ist lachsrot und grau verputzt und mit üppigstem Rokoko-Stuck verziert. Das Treppenhaus nimmt als 5achsige Loggienwand die ganze Rückseite des gleichfalls reich dekorierten Hofes ein. Es entspricht in
Typus und Detailbildung ziemlich genau dem des großen Palazzo Sanfelice in der nahe gelegenen Via Arena della Sanità; einen besonderen Akzent setzt hier der in Resten erhaltene farbige Anstrich (blau, weiß und orange — schönstes Licht am frühen Nachmittag).
Rechts nebenan (Nr. 25) ein weiterer, etwas einfacherer Palast des gleichen Stils, mit Treppe vom herkömmlichen Typus. — Ein anderes Settecento-Treppenhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Nr. 56.
Palazzo Spinelli di Laurino (Via dei Tribunali 362)
Um 1500 erb. und 1767 durchgreifend umgestaltet; eine Inschrifttafel im Treppenhaus nennt Troiano Spinelli, Herzog von Laurino, ausdrücklich als Erfinder der barocken Anlage.
Vom ersten Bau stehen noch die sehr einfache Fassade, mit klassischem Portal in dorischer Rustika, und das zierliche ehemals offene Treppenhaus zur Linken des Eingangs. Das 1. Vestibül hat 2 ovale Flachkuppeln. Es folgt ein prächtiger, wenngleich durch Ein- und Umbauten trostlos entstellter Rundhof nach dem Vorbild von Vignolas Farnese-Schloß zu Caprarola. Der dort kreisförmige Grundriß ist hier durch die Einfügung eines geraden Wandabschnittes in der Querachse leicht in die Tiefe gestreckt, die Zahl der Pfeiler und Öffnungen von 10 auf 8 reduziert.
Im Untergeschoß durchgehender Quaderputz; die Pfeiler haben Rechtecknischen, die Bogenzwickel Ovalmedaillons mit Stuckreliefs; darüber eine ionische Pilasterordnung in fortlaufender »rhythmischer Travée«, das Kranzgesims bekrönt von fragmentarisch erhaltenen Terrakottafiguren. Es folgt in der Längsachse ein weiteres Vestibül, mit 2 querovalen und einer kreisrunden Flachkuppel; zur Linken öffnet sich eine (für neapolitan. Verhältnisse) nicht große, aber hochkomplizierte Treppenanlage. Der Grundriß ist halbkreisförmig; dabei fällt die Sehne mit der linken Längsseite des Palastgrundstücks zusammen, während der Bogen die (entgegengesetzte) Krümmung der Hofwand tangiert. Vom Scheitel des Bogens aus steigt die Treppe unter einer 3fachen Säulenarkatur zunächst geradlinig gegen das Zentrum des Halbkreises auf, teilt sich dann in 2 seitlich auseinanderführende Läufe und kehrt endlich entlang der Halbkreiswände zur Mitte zurück; die erwähnte Bogenstellung trägt das oberste Treppenpodest, das den Zugang zum Piano nobile vermittelt. Ein kleines offenes Treppchen links oben führt wei-
ter aufwärts. Den Schmuck des Treppenhauses bilden Stuckfiguren von Damen aus dem Hause Caracciolo und ein allegorisches Fresko: »Eruditio« und »Pietas« flankieren die »pulchra domus« des stolzen Besitzers.
Palazzo Spinelli di Tarsia (zwischen Salita Tarsia und Salita Pontecorvo, westl. der Piazza Dante) Eines der glänzendsten Projekte des neapolitan. Rokokomeisters D. A. Vaccaro, das aber unvollendet blieb und von dem sich nur vielfach veränderte Überreste erhalten haben.
Die zwischen 2 gewölbten Straßendurchfahrten sich Öffnende Piazza Tarsia stellt die ehem. Cour d’honneur der Anlage dar. An der nach S gelegenen Talseite erkennt man die alte Einfahrt, mit 3 Bögen über konvex einschwingendem Grundriß; gegenüber erhebt sich der im 19. Jh. restaurierte Hauptpalast, ein gewaltiger Bau von 15 Fensterachsen. Die urspr. Dekoration der Fassade hob 2achsige Flügel-und ein 3achsiges Mittelrisalit hervor; dem links von der Mitte liegenden Portal entsprach ein Gegenstück auf der rechten Seite; im Innern sind noch ein 3teiliges Pfeilervestibül und das rechter Hand aufsteigende Treppenhaus zu sehen. Ein 1739 datierter Stich zeigt die Außenfronten mit reichstem Stuckornament übersponnen, das Mittelcorps bekrönt von einem allseitig offenen Belvedere. Die 1geschossigen Flügel rings um den Hof trugen flache Dachterrassen mit Statuenbalustraden, Blumenvasen, Wasserspielen und Fliesen aus bunt bemalter Majolika; von ihnen aus konnte man auf die gleichartig ausgestatteten Dächer der südl. angrenzenden Wirtschaftsgebäude hinabsteigen. Vaccaro selbst schildert (im Text des genannten Stiches) die von hier zu genießende Aussicht »auf eine große Stadt, ein Stück des Meeres, ein von Palästen, Städten und Villen bedecktes Ufer, einen flammenspeienden Berg und einen seitwärts aufsteigenden Hügel mit Gebäuden und einer Burg auf seinem Gipfel«. Auf dem südl. angrenzenden Gelände erstreckten sich 2 große Gartenparterres. An ihrem unteren Ende (Via Tarsia) befand sich das Gartentor; 2 seitlich ausschwingende Rampen — »breit genug für fünf nebeneinander fahrende Kutschen« — führten von dort aus zur Hofeinfahrt empor. Zwischen ihnen gedachte Vaccaro einen Fisch- und Gondelteich mit einer figurengeschmückten Fontäne anzulegen; dahinter sollten sich eine Frei-
treppe und eine große Voliére erheben, während unter den Auffahrtsrampen noch je 8 veritable Raubtierkäfige Platz gefunden hätten. Was von all diesen Plänen realisiert wurde, bedürfte genauerer Untersuchung. Die Guiden des 18. Jh. rühmen stets den »famoso giardino« des Fürsten Tarsia, verweilen dann aber hauptsächlich bei seiner staunenswerten Bildergalerie und der berühmten, von Gelehrten aus aller Welt aufgesuchten Bibliothek und naturwissenschaftlichen Instrumentensammlung.
Am oberen Ende der Salita Tarsia (Nr. 47) ein anderer Settecento-Palast mit üppigem Pfeilervestibül und einem kleinen, zur Straße hin in 3facher Bogenstellung sich öffnenden Treppenhaus.
Palazzo Stigliano (Zavallos, heute Banca Commerciale; Via Roma 185), wahrscheinl. vor 1647 von Fanzago erb.; davon erhalten das Portal in hispanisierendem Prunkstil (ionische Pilaster mit Diamantquader-Rustika, obenauf Vasen, Festons und Wappenkartuschen); im großen Schalterraum des Erdgeschosses die Hofarchitektur, unten wuchtige Pfeilerarkaden, darüber ein Fenstergeschoß mit kompliziert verschachtelten Rahmungen.
Palazzo Tappia (Duchi di Regina Capece-Galeota, Montemiletto; Via Roma 148), errichtet 1568 nach einem Entwurf von Giovanni Francesco di Palma, 1823 von Stefano Gasse vollständig umgebaut. Die Fassade sympathisch bescheiden, mit hübschem, von einem Lorbeergewinde umzogenen Portal; der Hof hat ein geräumiges offenes Treppenhaus, leider durch Verglasung und Fahrstuhl um seine Wirkung gebracht.
Palazzo Traetta (Via dei Tribunali 175), ein kleiner, leidlich erhaltener Palast aus der Zeit um 1500; an der Fassade rhythmisch geordnete Fensterachsen und ein großes Rundbogenportal mit Rustika-Fassung und Balkon (die anderen Balkons neu); an der Hofrückwand eine 3bogige Pfeilerloggia, links ein besonders hübsches Treppenhaus mit längs aufsteigenden Läufen, Bogenöffnungen und Balustraden.
Palazzo di Venezia (Via Benedetto Croce 19) wurde 1412 von König Ladislaus der Republik Venedig geschenkt und bildete seitdem den Sitz des venezianischen Gesandten. Der enge, aber sehr reizvolle Hof erhielt seine jetzige Gestalt bei einem Umbau von 1610 (Inschrift); die Rückwand ist als 3bogige Loggia mit zurückspringender Terrasse ausgebildet, die in eine Exedra ausläuft. Der Restaurierung von 1818 dürfte das links vom liegende zierliche Treppenhaus angehören, mit offener Spindel, geraden Laufen und Kreuzgewölben auf schlanken Pfeilern, durch 5 Stockwerke hochgeführt und noch nicht durch einen Aufzug entstellt.
Das folgende Kapitel enthält profane Monumente verschiedener Art, die in der vorangehenden Kategorie keinen Platz gefunden haben: Burgen und Schlösser, diverse Nutzbauten, Brunnen, Stadttore, Platz- und Parkanlagen. Die alphabetische Reihenfolge geht von den gebräuchlichen italien. Bezeichnungen aus (castello, fontana, porta etc.).
Weitere öffentliche Plätze und Monumente, wie etwa die berühmten »Guglien«, sind unter den zugehörigen Kirchen aufgeführt (S. Angelo a Nilo, S. Croce al Mercato, S. Domenico Maggiore, S. Francesco di Paola, S. Gennaro, Gesù Nuovo, S. Maria di Portosalvo). Die Baugeschichten des Schlosses von Capodimonte und des Palazzo degli Studi (Archäologisches Nationalmuseum) findet man im Kapitel »Museen«; von den Resten der antiken Stadt ist in der Einleitung die Rede.
Hauptsehenswürdigkeiten: Castel Nuovo (15. Jh.), S. 330; Triumphbogen (Pietro da Milano, Fr. Laurana u. a. m.), S. 335; Sala dei Baroni (Sagrera), S. 342 — Fontana del Nettuno (Naccherino, P. Bernini, Fanzago), S. 351 — Palazzo Reale (D. Fontana), S. 354; Treppenhaus (Picchiatti, Genovese), S. 357; Bilder (Ribera, Stanzione, Preti u. a.), S. 359 f. — Porta Capuana (G. da Maiano), S. 362 — Zoologische Station, Fresken (Marées), S. 366.
Albergo dei Poveri (Piazza Carlo III. / Via Foria)
Schon in seinen ersten Regierungsjahren (1736) faßte Karl [II. den Gedanken, nach dem Vorbild anderer italien. Städte (Genua, Rom) ein staatliches Armenhaus einzurichten, in dem Waisenkinder und Alte, Obdachlose und Arbeitsscheue Unterkunft finden und womöglich nützlicher Tätigkeit zugeführt werden sollten. Zunächst freilich verschlangen die übrigen Bauvorhaben des Königs alle verfügbaren Gelder. Auch nachdem der Bau 1751 endlich in Gang gekommen war, hatte der mit der Planung beauftragte Fuga noch lange und intrigenreiche Kämpfe gegen Vanvitelli auszufechten, dessen Caserta-Projekt das ganze Interesse des Königs gefangennahm; ängstlich waren die beiden Rivalen darauf bedacht, ihre Pläne voreinander geheimzuhalten und sich gegenseitig über ihre
Größe zu beschwindeln. 1764 konnten die ersten Insassen einziehen; trotzdem bedurfte es noch mehrerer, bis 1819 sich hinziehender Baukampagnen, um wenigstens die Straßenfront des Gebäudes fertigzustellen. Dabei war der Entwurf schon z. Z. des Baubeginns wesentlich reduziert worden. Urspr. dachte man an ein Rechteck von ca. 600 x 135 m Seitenlänge, in dessen Innerem 5 quadratische Höfe sich aneinandergereiht hätten; im Ausführungsplan wurden die äußeren Höfe weggelassen, wodurch die Länge der Front auf das immer noch stattliche Maß von 354 m zurückging.
Das Raumprogramm — Schlafsäle, Werkstätten, Schulen, Büros und eine im Zentrum liegende Kirche mit Langschiff und rundem Mittelraum — ist im wesentlichen dem genuesischen Vorbildbau entnommen (beg. 1654 von Stefano Scaniglia); neu sind demgegenüber die entschiedene Breitenentwicklung (in Genua quadratischer Außenumriß in 4 Unterquadrate aufgeteilt) und v. a. die von Fuga ersonnene Disposition des Haupthofes mit windmühlenartig sich kreuzenden Zwischentrakten, die von den 4 Ecken aus auf die Kirchenrotunde zuführen. Dies alles ist aber nicht über die Fundamente hinaus gediehen, und die Wirkung des Ganzen läßt sich nur mehr anhand der Fassade beurteilen. Ihre wahrhaft abnorme Fläche (6 Geschosse und Attika, 61 Fensterachsen) hat Fuga mit Lisenen und Flachrisaliten großzügig rhythmisiert. Hervorgehoben sind jeweils die 4 äußeren Achsen sowie eine 15achsige Mittelgruppe; aus dieser werden nochmals 3 Felder ausgesondert und mit einem Giebel bekrönt, über dem, von weitem gesehen, die Kuppel der Kirche zum Vorschein gekommen wäre. Eine weitgespannte Freitreppenanlage mit seitlich ausbiegenden Rampen (zum Typus vgl. die Treppe vor S. Paolo Maggiore) führt vom Straßenniveau zum Hauptgeschoß empor; dort öffnen sich 3 große Bögen zu einer Vorhalle mit strenger und vornehmer Innengliederung (helle Rahmungen vor dunklem Grund, Tür-und Nischengehäuse mit gesprengten Segment- und Dreiecksgiebeln).
Auf sonstigen dekorativ-allegorischen Überbau (Statuen, Wappen, Sinnsprüche u. dgl.) hat der Auftraggeber verzichtet: Unverblümt stellt sich in den endlosen Reihen gleichförmig gerahmter Fenster der Kasernencharakter des Bauwerks dar. So hat auch der Volksmund den patriarchalisch-einladenden Titel »albergo« seit je ignoriert und spricht stattdessen schlicht vom »reclusorio« (Arbeitshaus).
Ferdinando Fuga, Schnitt und Ansicht des Albergo dei Poveri, 1263, Neapel.
Caserma alla Maddalana (»La Cavallerizza«; Via Marinella / Ecke Via Arnaldo Lucci in der Gegend des Osthafens, östl. von S. Maria del Carmine)
Ein beachtliches Beispiel spätbarocker Zweckarchitektur, 1753-74 von Luigi Vanvitelli erbaut; 1943 durch Bomben beschädigt und jetzt eine zum Abbruch bestimmte Ruine.
Die völlig schmucklose Front, mit 19 Fensterachsen und 3 Geschossen, hatte einen geböschten Sockel, Bossenquadern und einfache Putzrahmen um die Fenster; die Rückwand des Hofes war zu einer flachen Exedra ausgebildet, in deren Mittelpunkt eine querovale Kapelle lag.
Das umliegende Gelände muß man sich mit Obstgärten bedeckt vorstellen; auf dem Grund der Kaserne befand sich seit dem 16. Jh. ein königliches Gestüt. 1742 erbaute Sanfelice hier ein Serraglio (Raubtierhaus, Menagerie), mit hübscher Freitreppenanlage nach Art der Treppe von S. Giovanni a Carbonara; einige Reste sind an der Rückseite der Kasernenruine zu sehen.
Die Via della Marinella überquert weiter ostwärts das Flußbett des Sebeto; von dem alten Ponte della Maddelena hat sich in einer Hauswand eine Ädikula mit der Statue des Brückenheiligen Johannes v. Nepomuk erhalten (errichtet nach dem Vesuv-Ausbruch von 1761, die Figur von Francesco Celebrano; gegenüber stand natürlich S. Gennaro). Der leicht übertrieben anmutende Aufwand soll Joachim Murat den klassischen Ausruf entlockt haben: »Neapolitaner — entweder mehr Fluß, oder weniger Brücke« Jenseits des Flusses lagen die berühmten Granili oder Granai (Kornspeicher), 1779 nach einem Entwurf von Fuga begonnen, ein Block von einem halben Kilometer Frontlänge mit 4 Geschossen und der Rekordzahl von 89 Fensterachsen, durch 3-und 5achsige Risalite gegliedert; gleichfalls durch Bomben zerstört, nach dem Kriege abgebrochen und durch elende Neubauten ersetzt.
Caserma di S. Pasquale (am Largo del Vasto im Chiaia-Viertel, gegenüber dem Palazzo Carafa di Policastro)
Der Bau steht an Stelle einer von Alfons II. von Aragon gegr. Landvilla‚ die dann in den Besitz der Vizekönige überging. Don Pedro di Toledo ließ hier einen prächtigen Palast errichten, versorgte den Platz mit Wasser und legte weitläufige, mit Brunnen und Statuen geschmückte Gärten an, die von den Zeitgenossen in den glühendsten Farben geschildert werden. Nach dem Tod seines Sohnes Don Garzia, der hier residierte, begann die Anlage zu verfallen. Im 18. Jh. richteten die Bourbonen auf dem Gelände der Villa eine Kavalleriekaserne ein.
Von dieser hat sich ein hübscher und gar nicht kasernenmäßig wirkender Palast erhalten, angebl. schon um 1740 von G. A. Medrano errichtet, im Stil aber stark an Vanvitelli anklingend. Zwischen vorspringenden Flügeln öffnet sich unten das Mittelcorps in einer Bogendurchfahrt; darüber, im Hauptgeschoß, eine monumentale Nische mit durchbrochener Rückwand (Pfeiler und Halbsäulen); in der Attika-Zone eine dritte, niedrigere Bogenöffnung. 2 Pilasterordnungen (dorisch-ionisch) fassen die Stockwerke zusammen; sie bilden im Zentrum eine Ädikula mit gesprengtem Giebel, die Nische und Anika-Öffnung miteinander verklammert; ein Segmentgiebel über der Attika bildet den Abschluß der Gruppe.
Castel Capuano (»la Vicaria«, am östl. Ende der Via dei Tribunali, innerhalb des Capuaner Tores) Der Palast blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück, von der sich aber so gut wie keine monumentalen Spuren erhalten haben.
Die Gründung des Castel Capuano wird dem Normannenherzog Wilhelm I. (1154-66) zugeschrieben. Kaiser Friedrich II. baute es zum Residenzschloß aus; auch von den Anjou und den Aragonesen wurde es noch als solches benutzt. Eine Glanzzeit erlebte das Kastell unter Alfons II. von Aragon, der als Herzog von Kalabrien hier residierte und das ostwärts liegende Gelände vor der Stadtmauer von Giuliano da Maiano zur Lustvilla (»la Duchesca«) ausbauen ließ. Gegen 1540 beschloß der Vizekönig Don Pedro di Toledo, die in der Stadt verstreut liegenden Gerichtsbehörden in einem Justizpalast zusammenzufassen; zu diesem Zweck: wurde das Castel Capuano von Ferdinando Manlio und Giovanni Benincasa vollständig umgebaut. Im 17. und 18. Jh. neu dekoriert, erlebte es 1857/58 eine 2. radikale Umgestaltung; seitdem noch weitere Restaurierungen und Veränderungen.
Die zur Via dei Tribunali gerichtete Hauptfassade des großmächtigen 4-Flügel-Palastes zeigt in etwa noch die Umrisse des Cinquecento-Baues, in seinem Typus (Mittelturm, geböschter Sockel) viell. beeinflußt von dem von Bramante begonnenen Justizpalast Julius’ II. in Rom. Über dem Eingang die Gründungsinschrift Don Pedros und das Adlerwappen Kaiser Karls V. (der 1535 hier Hof gehalten hat) mit den Säulen des Herkules und dem Motto »plus ultra«. — Innen ein einfacher rechteckiger Pfeilerhof. — Die Treppe links hinten führt in den 1. Stock mit dem riesigen Salone della Corte d’Appello (Berufungsgericht), dekoriert mit Architekturperspektiven und Allegorien der 12 Provinzen des neapolitan. Königreiches, von Antonio Cacciapuoto (um 1770).
Zur Rechten die gegen 1550 eingerichtete Cappella Summaria mit reichster Stuck-und Groteskendekoration und einem sehr bedeutenden Freskenzyklus von Pietro Ruviale (Pedro de Rubiales), einem gebürtigen Spanier, der zuvor als Schüler Francesco Salviatis in Rom gearbeitet und Anregungen der dortigen Raffael-Michelangelo-Nachfolge (Perin del Vaga, Polidoro da Caravaggio, Daniele da Volterra) aufgenommen hatte. Dargestellt sind die Leidensgeschichte Christi und, nach einer selten anzutreffenden mittelalterl. Bildtradition (vgl. S. 198), die Erscheinungen des Auferstandenen; besonders schön die Wiederbegegnung des dem Limbus entstiegenen Heilands mit seiner Mutter, eine Szene,
die übrigens in dörflichen Osterprozessionen des neapolitan. Gebietes noch heute vorgestellt wird. Dazu kommen Tugenden und andere Allegorien; ferner an der rechten Seitenwand das Jüngste Gericht, eine in 3 Felder aufgeteilte Paraphrase von Michelangelos Sixtina-Fresko. Gleichfalls von Ruviale das vorzügliche Altarbild (Beweinung Christi). — In den anderen Sälen noch mehrere Fresken des 18. Jh.
Castel Nuovo (Piazza del Municipio, vormals Largo Castello) Die Burg, im Volksmund »il Maschio Angioino« gen., ist das Wahrzeichen von Neapel und eines der größten Geschichtsdenkmäler des alten Königreiches.
Der Entschluß zur Errichtung einer »neuen Burg« — neben den schon bestehenden Castelli dell’Ovo und Capuano — fällt in die ersten Jahre der angiovinischen Herrschaft. Die ältesten Quellen sprechen von einem Palatium S. Mariae (nach der an dieser Stelle gelegenen Franziskanerkirche — vgl. die Gründungsgeschichte von S. Maria la Nova); doch hat sich bald die Bezeichnung Castrum Novum (Chastiau neuf) durchgesetzt. Die hierin angedeutete Doppelfunktion des Baues als königliche Residenz sowie als Land- und Seefestung zum Schutze der Stadt und des Hafens ist für seine Form wie auch für sein weiteres Schicksal bestimmend geworden. Wie groß zunächst das persönliche Sicherheitsbedürfnis der damaligen Machthaber war, zeigt die beispiellose Eile, zu der Karl I. seine Bauleute antrieb. 1279 ergeht der Befehl zum Baubeginn; 3 Jahre später ist der Palast bereits bewohnt, die Verteidigungswerke sind armiert und mit Vorräten versehen; 1284 wird die Fertigstellung des Schlosses gemeldet. Ein Geistlicher namens Pierre de Chaule (Peter de Caulis) erscheint in den Urkunden in der Rolle des Architekten. Leider besitzen wir keine bildlichen Darstellungen dieser Burg Karls I., die uns einen anschaulichen Begriff von ihrem Aussehen vermitteln könnten. Was im jetzt stehenden aragonesischen Bau sich an älteren Mauerresten erhalten hat, scheint den Schluß zu erlauben, daß der Umfang der Anlage in etwa der heutigen glich; 6 oder 7 Türme, Graben und Zugbrücke bildeten das Befestigungssystem.
Karl II. (1285-1309) sorgt für dessen weiteren Ausbau; 1307-11 entsteht unter Leitung von Giovanni Caracciolo de Isernia und Gualterio Seripando die große Palastkapelle, etwa gleichzeitig der Giardino del Beverello, ein mit kostbaren Pflanzen geschmückter, von Vögeln und anderen Tieren belebter hängender Garten über dem Meer, der später das Entzücken Boccaccios erregen sollte. Dazu kommt unter Robert d. Weisen (1309-43) ein ausgedehnter Park mit Brunnen, Pergolen‚ Pavillons und anderen Zierarchitekturen, der sich nach SW (in der Gegend des heutigen Palazzo Reale) am Meer entlangzieht. Am Palast wird unter Leitung von
Tino di Camaino und Attanasio Primario weitergebaut. 1328 ruft der König Giotto nach Neapel; dieser schafft in 5jährigem Aufenthalt einen großen Freskenzyklus in der Palastkapelle (Altes und Neues Testament — von Petrarca bewundert und im »Itinerarium Syriacum« dem Reisenden zur Besichtigung anempfohlen); ferner vollendet er die Ausmalung der königlichen Privatkapelle (schon 1305 von Montano d’Arezzo beg.) und schmückt einen der Säle mit einer Folge von 9 »huomini famosi« und ihren Ehefrauen (Herkules, Achill, Paris, Hektor, Aeneas, Salomon, Samson, Alexander und Caesar). Gelehrte und Dichter aus aller Welt versammeln sich damals am angiovinischen Hof. Den jungen Florentiner Kaufmann Giovanni Boccaccio begeistert die Liebe zu Maria dei Conti d’Aquino (»Fiametta«), einer natürlichen Tochter König Roberts, zu seinem poetischen Werk; andere zieht vornehmlich die berühmte Bibliothek des Herrschers nach Neapel.
Dies ändert sich rasch nach Roberts Tode. Mit der Dekadenz des Hauses Anjou geht der Verfall der Burg Hand in Hand; schließlich wird es im Verlauf der angiovinisch-aragonesischen Erbfolgekriege mehrfach heftig umkämpft, belagert, beschossen und erobert und gerät am Ende in einen Zustand völliger Verwüstung; allein die Kapelle mit den Giotto-Fresken scheint damals noch einigermaßen verschont geblieben zu sein.
1442 zieht Alfons von Aragon in Neapel ein, nimmt die Ruine der Burg in Besitz und beschließt sogleich den Neuaufbau. Die entscheidende Figur unter den verschiedenen hierzu in Dienst genommenen Architekten ist offenbar Giulliermo (Guillem) Sagrera aus Mallorca, der seit 1448 als »Protomagister« bezeichnet wird; nach seinem Tode (1454) führen sein Vetter Johan und sein Sohn Jaume das Werk fort. Einen Blick auf das fertiggestellte Kastell von der Seeseite her zeigt die »Tavola Strozzi« im Museum von S. Martino (1464). Zwischen 1455 und 1471 entsteht das berühmte Triumphtor; ganze Heerscharen teils italienischer, teils katalanischer Künstler sind an der Ausstattung des Palastes tätig; auch Park und Gärten werden hergestellt und bilden den luxuriösen Rahmen dieses äußerlich wohl glanzvollsten Fürstenhofes der Frührenaissance, mit dem, nach Urteil des Enea Silvio Piccolomini, auch der Palast des Darius nicht hätte wetteifern können. Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli (il Panormita) und Bartolomeo Facio gehören zu den ständigen Gästen König Alfonsos, der sich im Feldlager Livius und Caesar vorlesen, von Piccolomini den Seneca interpretieren läßt, auch bedeutende Summen für die Übersetzung griech. Klassiker ausgibt; unter seinen Nachfolgern werden Giovanni Pontano, Tristano Caracciolo und Diomede Carafa, Pietro Summonte und der geniale Jacopo Sannazzaro an ihre Stellen treten. Berühmte Gräzisten und Hebraisten, Flüchtlinge aus dem 1453 von den Türken eroberten Konstantinopel und aus den spanischen Judenverfolgungen, erscheinen am Hof und heben das Studium der alten Sprachen auf sonst unerreichte Höhe.
Das große Erdbeben, das 1456 die Stadt erschüttert, kann dem gewaltigen Bau nur wenig anhaben; auch das gerade fertig gewordene Rippengewölbe des großen Saales hält den Erdstößen stand. Schwere Schäden entstehen jedoch an der Palastkapelle, bei deren anschließender Restaurierung (unter Juan de Guares 1465 bis 1474) die Giotto-Fresken geopfert werden. Auch die Befestigungswerke erfordern ständigen Ausbau, um mit der rapide fortschreitenden Kriegstechnik Schritt zu halten. Giuliano da Maiano (1485-90), Giuliano da Sangallo (1488), Fra Giocondo (1492), Benedetto da Maiano (1492) und Baccio d’Agnolo (1494) werden zu Rate gezogen. Zwischen 1491 und 1494 steht der renommierteste Festungsexperte der Zeit, Francesco di Giorgio Martini, im Dienst des Königs; zu seinen meistbewunderten Erfindungen gehörte ein Pumpwerk, das Wasser bis in die obersten Stockwerke der Burg beförderte. Nach Siena zurückgerufen und dort für unabkömmlich erklärt, schickt er seinen Schuler und Mitarbeiter Antonio Marchesi da Settignano, unter dessen Leitung das äußere Verteidigungssystem grundlegend verbessert wird (abgebildet zuerst auf Intarsien des Montoliveto-Klosters, vgl. S. 50); erhalten hat sich aus jener Zeit das heute vor dem nördl. Turm außerhalb des Grabens frei stehende Tor mit Inschrift Federicos von Aragon, 1496.
In den Kämpfen der Jahrhundertwende zwischen Aragonesen, Franzosen und Spaniern werden zum ersten Mal Minen und schweres Geschütz angewandt, die v. a. in den Außenwerken starke Zerstörungen anrichten. Die spanischen Vizekönige, seit 1503 Herren von Neapel, bessern das Mauerwerk aus und schaffen einen ausgedehnten Kranz moderner Bastionen. Im Palast wird, unter der Herrschaft von Don Pedro di Toledo, vieles umgebaut und restauriert, der dem Hafen zugewandte Trakt zwischen Kapelle und SO-Turm vollständig erneuert, auch der Park instandgesetzt und mit reich geschmückten Brunnenanlagen versehen. — Mit der Errichtung des Neuen Residenzschlosses (Palazzo Reale) verliert das Kastell an Bedeutung, bleibt aber immer der wichtigste feste Punkt der Stadt, der z. B. 1734 in der Auseinandersetzung zwischen Karl von Bourbon und dem deutschen Kaiser Karl VI. hart umkämpft wird. — Die letzten eingreifenden Umbauten an Mauern und Palast, v. a. am N- und W-Flügel, fallen in die 2. Hälfte des 18. Jh. 1823 erfolgt auf Befehl des Bourbonenkönigs Ferdinand I. eine gründliche Instandsetzung des ganzen Gebäudes. Zwischen 1871 und 1875 wird der größte Teil der Außenbastionen eingeebnet und in eine Grünanlage umgewandelt. 1919 bricht in der Sala dei Baroni ein Brand aus, der schwere Schäden verursacht; die anschließend eingeleiteten, 1940 beendeten, umfassenden Restaurierungen gelten der Freilegung und Sicherung des historischen Bestandes.
Für die Geschichte des Castel Nuovo ist es charakteristisch, daß die wichtigsten Bauherren ihre Rolle als Eroberer an-
traten und die bei Belagerung und Sturm gemachten Erfahrungen so immer wieder dem Ausbau der Verteidigungsanlagen zugute kamen. Dies gilt zuerst für den Gründer des Neubaus, Alfons von Aragon, der die vernichtende Wirkung der neuen Feuerwaffen im Kampf um die Burg des 13. Jh. selbst hatte erproben können. Sein Architekt stand nun vor der Aufgabe, eine an die Kampfesweise der Neuzeit angepaßte Festung zu errichten, ohne daß der König auf den traditionellen Aspekt einer hoch ummauerten, vieltürmigen Ritterburg hätte verzichten mögen. Dem
ersten Anspruch genügte er durch die Anlage eines relativ niedrigen, aber massiven und stark geböschten Sockels.
Über diesem liegt die eigentliche Verteidigungsebene: eine Terrasse mit zinnenbewehrter Brüstung zur Aufstellung moderner Flachfeuergeschütze, die den Angreifer in direktem Beschuß unter Feuer nehmen. Der dahinter aufsteigende Bau mit seinen hohen senkrechten Wänden, Rundtürmen und ausladenden Zinnenkränzen, vom Typus des Belver von Mallorca und anderen Burgen Spaniens und Südfrankreichs, ist militärisch gesehen schon ein Anachronismus und dient mehr der optischen Demonstration von Stärke als ihrer effektiven Entfaltung. I. ü. muß man sich vor Augen halten, daß schon seit dem Ende des 15. Jh. das Hauptverteidigungsfeld in den heute verschwundenen Außenforts lag.
Die nach W schauende Stadtseite des Kastells enthält den durch eine Zugbrücke gesicherten Eingang mit dem Triumphbogen (s. u.), eingebettet zwischen 2 mächtigen Tortürmen (Torre della Guardia und Torre di Mezzo); ein 3. Turm (Torre S. Giorgio) bildet die NW-Ecke des Gebäudes. Die Sockelmauer zeigt im Bereich der Tortürme eine Art Diamantquaderung, wohl das früheste Beispiel dieser Schmuckform in Italien (vgl. S. 138), mit diagonalen Steinlagen in der Art des antiken »opus reticulatum« (links stark restaur.). Welchem Zweck die eigentümliche »Fältelung« am Sockel der Torre S. Giorgio dienen sollte, ist unklar (Schutz gegen das Anlegen von Sturmleitern?). — Der Mittelturm stürzte 1876 ein und wurde wenige Jahre später neu errichtet, die damals falsch erneuerten Fenster bei der letzten Restaurierung korrigiert; modern ergänzt wurden hier wie anderwärts die Zinnenkränze der Türme und Terrassen sowie der mit Segmentbogen abgedeckte Wehrgang unter der Dachkante des linken Flügels. — Die langgestreckte N-Wand des Baues erhielt durch den Abbruch einer im 18. Jh. vorgelegten 5geschossigen Palastfront ihr altes Aussehen zurück. Die Torre Beverello an der NO-Ecke bildet (wie schon im angiovinischen Vorgängerbau) den Hauptturm der Festung, etwas höher als die anderen und auch im Bereich des Sockels von den angrenzenden Terrassen isoliert. — Ein reich gegliedertes Bild bietet die dem Hafen zugewandte O-Seite, die urspr. direkt aus dem Wasser emporstieg. An den Beverello-Turm schließt sich, in glei-
cher Höhe, der Hauptblock des Palastes mit der gewaltigen Front des großen Saales (die 2 Kreuzsprossenfenster nach dem Brand von 1919 erneuert) und der von polygonalen Strebepfeilern eingefaßten Kapelle an (auch das Maßwerkfenster restaur.). Im folgenden Trakt erscheint über den Fenstern der Sakristei und der Camera di S. Francesco da Paola eine kleine 3bogige Loggia, die noch dem Quattrocento-Bau angehört. Auch der leicht vortretende Baukörper links davon, die ehem. Torre del Mare, trug urspr. 2 dreiachsige Bogenhallen, die jedoch wegen der unzulänglichen Fundierung dieser Partie schon zu Ende des 15. Jh. einstürzten; das gleiche Schicksal erlitt ein an ihre Stelle von Federico von Aragon errichteter Turm. Die links anschließende Loggia Grande war urspr. eine offene Aussichtsterrasse; 1497 errichtete Federico die untere, 1535 Don Pedro von Toledo die obere Arkade. Nach SO wendet sich die Torre dell’Oro, einstmals Schatzkammer der Könige; von hier bis zur Torre della Guardia erstreckt sich die lange gerade S-Flanke, von den cinquecentesken Vorbauten befreit und im Oberteil (Wehrgang und Zinnenkranz) wiederhergestellt.
Der Triumphbogen Alfons’ I., dessen marmorne Schauseite wahrhaft triumphal zwischen den düsteren Peperinmauern der Tortürme aufsteigt, gehört seinem Umfang wie seiner Bedeutung nach zu den wichtigsten Vorhaben der Profankunst des Quattrocento. Kaum je hat das Bild der Herrschaft in einem Renaissance-Fürstentum so klare Züge getragen, kaum je der Charakter eines ihrer Machthaber sich reiner ausgesprochen als der des »Alfonso Magnanimo« in seinem Siegesmal. Wie in den zeitgenössischen Biographien dieses Herrschers Antikenbegeisterung und Christenglaube, eifernde Frömmigkeit und humanistische Gelehrtendisziplin einander durchdringen, so trägt die antikisch nüchterne Schilderung seines »trionfo« den Überbau christl.
Heiligenbilder und Tugendallegorien, vollzieht sich im Rahmen eines von mittelalterl. Überlieferung geprägten architektonischen Typus die wohl engste Annäherung an die Kunst röm. Kaiserzeit, die der italien. Quattrocento-Skulptur beschieden war.
Die Vorgeschichte des Monuments beginnt mit Alfonsos festlichem Einzug in die eroberte Stadt, am 26. Februar 1443. Durch eine Mauerbresche beim Castel del Carmine trat der Corteo in das
Stadtgebiet ein und passierte zunächst eine hölzerne Ehrenpforte, die die Bürgerschaft auf der Piazza del Mercato errichtet hatte; doch war auch der Bau eines Marmorbogens schon beschlossen worden, zwischen dessen Fundamenten vor der Fassade des Domes der König hindurchzog. Die Ausführung des Projektes scheiterte am Widerstand eines Patriziers, der sich in seinem am Domplatz gelegenen Palast durch den Bogen behindert fühlte. Wann nun der Gedanke gefaßt wurde, das Eingangstor der inzwischen aufwachsenden Neuen Burg als Triumphbogen auszugestalten, ist nicht mit Sicherheit auszumachen. Viell. sind 3 in Rom gearbeitete Marmorfiguren, darstellend den Krieg, den Frieden und die Sirene Parthenope, die 1447 nach Neapel verschifft wurden, schon für den Bogen bestimmt gewesen. Einen ersten Begriff von der Planung jener Jahre gibt eine zwischen 1444 und 1448 datierbare Zeichnung (heute Rotterdam, Mus. Boymans), viell. aus dem Umkreis des Pisanello, der 1448 in Neapel geweilt hat; sie zeigt eine 3geschossige Bogen-und Nischenfront mit Statuen und heraldischen Schmuckmotiven, in der katalanisch-got. Formen sich mit solchen der Frührenaissance vermischen. Offensichtlich hat die Erinnerung an das Brückentor Friedrichs II. in Capua den Aufbau beeinflußt; aber auch zu den Königsgräbern von S. Chiara und S. Giovanni a Carbonara läßt sich der Typus in Beziehung setzen — übernimmt der Triumphbogen doch als Memoria des Herrschers auch die Funktion eines Grabmonuments, auf das der König für seine Person ausdrücklich verzichtet hatte (sein Leichnam wurde in S. Pietro Martire beigesetzt und 1671, dem Letzten Willen des Verstorbenen entsprechend, in das Kloster S. Maria di Poblet bei Tarragona überführt).
Das damit angeschlagene Thema wird einige Jahre später von italien. Künstlern, die aus allen bedeutenden Zentren des Landes zusammenkommen, neu formuliert. 1452 sind die Tortürme fertiggestellt; im gleichen Jahr ergeht ein dringender Ruf an den in Ragusa (Dubrovnik) tätigen Pietro di Martino da Milano, der 1453 in Neapel eintrifft. In seiner Begleitung befand sich vermutl. der junge Dalmatiner Francesco Laurana; aus Genua kommt Domenico Gaggini, seiner Herkunft nach Lombarde; aus Rom Paolo di Mariano Taccone, gen. Paolo Romano; auch der Spanier Pere Juan wird 1453 noch unter den Mitarbeitern genannt. 1455 bis 1456 ist Mino da Fiesole in Neapel; gleichzeitig erscheinen Isaia da Pisa aus Rom und der Donatello-Schüler Andrea dall’Aquila; 1457 noch Antonio di Chelino da Pisa, gleichfalls aus der Werkstatt des Donatello. Im Lauf dieses Jahres wird das Untergeschoß einschließlich des großen Frieses fertiggestellt, die Figuren der oberen Zonen sind in Arbeit. 1458 setzt König Alfons’ Tod dem Werk ein vorläufiges Ende. Erst 1465/66 kann, unter alleiniger Leitung des Pietro da Milano, der Aufbau zu Ende geführt werden; 1467-71 entsteht die Dekoration des inneren Torbogens.
Der architektonische Aufbau des Ganzen ist seiner steilen und engen Verhältnisse wegen oftmals getadelt worden. Allein es waren hier Bedingungen zu akzeptieren, an denen der Architekt gar nichts ändern konnte; wer sich die gestellte Aufgabe klarmacht, wird nicht nur den Einfallsreichtum bewundern, mit dem in der Abfolge der Geschosse jede Monotonie vermieden ist, sondern auch an der eigentümlichen Schönheit des Hochbaus selbst seine Freude haben. Wie der an sich unleugbare Mangel an rationaler Organisation (in dem man viell. den spezifisch »neapolitanischen« Aspekt des Werkes sehen darf) sich positiv ausdeuten läßt, zeigt Jacob Burckhardts merkwürdiges Urteil: »fast das einzige Gebäude der Renaissance, welches die antiken Ordnungen im vollen Reichtum ihrer Formen prangen läßt.« Tatsächlich gibt es im Quattrocento kein zweites dekoratives Ensemble von vergleichbarer Antikennähe; und wenn die Folgezeit das Gesetzmäßige der klassischen Baukunst tiefer und reiner verstanden hat, dann nur um den Preis jener sinnlich-konkreten Fülle im Einzelnen (»varietà«), aus der das Neapler Denkmal sein Leben hat.
Was die Zuschreibungsfrage anbetrifft, so bleibt nach Lage der Urkunden nichts anderes übrig, als in dem sonst obskuren Pietro da Milano den Architekten des Bogens zu sehen; wie weit andere, besser faßbare Künstler wie etwa der hochbegabte Francesco Laurana den Gesamtentwurf mitbestimmt haben, läßt sich auf keine Weise entscheiden. Zur Verteilung der Bildhauerarbeiten an die einzelnen Hände hat die neuere Stilkritik vieles beitragen können, ohne daß sich in allen Fällen ein klares Bild ergäbe.
Das Untergeschoß mit seiner korinthischen Doppelsäulen-Ordnung und dem runden Eingangsbogen ist eine exakte Nachbildung des Bogens der Sergier in Pola, aus dem 1. Jh. n. Chr. — viell. der erste Fall einer »Antikenkopie«, die über Einzelmotive hinausgeht und ein Werk als ganzes reproduziert; genaue zeichnerische Aufnahmen des Originals müssen vorausgesetzt werden. Eine wohlüberlegte Abweichung liegt in den etwas erhöhten Piedestalen der Säulen-Paare: Mit ihnen rückt auch das Gebälk ein Stück nach oben, so daß das über dem Scheitel des Bogens erscheinende königliche Wappen einen gebührenden Platz erhält. Es wird von Füllhörnern und gegenständigen Greifen begleitet, die anstelle der Viktorien des antiken Vorbildes die Zwickel ausfüllen. Die sehr feinen dekorativen Reliefs zeigen am Sockel Palmetten, Akanthus, Vasen, Köpfe und Masken, am Fries des Gebälks Eroten und Kentauren,
Satyrn und Nymphen, eine Herkules-Szene und andere Motive aus der antiken Sarkophagskulptur, wie sie in den »Skizzenbüchern« der Werkstatt vorkommen mochten. Das Mittelstück des Frieses mit der Inschrift des Triumphators zwischen von Amoretten gelenkten Zweigespannen ist wiederum genau dem Sergierbogen nachgebildet; daneben freiere Inventionen in der Art der Florentiner Donatelloschule, wohl von Andrea dall’Aquila.
Überaus prächtig sind die Innenwände des Bogens ausgestattet. Nach dem Vorbild des röm. Titusbogens oder des Trajansbogens von Benevent tragen sie kastenförmig eingetiefte Relieffelder; darüber liegt eine 2. Ordnung mit Pilastern und kannelierten Muschelnischen, von reichster plastischer Durchbildung; die Bogenlaibung hat oktogonale Kassetten mit verschiedenen Schmuckmotiven. Die großen Reliefs zeigen 2 Säle, in denen kriegerisch gerüstete Männer — rechts vorwiegend Fußvolk, links Edelleute im Prunkharnisch — sich versammelt haben. Im Zentrum des linken Bildes steht ein lorbeerbekränzter Jüngling, viell. Alfonsos Sohn Ferrante; ganz links der König selbst, kenntlich an seinem Caesarenkopf wie auch an den Emblemen seines Brustpanzers und dem reich geschmückten Wappenschild. — Das rechte Feld gilt als Werk des Francesco Laurana und wäre dann wohl die erste selbständige Arbeit des jungen Künstlers. Der enge, von Säulen verstellte Raum ist bis zu den Rändern gefüllt mit hart aneinanderstoßenden Körpern; in den scharf und genau modellierten, z. T. recht unangenehmen Gesichtern scheint der spätere Meister realistischer Porträtbüsten sich anzukündigen. Dagegen zeigt das linke Relief jene Technik stufenweiser Umsetzung plastischer Werte ins Bildhaft-Flächige, die als Errungenschaft Donatellos (vgl. S. 40) in die florentinische Plastik einging und hier wohl am ehesten dem Andrea dall’Aquila zugetraut werden darf. Elegant und gefällig ordnen sich die kontrapostisch bewegten Freifiguren der 1. Reihe zueinander, lassen Platz für die halberhabenen Köpfe der hinten Stehenden, während durch die Bogenöffnung des Hintergrundes weitere Scharen behelmter Krieger in reinem Flachrelief sichtbar werden. Die zarteste Modellierung zeigen die »all’antica« bewegten Dekorationen des Innenraumes; man lasse sich nicht das Vergnügen entgehen, den Reigen wild durcheinanderpurzelnder Putten an der Vorderkante der Decke zu studieren. Die rahmenden Friese und Gewände beider Seiten enthalten wieder eine Fülle klassischer Motive und Figuren; besonders schön die im Wasser spielenden Meerwesen über den großen Relieffeldern.
Die Stelle der Attika nimmt an der Schauseite des Bogens das große Triumphrelief ein (Tafel S. 336). Vor einem kontinuierlichen, mit dem Rahmen fest verbundenen Architekturhintergrund, wie er ähnlich auf Reliefs der trajanischen Zeit begegnet (vgl. etwa die Schrankenplatten von der Rostra des Forum Romanum), bewegt sich der Festzug gemessenen Schrittes von links nach rechts. Die Flanken über den Säulenpaaren der unteren Ordnung sind nach
Art nordafrikanischer Triumphbögen (Tebessa, Djemila) als vortretende Ädikulen ausgebildet. Sie stellen hier 2 Triumphtore dar: aus dem linken tritt der Zug hervor, unter dem rechten schwenkt er ein und bewegt sich auf den Beschauer zu. Zahlreiche antikische Einzelheiten sind wohl zugleich als getreue Abbilder der nach den selben Quellen gestalteten Figurinen aus Alfonsos realem Triumphzug zu verstehen. So hat etwa die rosseführende Viktoria des Titusbogens, die in unserem Relief wiederkehrt, unter dem Titel einer Fortuna auch den Zug von 1443 mitgemacht. Vor ihr her marschiert eine Schar prächtig gekleideter Musikanten zu Pferde (rechte Ädikula) und zu Fuß. Den Triumphwagen ziehen im Gleichschritt 4 starke Rosse; sein kastenförmiger Unterbau, mit Blattmasken und Bukranien reich verziert, trägt den Thron des Herrschers, der in gelassen-würdiger Haltung über den Köpfen der Menge dahinfährt. Zu Füßen des Königs züngelt ein Feuerbrand, Anspielung auf die dem Sagenkreis um König Artus entnommene Impresa Alfonsos (der Thronsitz der Tafelrunde ist von einer Flamme besetzt, die erst dem Ritter ohne Furcht und Tadel ihren Platz räumt). 2 neben dem Wagen einherschreitende Edelleute vertreten die 20 Mitglieder des neapolitan. Patriziats, die 1443 den wappengeschmückten Baldachin trugen. Es folgen die (sicher porträtähnlichen) Mitglieder des Hofstaats, in der 1. Reihe vermutl. Ferrante von Aragon und der Fürst von Tarent; dahinter, mit Bart und Turban, der Gesandte des Beys von Tunis mit Gefolge. — Das Ganze ist aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt, die nicht immer genau aufeinanderpassen und wohl verschiedenen Händen zugeschrieben werden müssen. So gelten die Musiker als Werk des Gaggini; Paolo Romano soll die Pferde mit der Fortuna gearbeitet haben; den König Isaia da Pisa; die Patrizier vor dem Wagen nach neuesten Vermutungen Mino da Fiesole. Über die Anteile Pietros da Milano und Lauranas besteht keine Klarheit; auch läßt der Schöpfer des höchst geschickt ponderierten Gesamtentwurfes sich nicht bestimmen.
Das folgende Stockwerk bringt wieder einen von gekuppelten Halbsäulen flankierten Bogen, für dessen gedrückte Proportionierung der Augustusbogen von Rimini ein ungefähres Vorbild bieten mochte. Die figürliche Ausstattung dieser Zone ist nicht mehr ausgeführt worden. Unter dem Bogen erwartet man, wie in den entsprechend plazierten Nischen am Capuaner Tor oder am Grabmal Roberts des Weisen, eine Sitzfigur des Königs, oder aber, wie auf der Zeichnung des Boymans-Museums, dessen Reiterbild (vgl. dazu das Ladislaus-Monument in S. Giovanni a Carbonara, S. 157). Ferrante I. plante, an dessen Stelle das balsamierte Herz seines Vaters aufzuhängen; schließlich blieb dieser zentrale Platz des ganzen Denkmals überhaupt leer. Vor den Säulen links steht eine verstümmelte Statue: Möglicherweise handelt es sich um die 1447 aus Rom übersandte Allegorie des Krieges. In den Zwickeln des Bogens sitzen Viktorienreliefs, offenbar nach dem Vorbild des Trajans-
bogens von Benevent; der Fries des Gebälks zeigt gegenständige Greifenpaare.
Im letzten Geschoß wird der tektonische Rhythmus des Unterbaus aufgegeben; eine Pilasterordnung mit 4 großen Muschelnischen bildet eine durchlaufende Schauwand; in den Nischen stehen (von links nach rechts) Justitia, Temperantia, Fortitudo und Prudentia; die erste wird Laurana zugeschrieben, die zweite Gaggini, die dritte Isaia da Pisa, die vierte ist strittig zwischen Gaggini und Laurana. Darüber ein Segmentgiebel mit 2 kolossalen Flußgöttern, wahrscheinl. von Paolo Romano. Den Abschluß des Ganzen bildete eine Dreiergruppe von frei stehenden Figuren, die hll. Georg, Michael und Antonius Abbas, von Paolo Romano oder Pietro da Milano, von denen nur die mittlere sich erhalten hat.
Der Bogendurchgang des Untergeschosses verengt sich an seiner Rückseite zu einem Tor, das 1467-71 von Pietro da Milano dekoriert wurde. Der Rahmen besteht hier aus einfachen Halbsäulen; über dem Scheitel des Bogens ist das Gebälk unterbrochen, um dem von 2 Eroten getragenen Wappen Ferrantes I. Platz zu machen; darüber ein nur fragmentarisch erhaltenes Relief, dessen fehlendes Mittelstück die Krönung Ferrantes I. zeigte (entfernt beim Einzug Kaiser Karls V. 1535, vgl. auch S. 362).
Auf den berühmten bronzenen Türflügeln (jetzt rechts an der inneren Eingangswand des Vestibüls) ließ der König die wichtigsten Ereignisse seiner ersten Regierungsjahre abbilden und in Hexametern erläutern. Die beiden oberen Felder zeigen eine Episode aus dem Kampf mit den aufständischen Baronen: das Treffen von Torricella bei Calvi (1462) zwischen Ferrante und seinem Schwager Marino Marzano, begleitet von Jacobuccio di Montagano und Deifobo dell’Anguillara, bei dem dieser das Schwert gegen den König zog. In das gleiche Jahr fällt der Sieg über die französ. Invasionsarmee unter Johann von Anjou: Das untere Bild des letzten Flügels schildert den Aufbruch und Abmarsch des angiovinischen Heeres nach der Schlacht von Accadia bei Foggia; auf dem Gegenbild rechts dringen die Aragonesen durch eine in die Mauer geschossene Bresche (am rechten Rand die große Kanone) in die Stadt ein. Die darauf folgende Entscheidungsschlacht unter den Mauern von Troia ist auf den Mittelfeldern dargestellt; rechts wird ein Ausfall der belagerten Franzosen zurückgeschlagen, im Hintergrund schon die Verfolgung des fliehenden Feindes; links seine endgültige Vernichtung unter den Augen König Ferrantes, der vom Feldherrnhügel (links oben) das Schlachtfeld überblickt. Die Rahmenstreifen sind mit Kandelabern und Ranken dekoriert. An den Endpunkten sitzen runde Medaillons: die beiden oberen (verloren) enthielten die Bildnisse Ferrantes und seiner 1. Frau Isabella von Chiaramonte; darunter das aragonesische Wappen, ein Turnierhelm mit einem geflügelten Drachen und die Embleme des königlichen Hauses: Diamantberg, Flammenstuhl, Knoten, offenes Buch, Hermelin und ein Bündel Hirse. In der linken unte-
ren Ecke das Selbstbildnis des Künstlers oder Gießers der Tür: Guillelmus Monacus aus Paris, der als Geschützmeister und Mechaniker Alfonsos und Ferrantes am aragonesischen Hof zu höchsten Ehren aufstieg. — An 4 Stellen weist die Tür Spuren von Beschießungen auf, doch ist nicht gesagt, daß diese in situ stattgefunden hätten. So ist v. a. die von der Rückseite eingedrungene Kugel, über die viele Betrachter ins Grübeln geraten, sicher nicht vom Hof aus gegen das verschlossene Tor gefeuert worden; vielmehr dürfte es sich um ein Andenken an die Seeschlacht von Rapallo (1495) handeln, in der eine Flotte mit der Kriegsbeute Karls VIII. von Frankreich — darunter unsere Türen — den Genuesen in die Hände fiel, die dann den Neapolitanern ihre Schätze zurückerstatteten.
Triumphbogen Alfons V. an der Westfassade, 1453/1468, Neapel, Castel Nuovo.
Zurück in die Epoche Alfons’ I. und seiner katalanischen Architekten führt das rechteckige Eingangsvestibül, überspannt von einem 4strahligen Sterngewölbe, dessen Schlußsteine wieder die bekannten Embleme tragen: im Zentrum das vereinigte Wappen der Häuser Aragon-Durazzo; ringsum der brennende Stuhl, der Knoten, der Hirsestrauß und das offene Buch (zerstört). Rechts oben ein hübsches spätgot. Zwillingsfenster, wahrscheinl. ein Werk des Bildhauers Pere Juan aus Barcelona.
Der Hof, im Grundriß ein unregelmäßiges Viereck, zeigt Formen der verschiedensten Bauepochen. Eingangswand und N-Wand (links) stammen aus dem 18. Jh.; die Erdgeschoßarkade der S-Wand (rechts), mit leicht gedrückten Rundbögen auf Achteck-Pfeilern, gehört noch dem Quattrocento-Bau an, die darüber aufgehende Wand zeigt die Fensterformen des Cinquecento (mehr oder weniger stark restaur.) — Am interessantesten wieder der O-Flügel. In der Ecke links die relativ wohlerhaltene Freitreppe zur Sala dei Baroni, von 1456-58, rechts neben dem Eingangsportal ein hübsches spätgot. Tabernakel, das wohl eine Madonnenfigur enthielt. Das große Balkonfenster des Saales war im 16. und im 19. Jh. verändert worden; die Restaurierung stellte die originale Rahmenform wieder her, ohne die verlorene Dekoration ersetzen zu können. Die darüberliegende Nische barg im 15. Jh. eine Statue der Justitia. — Die Fassade der Kapelle, deren Anlage noch in die Zeit Karls II. von Anjou zurückgeht, erhielt ihre jetzige Form nach dem Erdbeben von 1546. Das exzellente Renaissanceportal, mit korinthischen Ädikula-Rahmen und feinstem Reliefschmuck (im Tympanon die Madonna mit singenden und musizie-
renden Engeln; am Architrav eine predellenartige Szenenfolge: Verkündigung, Geburt, Anbetung der Könige, Auferstehung, Himmelfahrt, Ecce homo (?) und Marientod; an den Säulensockeln allegorische Darstellungen und Porträtköpfe) stammt von Andrea dall’Aquila; darüber in einer Muschelnische eine Madonnenstatue von Francesco Laurana (1474) — vgl. die Figur von S. Maria Mater Domini (S. 209). In sonderbarem Kontrast dazu steht das große Rosenfenster, dessen 4teiliges Grundschema in ein nahezu unentwirrbares Geschlinge kurviger Linien aufgelöst ist: letzter Ausläufer katalanischer Spätgotik auf neapolitan. Boden, 1469/70 von Matteo Forcimanya aus Mallorca anstelle des alten angiovinischen Rundfensters eingesetzt. — Rechts anschließend der Palast der Vizekönige, von späteren Überbauten befreit und in seiner urspr. Form (1. Hälfte 16. Jh.) rekonstruiert; vom Bau des Quattrocento fand man im Erdgeschoß die Reste einer Arkade, welche der des rechter Hand angrenzenden S-Flügels entsprach. Die große Innentreppe dieses Flügels (»la grada reale«, erbaut 1543 bis 1556) führt hinauf in den Hauptsaal, der die Stelle der »Sala lunga« des Quattrocento-Baues einnimmt. Zum Meer hin öffnet sich die 5achsige »Loggia Grande«; ein Stockwerk höher liegt eine Terrasse mit schönem Blick über den Hafen.
Der sehenswerteste Teil des Inneren ist die Sala dei Baroni, deren kühne Gewölbekonstruktion seit 1456 allen Erdbeben standhält und auch den Brand von 1919 unangefochten überdauert hat.
Wiederum verblüfft die Kürze der Bauzeit: Im Dezember 1452 erhält der ältere Sagrera den Auftrag zur Errichtung des Saales; der Nachfolger des 1454 verstorbenen Meisters muß sich verpflichten, das Werk in einem Jahr zu vollenden, kommt dann zweimal um Fristverlängerung ein; doch schon am 15. April 1457 kann König Alfons das erste Festmahl geben. Von da an bis zum Ende der aragonesischen Herrschaft bildet der Saal den monumentalen Schauplatz der wichtigsten Staatsereignisse; in seinen Mauern vollziehen sich Hochzeits- und Trauerfeiern, Komödienaufführungen und österliche Passionsspiele, aber auch Sitzungen des königlichen Gerichtes; sein heutiger Name bewahrt die Erinnerung an ein Gastmahl, zu dem Ferrante I. 1486 die gegen ihn verschworenen Barone geladen hatte, um sie dann dem Henker zu überantworten.
Die Wirkung des Raumes, der sich mit keinem anderen Profanraum Italiens vergleichen läßt, beruht auf dem Zu-
sammentreffen einfachster Verhältnisse und wahrhaft gigantischer Dimensionen: 26 m messen die Seiten des Grundquadrats, 28 m beträgt die lichte Höhe vom Fußboden bis zum Scheitel der Wölbung. 4 Wände von undurchdringlicher Massivität, nur ganz sparsam durchbrochen, umschließen so einen Hohlraum von nahezu reiner Würfelform; in der Höhe aber entfaltet sich von 8 Eckpunkten aus ein ungeheueres Sterngewölbe (Tafel S. 337), dessen offener Scheitelring die zentrale Lichtquelle des Saales bildet. Der stereometrische Aufbau der Wölbung, die in spanischen Kapitelsälen des 14. Jh. (Valmera, Burgos, Pamplona) ihre Vorläufer hat, ist leicht zu durchschauen: 4 über die Ecken des Saales gespannte Schwibbögen überführen nach Art mittelalterl. »Trompen« das Grundquadrat in ein regelmäßiges Oktogon; aus dessen Winkeln steigen 8 große Radialrippen auf, die das kuppelige Gewölbe tragen. Im Grundriß ergibt sich daraus ein Netz von 12 dreieckigen Feldern (4 Ecktrompen, 8 Kuppelsektoren), die wiederum durch 3strahlige Zwischenrippen in je 3 Unterabschnitte zerlegt werden; für den Aufriß ist charakteristisch, daß die aufgehenden Wandstücke jedes Abschnitts halbrunde Lünetten bilden, die als Stichkappen in die Wölbung eingreifen (je 2 in den Trompen, je eine über jeder Seite des Oktogons). Die Führung der Schildbögen ist ungefähr halbkreisförmig, die der Rippen (und damit der Querschnitt des ganzen Gewölbes) etwas gedrückt: Die tragenden Rippen verschwinden, wie in der katalanischen Gotik üblich, als Segmentbögen in der Wand und geben so ihren Seitenschub an ein unsichtbares System in der Mauer steckender Widerlager ab. In den Lünetten des Hauptgewölbes zieht sich ein niedriger Umgang entlang (die Öffnungen neuerdings wieder freigelegt). Die enorme Stärke des Unterbaues zeigt sich an den in die Wände gehöhlten Öffnungen, v. a. den 4 großen Fenstern, deren Laibungen regelrechte Nebenräume mit je 2 kreuzrippengewölbten Jochen bilden. Im Zentrum der O-Wand sitzt ein kolossaler Kamin, darüber öffnen sich 2 übereinanderliegende Logen für die Musikkapelle des Königs (Zugang durch kleine Türen rechts und links des Kamins). Der plastische Zierat der Architektur, wie etwa die mit feinem und reichem Maßwerk geschmückten Brüstungen der Logen, ist zum größten Teil dem Brand zum Opfer gefallen; nur
Einzelnes konnte nach erhaltenen Resten wiederhergestellt werden.
Die kleine got. Pforte am linken Ende der O-Wand geht auf eine Treppe, über die man die Terrasse am Fuße des Beverelloturmes erreicht; eine ähnliche Tür in der S-Wand vermittelt den Zugang zu einer großen Wendeltreppe mit offener Spindel, die in die Palastkapelle hinabführt. Renaissanceformen zeigt die »Porta del Trionfo« am nördl. Ende der Eingangswand, durch die man in die Gemächer des Königs gelangte. Auf dem fast völlig zerstörten Fries, wohl von einem Künstler des Laurana-Kreises, ist noch einmal der Triumphzug Alfonsos dargestellt, im Hintergrund die damals noch aufrecht stehende Front des Dioskurentempels von S. Paolo Maggiore und das antike Theater; die bei der Restaurierung wieder freigelegte Rückseite zeigt an der gleichen Stelle den Einzug der Aragonesen in das eroberte Castel Nuovo, mit getreulicher Schilderung von Hafen, Vesuv und der (schon in der neuen Form rekonstruierten) Burg; im Tympanon Greifen und Palmetten, darüber 2 lorbeerumkränzte Kriegerbüsten. — Die urspr. Einrichtung des Raumes bestand aus ringsumlaufenden Bänken; im Zentrum einer Seite stand der erhöhte Thronsitz des Königs. 24 schmiedeeiserne Kandelaber sorgten für festliche Beleuchtung. Der Fußboden war mit farbiger Majolika belegt. Die Wände trugen offenbar nur einfachen Verputz; bei festlichen Anlässen wurden sie mit kostbaren flandrischen Wandteppichen verkleidet, die sich im Besitz des Königshauses befanden (u. a. 3 große Passionsdarstellungen — Geißelung, Dornenkrönung und Kreuzigung — von Rogier van der Weyden).
Peter de Caulis, Guillén Sagrera, Sala dei Baroni Südosten mit Gewölbeansatz, 1443/1458, Castel Nuovo in Neapel.
Peter de Caulis, Guillén Sagrera, Sala dei Baroni Tür zum Wallschild des Torre del Beverello, 1443/1458, Castel Nuovo in Neapel.
Das Innere der Kapelle zeigt, als einziger erhaltener Teil der angiovinischen Burg, die strenge Formensprache des frühen Trecento: ein hoher und schmaler Saal mit offenem Sparrendach (urspr. aber viell. kreuzrippengewölbt); am eingezogenen O-Ende ein von Halbsäulen getragener, leicht zugespitzter Triumphbogen, dahinter der quadratische Chor mit Kreuzrippengewölbe.
1307 von Karl II. gegr., war die Kapelle zunächst der S. Maria Assunta geweiht; in der 2. Hälfte des 16. Jh. (nachdem der Titel der Palastkapelle an den neuen Palazzo Reale übergegangen war) diente sie unter dem Patrozinium des hl. Sebastian als Pfarrkirche; gegen 1600 gelangte sie in den Besitz einer Bruderschaft von Artilleristen, die ihr den Titel ihrer Schutzheiligen St. Barbara verliehen. Auch die Architektur der Kapelle hat mancherlei Wandlungen durchgemacht. Nach dem Erdbeben von 1456 mußten große Partien der S-Wand neu aufgeführt werden; die Fenster wurden bis auf wenige Luken vermauert, das Holzdach durch eine Wölbung ersetzt, über dem Eingang eine Orgelempore errichtet. 1776 erhielt die Kirche eine vollständig neue Ausstattung aus Marmor,
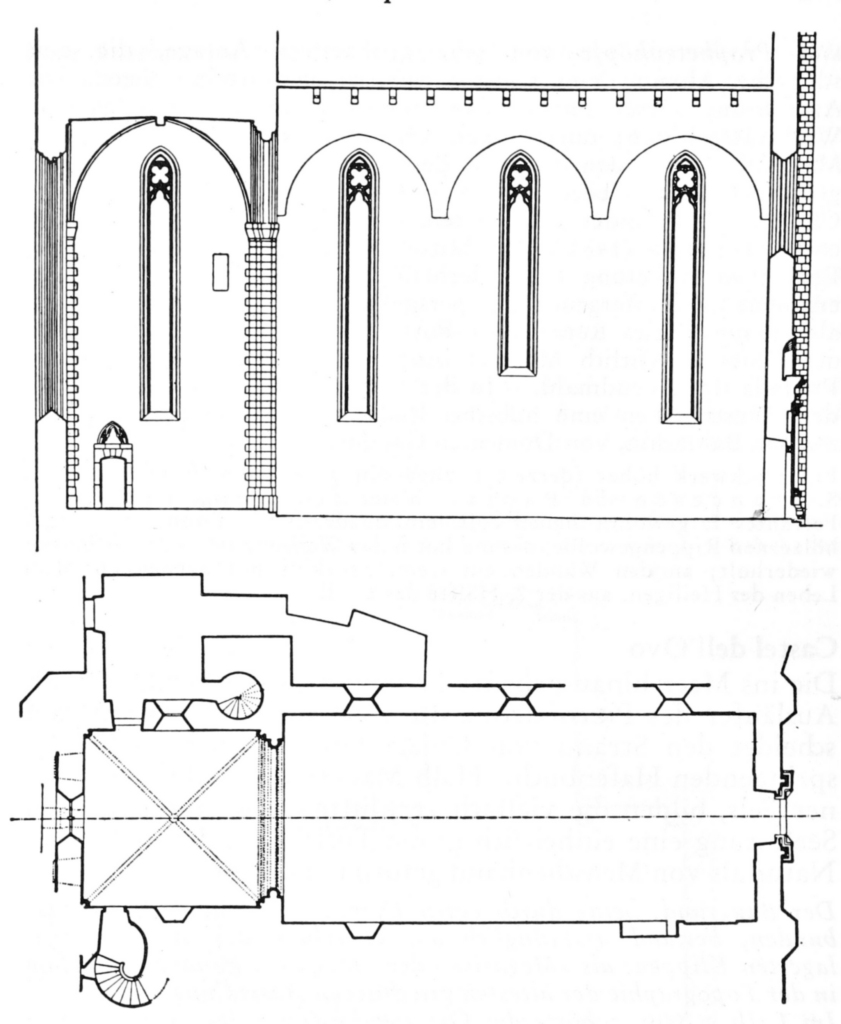 Castel Nuovo. Kapelle, Längsschnitt und Grundriß
Castel Nuovo. Kapelle, Längsschnitt und Grundriß
Stuck und in die Wände eingelassenen Leinwandbildern von Pietro del Pò. Die moderne Restaurierung hat alle diese Veränderungen so weit als möglich rückgängig gemacht; das trecenteske Mauerwerk wurde teils freigelegt, teils ergänzt, die Schmuckformen (Fenster, Triumphbogen etc.) nach aufgefundenen Bruchstücken hergestellt, eine neue Holzdeckung in die alten Balkenlöcher gelegt.
Leider stieß man nirgends mehr auf Spuren von Giottos berühmtem Fresken-Zyklus (vgl. S. 331); nur in den Fenstergewänden fanden sich Reste der urspr. Dekoration, darunter einige Heiligen-
und Prophetenköpfe von sehr großartiger Anlage, die eine schwache Ahnung von Giottos Spätstil vermitteln mögen. Die Ausführung dieser Partien lag zweifellos in den Händen von Werkstattgehilfen; unter ihnen vermutet man neuerdings jenen Maso di Banco, den Autoren des 15. Jh. als besten Schüler des großen Toskaners bezeichneten. — An der linken Seitenwand der Chorkapelle befindet sich ein feiner Marmor-Tabernakel von Jacopo della Pila (1481). Das Mittelrelief zeigt eine Kammer mit Engeln in Anbetung des Allerheiligsten; das Tabernakeltürchen erscheint im Hintergrund des perspektivisch dargestellten Raumes als monumentales Renaissance-Portal; im Tympanon ein segnender Christus, seitlich Muschelnischen mit Apostelfiguren, in der Predella das Abendmahl. — In der Sakristei rechts vom Chor über dem Waschbecken eine hübsche Madonnenstatuette in reich verziertem Baldachin, von Domenico Gaggini.
Ein Stockwerk höher (derzeit unzugänglich) liegt die Camera di S. Francesco da Paola, in der dieser Heilige 1483 als Gast Ferrantes I. gewohnt haben soll, ein quadratischer Raum mit einem hölzernen Rippengewölbe, das die Form der Wölbung der Sala dei Baroni wiederholt; an den Wänden ein Gemäldezyklus mit Szenen aus dem Leben des Heiligen, aus der 2. Hälfte des 17. Jh.
Castel dell’Ovo
Die ins Meer hinausgebaute Felsenburg beherrscht als südl. Ausläufer des Pizzofalcone die Küstenlinie der Stadt und scheidet den Strand von Chiaia von der nordwärts einspringenden Hafenbucht. Halb Mauerwerk, halb gewachsener Fels, bilden die vielfach zerklüfteten Wände der alten Seefestung eine einheitlich graue Tuffmasse, die mehr von Natur als von Menschenhand geformt erscheint.
Der Baugrund, heute durch einen Damm mit dem Festland verbunden, bestand ursprünglich aus einzelnen der Küste vorgelagerten Klippen; als »Megaris« oder »Megalia« kommen sie schon in der Topographie der ältesten griechischen Ansiedlung vor.
Im 1. Jh. v. Chr. gehörte der Ort zur Lustvilla des Lucullus, eine Rolle, für die er nach Lage und Form wie kein anderer prädestiniert erscheint, die aber seit dem Verfall der die Küsten schützenden röm. Seemacht für immer ausgespielt war. Ein »Castellum Lucullanum«, wohl am Pizzofalcone gelegen, wird 476 zum ersten Male erwähnt; es diente dem von Odoaker verbannten letzten Kaiser des röm. Reiches Romulus Augustulus als Aufenthaltsort. In den Ruinen der Villa auf der Megaris hausten damals schon fromme Einsiedler; ihre Gründung ist die dem Salvator geweihte Kirche, die dem Eiland im frühen Mittelalter seinen Namen gab.
Zu Beginn der Normannenzeit wurde die Insel zur Festung ausgebaut. Kaiser Friedrich II. bewahrte in ihr seinen Staatsschatz auf und ließ von einem Florentiner Architekten namens Fuccio
neue Türme errichten. Unter der angiovinischen Herrschaft diente das Kastell hauptsächlich als Gefängnis. Zur Zeit Roberts d. Weisen soll Atanasio Primario mit dem weiteren Ausbau beschäftigt gewesen sein. In einem Dokument von 1278 taucht zum ersten Male die Bezeichnung Castel dell’Ovo (»chastel de leuf«) auf; sie ist mit der mittelalterl. Vorstellung von Vergil als einem Magier, Propheten und heidnischen Thaumaturgen verknüpft, dem auch das technische Wunderwerk der Erbauung dieses Wasserschlosses zugetraut wurde. Dabei soll er ein Ei in eine Flasche hineingezaubert und diese wiederum in einen eisernen Käfig eingeschlossen haben, der in einem Raum des Kastells aufgehängt wurde; so lange dieses Ei unversehrt bleibe, werde die Burg und mit ihr Neapel dauern. — Die weitere Geschichte berichtet hauptsächlich von Kämpfen und Eroberungen, in deren Verlauf der alte Baubestand weitgehend vernichtet wurde. Seit 1860 gehört das Kastell der Kriegsmarine, die eine Besichtigung nicht gestattet.
Die heute sichtbaren Baulichkeiten dürften zum überwiegenden Teil aus dem späteren 16. und 17. Jh. stammen; von einigem Interesse scheinen die Reste eines frühmittelalterl. Säulenhofes von 2 x 2 Arkaden
 Castel dell’Ovo, Salvatorkirche, Grundriß
Castel dell’Ovo, Salvatorkirche, Grundriß
und die viell. aus dem 7. Jh. stammende, barock restaurierte Salvatorkirche, ein quadratischer Raum mit 3 (ehemals 4) Ecksäulen und unregelmäßigen Kreuzarmen, einer davon mit Rundapsis.
Castel S. Elmo (auf dem Gipfel des Vomero, oberhalb der Certosa di S. Martino)
Das Kastell führt seinen Namen nach einer dem hl. Erasmus (Eramo, Ermo) geweihten Kirche, die zuerst im 10. Jh. erwähnt wird. Den Land und Meer überblickenden Punkt mit einem »Palatium sive Castrum« zu bebauen, war ein Gedanke Roberts d. Wei-
sen, der dabei zunächst wohl mehr eine Sommerfrische für sich und seinen Hofstaat (»pro hilaritate personae nostrae et aliarum personarum curiam nostram sequentiam«) im Sinne hatte als eine strategische Anlage. Natürlich war eine Lustvilla auf dem damals noch ganz unbebauten, mit Wald und Buschwerk bewachsenen Hügel nicht anders als befestigt zu denken. Der Bau des »Belforte« wurde 1329 begonnen und scheint 1343 im wesentlichen beendet gewesen zu sein; als Architekten treten (wie an der benachbarten Certosa) zuerst Francesco di Vito und Tino di Camaino auf, seit 1336 Atanasio Primario und nach dessen Tode, 1340, Balduccio de Bacza. Vom Aussehen des turm- und zinnenbewehrten Burgpalastes können nur noch Veduten des 15. Jh. eine ungefähre Vorstellung vermitteln; seine Mauern verschwanden spurlos, nachdem Karl V. seinem Statthalter Pedro di Toledo befohlen hatte, den Platz in eine moderne Festung zu verwandeln.
Tatsächlich repräsentiert die 1536-46 von dem spanischen Militärarchitekten Pier Luigi Scriva (Pedro Luis Escrivà) errichtete Zwingburg, deren bedrohlich gezackter Kontur seitdem das Stadtbild beherrscht, den fortgeschrittensten Stand der damaligen Kriegstechnik. Der Grundriß hat die Form eines leicht in die Länge gezogenen 6strahligen Sterns, so daß die Außenwände nach jeder Seite einspringende Winkel (»Scheren«) bilden. Das Profil der Mauern ist bis zu zwei Dritteln ihrer Höhe geböscht; der darüber aufgehende Teil enthält einen ringsumlaufenden Wehrgang mit Schießscharten für Geschütze. Dahinter liegt eine ebene Plattform, die die zum großen Teil in den Felsen gehauenen Magazin-und Wirtschaftsräume bedeckt; die Wohntrakte stehen als niedrige Aufbauten in der Mitte und sind so vom Verteidigungssystem Völlig abgesondert. Auf die Anlage von Türmen hat Scriva konsequent verzichtet; dafür sind in die Böschungsmauern gedeckte Geschützstände eingebaut, die Flanken und Gräben bestreichen können. 1587 flog nach einem Blitzschlag in die Pulverkammer ein Teil des Gebäudes in die Luft, wobei 150 Mann der Besatzung den Tod fanden; im 18. Jh. hatte das Kastell mehrmals unter schweren Beschießungen zu leiden. Es dient nach wie vor militärischen Zwecken und kann aus diesem Grunde nicht besichtigt werden (vgl. dafür das Modell im Museo di S. Martino, Saal 76); sehenswert wären — außer der Aussicht — die verschiedenen unterirdischen Rampen, Zisternen (eine von ihnen soll 30 x 40 m messen) und Verteidigungsanlagen, ferner eine der S. Maria del Pilar geweihte Kapelle,
von 1682, und die Kirche S. Erasmo, 1547 errichtet, 1587 zertrümmert und danach wieder aufgebaut, mit Grabmälern des 16.-18. Jh.
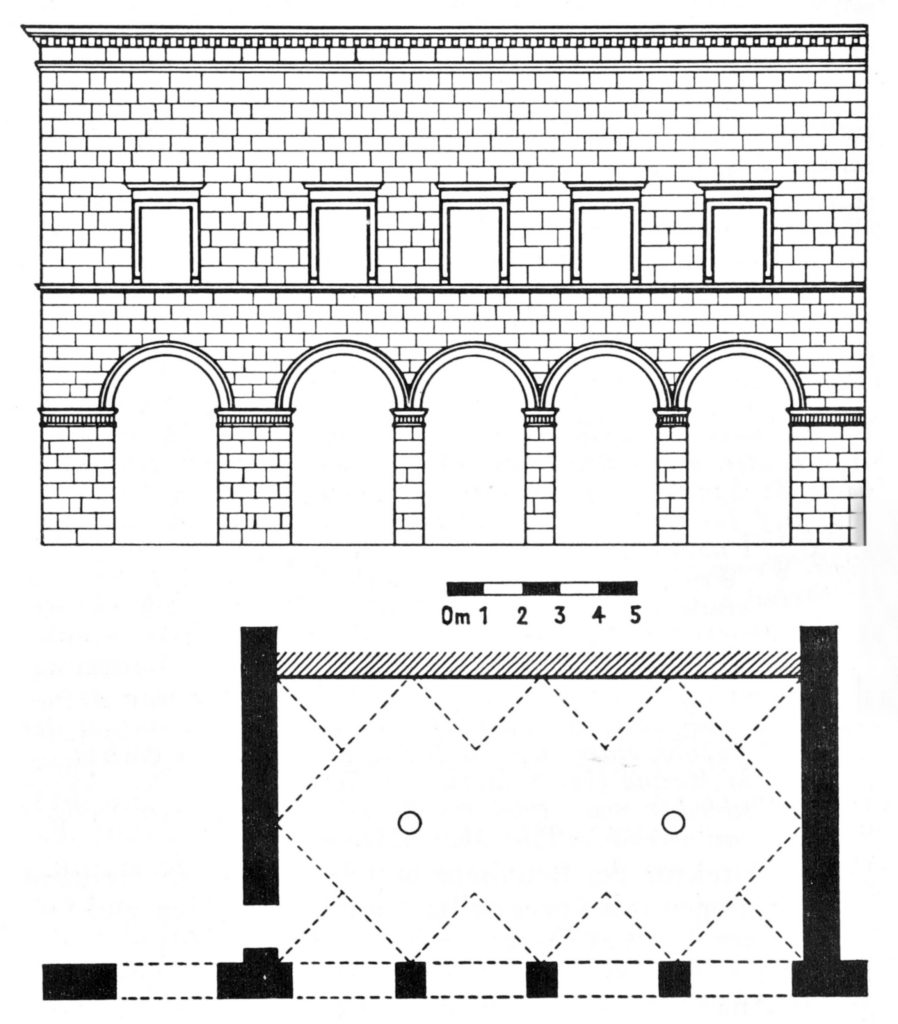 »La Conigliera«. Fassade und Grundriß
»La Conigliera«. Fassade und Grundriß
»La Conigliera« hieß eine Landvilla Alfons’ II. von Aragon am Abhang unterhalb von S. Potito, von der ein Überrest im Hof des Hauses Vico Luperano 7 (westl. der Via Pessina) sich erhalten hat. Der Name zeigt an, daß der Herzog sich hier dem Sport der Kaninchenjagd zu widmen pflegte. Zu sehen ist die durch spätere Umbauten entstellte Fassade eines sehr
einfachen 2geschossigen Baues, in Peperinquaderwerk mit Marmorprofilen; unten 4 rundbogige Pfeilerarkaden (eine 5. läßt sich rechts ergänzen), die in eine geräumige muldengewölbte Halle führten, darüber kleine Rechteckfenster mit einfachen Gesimsen. Von den weiteren Teilen der Anlage ist leider kein Bild mehr zu gewinnen.
Fontana dell’Immacolatella (auch del Gigante, an der Uferstraße Via. Nazario Sauro, bei S. Lucia)
Wie fast alle neapolitan. Brunnenanlagen hat auch diese eine lange Wanderschaft hinter sich. Ihr erster Aufstellungsort (1601) befand sich an der SW-Ecke des Palazzo Reale, am Eingang der heutigen Via Cesario Console. Als Nachbarn erhielt sie dort 1668 den in den Ruinen von Cumae aufgefundenen Torso einer überlebensgroßen Sitzfigur des Zeus, der auf einen hermenartigen Sockel gesetzt und mit 2 wappenhaltenden Stuckarmen versehen wurde. Analog zu Roms berühmtem »Pasquino« wurde der Gigante del Palazzo bald zum Volkshelden und Protagonisten zahlloser literarisch-politischer Kontroversen, dem die aufsässigen Neapolitaner beißende Spottverse gegen ihre Obrigkeit in den Mund legten. 1807 ließ Joseph Bonaparte das subversive Monument beseitigen; es landete nach einigen Irrfahrten in den Depots des Nationalmuseums. Wenig später (1815) fiel auch der Brunnen einer Straßenerweiterung zum Opfer; ein neuer Platz fand sich vor der Immacolatella Vecchia, dem hübschen, von D. A. Vaccaro entworfenen Gerichtsgebäude auf der gleichnamigen Male (heute Sitz der Capitaneria del Porto). Beim Bau der Hafeneisenbahn (1869) mußte er auch dort verschwinden; er taucht wieder auf in der Villa del Popolo, einer in jenen Jahren eingerichteten Parkanlage an der Via Marina (bei S. Maria del Carmine), der kein langes Leben beschieden war. 1906 erhielt er endlich seinen jetzigen Standort, mit herrlichem Blick über Hafen und Golf.
Die Architektur des Brunnens besteht aus einem 3teiligen Triumphbogen mit vorgestellten dorischen Säulen und Gebälkstücken; reiches Ornament aus Voluten, Wappen, Vasen und Obelisken lockert den Umriß auf. Typologisch gesehen handelt es sich um die freie Weiterbildung eines von D. Fontana in Rom entwickelten Wandbrunnen-Schemas (Acqua Felice, 1587), das letzten Endes auf antik-röm. Wasserschlösser zurückgeht (sog. »Trofei di Mario«). Freilich ist hier die Wassermenge ungleich bescheidener als bei den »Mostren« der großen röm. Aquädukte; so beschränkt das eigentliche Brunnenmotiv sich auf eine zierliche Schale, nach Art früher Renaissancefontänen. Sie wurde urspr. von Sirenen getragen (wie bei der Fontana di S. Lucia, s. S. 365),
heute sind robbenähnliche Seetiere an deren Stelle getreten. Die beiden Tritonen unter den Seitenbögen stammen von Pietro Bernini; als Werk M. Naccherinos gelten die Seejungfrauen, die gleich Galionsfiguren die Flanken des Bogens stützen.
Die Fontana di Montoliveto (auf der gleichnamigen Piazza), 1668 von Donato Antonio Cafaro errichtet, ist der einzige Monumentalbrunnen Neapels, der seinen angestammten Ort durch die Jahrhunderte hat behaupten können. Dies ist ein wahres Glück, da die Lage zwischen S. Anna dei Lombardi, Palazzo Gravina und Calata Trinità Maggiore, mit Ausblick auf die Guglia dell’Immacolata, nach jeder Seite den passenden Hintergrund bietet. Überdies nimmt die dreispitzartige Grundform des Brunnenbeckens, die sich bis in die oberste Spitze des Aufbaus fortsetzt, auf den Umriß des Platzes Bezug. In der Mitte des Beckens erhebt sich auf breitem Sockel eine von dicken Voluten umgebene »Guglia«, deren Einzelformen ein intensives Studium der Werke Fanzagos verraten. Mit dem Ornament verschmilzt der plastische Schmuck (Löwen, Adler und Drachen) zu einem reich bewegten Gesamtgebilde. Obenauf steht in absolutistischer Herrscherpose, mit Rüstung, Zepter und wehendem Mantel, das Bronzefigürchen des damals 7jährigen Königs Karl II., der nach dem Tod seines Vaters Philipp IV. 1665 im Alter von 4 Jahren die spanische Krone geerbt hatte. Die Neapolitaner hegten für den bronzenen »reuccio« allezeit freundliche Gefühle und verschonten ihn auch beim Jakobinersturm von 1799, dem die anderen Königsdenkmäler der Stadt zum Opfer fielen.
Fontana del Nettuno (Fontana Medina; Piazza Giov. Bovio) Neapels größter und prächtigster Brunnen bildet heute den Mittelpunkt der Piazza vor dem Börsenpalast.
Während der ersten Jahrzehnte seines Bestehens hat er gleich dreimal den Ort gewechselt. Die Erstaufstellung, 1600/01, erfolgte am Hafen in der Nähe des Arsenals; 1629-34 zierte der Brunnen den Largo del Palazzo vor dem Palazzo Reale; dann wurde er in S. Lucia beim Castel dell’Ovo aufgebaut; 1639 schließlich ließ der Vizekönig Ramiro de Guzman, Herzog von Medina, den ganzen Apparat in die damals von ihm instand gesetzte Strada delle Corregge (Via Medina) schaffen. Dort verblieb der Brunnen bis zu
einer neuen Straßenregulierung im Jahre 1886; seinen jetzigen Platz erhielt er 1898.
Über den Urheber des Gesamtentwurfs besteht keine Klarheit. Die Bildhauerarbeiten teilten sich Michelangelo Naccherino und Pietro Bernini, jene beiden aus Toskana zugewanderten Meister, die der von den Schülern und Enkelschülern Giovannis da Nola beherrschten neapolitan. Bildhauerei um die Wende des Cinquecento zu neuen Ideen verhalfen; als Architekt oder Ingenieur war auch der in Rom geschulte Domenico Fontana beteiligt. Bei den Umsetzungen von 1634 und 1639 nahm Cosimo Fanzago umfangreiche Ergänzungen vor.
Der architektonische Typus der Anlage, die Fontäne auf einer von Wasser umflossenen Rundinsel (»fontana isolata«), stammt aus der florentinischen Gartenkunst des 16. Jh.; eine Anregung durch die Antike scheint auch hier nicht ausgeschlossen (sog. »Teatro Marittimo« der Hadrians-Villa bei Tivoli). Ein unmittelbares Vorbild lieferte der große Brunnen auf der Piazza Pretoria in Palermo, urspr. für die Florentiner Villa des Don Pedro di Toledo in Auftrag gegeben (von Naccherino und Camilliani, 1550-80).
Der besondere Reiz des Neapler Werkes liegt in der von Stufe zu Stufe wechselnden Grundrißform (an der freilich die spätere Umarbeitung durch Fanzago, s. u., einigen Anteil haben dürfte). Der Sockel des Inselmassivs ist zu ebener Erde von einem Kleeblatt kurvig ausschwingender Becken umgeben. Dazwischen steigen 4 radial angeordnete Treppen auf; sie münden in eine mit Balustraden umsäumte kreisrunde Plattform, die ein weiteres Wasserbecken enthält. Aus ihm steigt eine 3. Brunnenfassung hervor, diesmal von vierpaßähnlicher Grundform (Quadrat mit eingerundeten Ecken und ausgebuchteten Seiten; die Konkavbögen fangen jeweils die Achsen der Treppen auf). In seiner Mitte erhebt sich ein von Wasserfluten überströmter Berg; auf diesem endlich steht ein großer Baluster, der eine maskengeschmückte Schale trägt.
Über die Verteilung der (an sich nicht sonderlich bedeutenden, auch vielfach ergänzten) Marmorskulpturen an die einzelnen Hände geben Rechnungsbelege Auskunft. Danach stammen von Pietro Bernini die 4 auf Meerwesen reitenden jugendlichen Tritonen auf dem oberen Beckenrand. Naccherino schuf die Figuren der Mittelgruppe: Je 2 Satyrn und Nymphen stützen die Brunnenschale; über deren Rand schauen 4 Hippokampen hervor; zwischen ihnen steht hoch aufgerichtet Neptun mit einem wassersprühenden Dreizack (nach einer Idee von Stoldo Lorenzi im Boboli-Garten zu Florenz).
Die Restaurierung Fanzagos scheint v. a. die untere Zone des Monuments betroffen zu haben. Von ihm sind jedenfalls die aus großen Voluten gebildeten Treppenwangen mit den 8 wappenhaltenden Löwen (Wappen der Stadt und des Herzogs von Medina), wahrscheinl. auch die Treppenstufen und viell. sogar die ganze Sockelbildung mit den ineinandergreifenden Bögen von Treppen und Brunnenfassungen (vgl. dazu die Treppe vor S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone); der Grundriß der 1. Anlage wäre dann im Sinne des Brunnens von Palermo mit kreisrundem Sockelbecken und geradlinig begrenzten Treppen zu denken. Ferner stammen von Fanzago die 4 Wappen des spanischen Königs Philipp IV., bewacht von paarweise angeordneten Meerungeheuern, auf dem Brunnenrand gegenüber den Treppen, sowie das an der Balustrade angebrachte Löwenfell mit der Inschrift.
Fontana del Pendino (della Sellaria; Via del Grande Archivio)
Die Fontana steht seit 1903 beim Konvent von SS. Severino e Sossio; ihr urspr. Standort war an der Piazza della Sellaria (heute Nicola Amore, am Rettifilo). Sie bildete dort das Gegenstück zu einem spurlos verschwundenen Brunnen von Giov. da Nola, der einen globustragenden Atlas und die Wappenembleme Karls V. zeigte (1537 von Don Pedro di Toledo in Auftrag gegeben). Der Entwurf unseres Brunnens, von 1650-53, geht wahrscheinl. auf Cos. Fanzago zurück.
Der Brunnen besteht aus einer monumentalen Bogenpforte (die ehemals einen weiten Straßendurchblick gewährte) mit Säulenädikula, Sprenggiebel und Volutenfüllung; darüber die Wappen König Philipps IV., seines Statthalters Conte d’Ognatte und der Stadt Neapel, flankiert von 2 Zierobelisken. Eine große Inschrifttafel feierte die Milde und Weisheit des in Wahrheit ziemlich tyrannischen Vizekönigs. Das Wasser sprang aus 2 Masken im Gewände des Bogens in eine Marmorschale; darin noch ein künstlicher Felsbrocken mit Fontäne.
Die Fontana dei Quattro del Molo auf der alten Mole ist heute verschwunden, soll aber hier erwähnt werden als bisher unbeachteter Vorläufer von Berninis Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona zu Rom. Die »Vier von der Mole« waren nämlich Flußgötter, die die 4 Weltströme Euphrat, Tigris, Nil und Ganges personifizierten; sie lagen oder hockten an den Ecken eines oktogonalen Beckens; zwischen ihnen sprangen Delphine; eine darüber sich erhebende Brunnenschale zeigte die Figuren Apolls (viell. eine Antike), des Flußgottes Sebeto und der Sirenen. Der Entwurf des Brunnens stammt von Antonio Castaldi, die Ausführung (1560-62) lag in den Händen von Annibale Caccavello und Girolamo d’Auria. 1669 wurden die »Quattro« von einem räuberischen Vizekönig nach Spanien verbracht; die übrigen Teile fielen später dem Neubau der Hafenanlagen zum Opfer.
Fontana del Sebeto (di Fonseca; Via Mergellina)
Zuerst stand der Brunnen am unteren Ende der Strada del Gigante (Via Cesare Console). Er wurde 1829 abgebrochen, 1939 hier aufgestellt und dabei, so gut es ging, restauriert. Sein Schöpfer ist Carlo Fanzago, der früh verstorbene Sohn des Cosimo; der Auftrag wurde 1635 vom Vizekönig Manuel Zunica y Fonseca erteilt.
Sebeto ist der Name des Flüßchens, das sich am O-Rand der Stadt ins Meer ergießt. Wie in Italien so oft, stehen die mythologisch-literarischen Dimensionen dieses Wasserlaufs in keinem Verhältnis zu seiner realen Natur. Tatsächlich hat es seit jeher Mühe verursacht, das 9 km lange Rinnsal als Fluß überhaupt zu erkennen; Boccaccio zum Beispiel machte sich vergebens nach ihm auf die Suche. Indessen trieben die neapolitan. Humanisten, nach dem Vorbild Vergils (Aeneis VII) und anderer klassischer Autoren, mit ihrem Sebeto einen jahrhundertelangen Kult; er fand seinen Niederschlag nicht nur in zahlreichen bildlichen Darstellungen, sondern auch in der Konstruktion gewaltiger Brücken, die von Fremden vielfach bewitzelt wurden (Ponte della Maddalena, S. 328.)
Der Flußgott liegt hier über der Brunnenschale, vor der Öffnung eines großen Bogens, wie ihn schon die Brunnen vom Anfang des Jahrhunderts zeigten. Die Architektur ist in der Art Fanzagos verformt und verschnörkelt, das Ornament ins Monumentalformat gesteigert; allein die Wasserbehandlung bleibt renaissancemäßig fein und beschränkt sich auf dünne Bogenstrahlen, die in einzelne Schalenbecken springen. Sehr schön die beiden kauernden Tritonen an den Flanken des Bogens.
Cosimo Fanzago, Fontana del Sebeto - Gesamtansicht, 1635.
Cosimo Fanzago, Triton und Personifikation des Sebeto, Fontana del Sebeto, 1635
Die Fontana delle Zizze (auch Fontana Spinacorona; ehem. in der Via Giuseppina Guacci Nobile bei der Piazza Nicola Amore), ein heute zerstörtes Wandbrünnlein aus der Zeit Don Pedros di Toledo, besaß eine einzigartige Ikonographie: Die Sirene Parthenope, mit Flügeln und Vogelfüßen, besänftigte den Vesuv, indem sie aus ihren Brüsten 2 Wasserstrahlen in den flammenspeienden Krater springen ließ; die Inschrift lautete: »Dum Vesuvii Syren incendia mulcet.« Daneben das Wappen Karls V. mit den Säulen des Herkules und der Devise »plus ultra«. Der kopflose Torso der Sirene heute im Museo di S. Martino.
Palazzo Reale (Piazza del Plebiscito, ehemals »Largo di Palazzo«; vgl. S. 110)
Seit seiner Erbauung i. J. 1600 bildet der Palast die Hauptresidenz der neapolitan. Könige und damit die letzte Etappe einer 1000jährigen Wanderschaft.
Der älteste Herrschaftssitz von Neapel, der Palast der byzantin. Statthalter und später der Herzöge, lag auf dem Hügel von Monterone (etwa bei SS. Marcellino e Festo). Normannen und Staufer residierten in den Castelli dell’Ovo und Capuano; die Anjou erbauten sich Castel Nuovo und Castel S. Elmo; Alfons von Aragon ließ das zerstörte Castel Nuovo wiedererstehen. Schon sein Sohn Ferrante I. plante — vermutl. in der Gegend des heutigen Palazzo Reale — eine neue »Reggia« in Form eines unbewehrten Palastes
von königlicher Grandezza; der erstaunliche Plan Giulianos da Sangallo, 1488 als Geschenk des Lorenzo de’ Medici dem König überreicht, blieb allerdings unausgeführt. Don Pedro di Toledo, Statthalter Karls V., schuf neue Räumlichkeiten innerhalb des Castel Nuevo; zugleich aber ließ er durch Ferd. Manlio den (später sog.) Palazzo Vecchio erbauen, einen von Ecktürmen eingefaßten Wohnpalast, der einen Teil der jetzigen Piazza Trieste e Trento zwischen Palazzo Reale und Teatro S. Carlo ausfüllte.
1599 beschloß der Vizekönig Don Fernandez Ruiz de Castro, in Erwartung eines Besuches Philipps III. von Spanien, die Errichtung einer neuen Residenz. Sein Architekt war Domenico Fontana (vgl. S. 43), der während des Pontifikats von Sixtus V. die Verwandlung Roms in eine moderne Hauptstadt eingeleitet, sich dann aber nach Neapel begeben hatte, wo er seit 1592 in königlichen Diensten stand. Er entwarf ein Gebäude von riesigen Dimensionen, mit 3 nebeneinanderliegenden Innenhöfen und einförmig in die Breite gedehnter Fassade: für Italien der erste entschiedene Schritt von der Typologie der Renaissance — feudales Kastell oder bürgerlich-städtischer Würfelpalast — zum Fürstenschloß des Absolutismus. Nach Fontanas Entwurf entstanden seit 1600 der Frontbau und der mittlere Hof; schon 1602 konnte der Vizekönig seine Gemächer im Piano Reale über dem Erdgeschoß beziehen. In späteren Jahren ging der Bau nur noch zögernd und unregelmäßig voran; große Teile des 1. Projekts blieben unausgeführt oder wurden einschneidend verändert. Die wichtigste Neuerung brachte das von F. A. Picchiatti erbaute Treppenhaus zur Linken des Hofes. An der Ausstattung des Inneren wurde fortdauernd gearbeitet; v. a. die großen Dekorateure des 18. Jh., von Solimena und Mura bis zu Fedele Fischetti, hinterließen zahlreiche Werke, von denen sich aber nur wenig erhalten hat. Sein heutiges Aussehen verdankt der Palast zu großen Teilen dem 19. Jh. Nachdem 1837 ein Brand im N- und O-Flügel des Schlosses gewütet hatte, ordnete Ferdinand II. eine durchgreifende Erneuerung des ganzen Gebäudes an. Unter Leitung von Gaetano Genovese wurde der Gesamtplan des Schlosses reguliert, von allerlei störenden Anbauten befreit und nach O erweitert. Den nördlich angrenzenden Palazzo Vecchio brach Genovese ab, um der neu dekorierten Haupttreppe Licht zu verschaffen; danach wurden die N-Front neu aufgeführt und der zum Castel Nuovo gerichtete rückwärtige Flügel mit dem Giardino Reale angelegt. Die dem Meer zugewandte S-Seite wurde gleichfalls völlig neu gestaltet, d. h. nach O verlängert, um ein Geschoß erhöht und mit einem zentralen Belvedere bekrönt; davor legte Genovese eine Gartenterrasse an, die durch eine Brücke mit dem Piano Reale verbunden wurde. — Im 2. Weltkrieg wurde der Palast mehrfach von Bomben getroffen, seither jedoch vollständig wiederhergestellt.
Fontanas Hauptfassade hat 3 Geschosse und 21 Fen-
sterachsen. Das Erdgeschoß ist in seiner ganzen Länge als Pfeilerportikus ausgebildet, in dem, nach Fontanas Erläuterungen, die Besucher des Königs wie auch die Wachsoldaten vor Sonne und Regen Schutz finden sollten. Nur die Eckachsen und die beiden Felder zu seiten des Hauptportals waren urspr. geschlossen; erst nachdem um 1750 der wahrscheinl. erdbebengeschädigte Frontbau einzustürzen drohte, wurde auf Anraten Vanvitellis jede 2. Arkade vermauert.
Die seitlich vorstehenden Flanken des Erdgeschosses gehören dem Umbau des 19. Jh. an. Was Fontana sonst zur Gliederung der riesigen Baumasse aufgeboten hat, ist ungemein bescheiden und verrät ein elementares Desinteresse an der künstlerisch-ausdrucksmäßigen Seite der Architektur. Die Geschoßhöhen nehmen von unten nach oben gleichmäßig ab (wobei aber die untere Zone 2 außen nicht sichtbare Halbgeschosse umfaßt). 3 Ordnungen von Pilastern — dorisch, ionisch, korinthisch, in den Obergeschossen mit rahmenden Rücklagen kombiniert — bilden ein über die ganze Fassade laufendes Rastersystem; die Fenster zeigen Segment-und Dreiecksgiebel in schachbrettartigem Wechsel. Die einzige Unterbrechung des Gleichtakts der Achsen liegt in der Mitte: das zentrale Wandfeld ist um einiges weiter, der Bogen des Eingangsportals dementsprechend leicht in die Breite gezogen; außerdem ist die flankierende Pilaster- bzw. Säulenstellung verdoppelt worden, wodurch sich die seitlich angrenzenden Felder etwas verengen, die betreffenden Fenster kleiner ausfallen als die übrigen. Von der hier sich bietenden Möglichkeit zur Aussonderung einer 3achsigen Mittelgruppe, etwa nach dem Vorbild von Vignolas Palazzo Farnese in Piacenza, hat Fontana keinen Gebrauch gemacht. Auch sind die Flanken völlig unbefestigt geblieben; die beiden Seitenportale (die den Zugang zu den geplanten seitlichen Höfen vermitteln sollten) sind zwar durch Säulen ausgezeichnet, setzen aber keine rhythmischen Akzente im Ablauf des Achsensystems.
Das Kranzgesims hätte nach Fontanas Entwurf eine Reihe von Zierobelisken (über den Pilastern) und Vasen (über den Fenstern) getragen. Der im 19. Jh. erneuerte Mittelaufsatz war urspr. etwas niedriger (Uhr und schmiedeeiserner Glockenstuhl), ähnliche Aufbauten sollten über den seitlichen Portalachsen erscheinen. Zu seiten des Hauptportals gedachte Fontana 2 bronzene Figuren (»Gerechtigkeit«
und »Religion«) aufzustellen. Eine Säulenplinthe am linken Portal trägt die »Signatur« des selbstbewußten Architekten: »Dominicus Fontana Patritius Romanus Auratae Militae Aeques Inventor«.
1888 wurden auf Wunsch König Umbertos I. die Nischen der verschlossenen Arkaden mit Statuen geschmückt, die die 8 Dynastien der Krone von Neapel repräsentieren: Roger d. Normanne — Friedrich II. von Hohenstaufen (er zertritt die päpstliche Bannbulle) — Karl I. von Anjou — Alfons I. von Aragon — Kaiser Karl V., ein Bilderbuch-Despot (das Gipsmodell V. Gemitos in Capodimonte, Saal 61) — Karl von Bourbon — der ungebärdige Joachim Murat — endlich Viktor Emanuel von Savoyen, unter dessen Herrschaft das »Regno di Napoli« im Königreich Italien aufging.
Domenico Fontana und Gaetano Genovese, Palazzo Reale - Hauptfassade, 1600, in Neapel.
Domenico Fontana und Gaetano Genovese, Palazzo Reale - Hauptfassade (Seitenansicht), 1600, in Neapel.
Domenico Fontana und Gaetano Genovese, Palazzo Reale - Hauptportal, 1600, in Neapel.
Domenico Fontana und Gaetano Genovese, Hauptfassade - Skulptur Kaiser Karl V, Palazzo Reale in Neapel.
Domenico Fontana und Gaetano Genovese, Hauptfassade - Skulptur König Karl III., Palazzo Reale in Neapel.
Ein geräumiges Vestibül führt in den quadratischen Innenhof von 5 x 5 Achsen, mit Portiken in 2 Geschossen (die oberen im 19. Jh. sehr hübsch verglast). Wiederum erweist sich Fontana als Meister darin, ein Minimum an Einfällen mit unerbittlicher Konsequenz zum System auszubauen. Die nüchtern-korrekten Gliederungsformen der Fassade (Pfeilerarkade, dorisch-ionische Pilasterordnungen) kehren ohne Abweichung wieder. Auch das Achsennetz ist strikt von außen nach innen durchgeführt, so daß wiederum der Mittelbogen breiter ist als die Norm; der daraus entstehende Rhythmus wird in den Seitenwänden symmetrisch wiederholt. Nach dem urspr. Plan sollte sich rechts und links je ein weiterer Hof anschließen; die dazwischen liegenden Portiken wären beiderseits offen gewesen und hätten, nach Fontanas Beschreibung, »den Augen Gelegenheit geboten, von einem Hof in den anderen zu spazieren«.
Heute gelangt man vom linken Portikus aus sogleich in das kolossale Treppenhaus, den architektonisch reizvollsten Teil des Gebäudes. Sein jetziges Aussehen verdankt es dem Umbau des 19. Jh., doch scheinen das Ausmaß der Anlage wie auch die Führung der Treppenläufe schon auf das 17. Jh. zurückzugehen. Als Auftraggeber dieser ersten großen Prunktreppe, der zuliebe der Hauptsaal des damaligen Schlosses niedergelegt wurde, werden einmal der Vizekönig de Guzman (1631-37), ein andermal sein Nachfolger de Guevara (1648-53) genannt; Architekt war Francesco Antonio Picchiatti, der Sohn des Bartolomeo Picchiatti aus Ferrara, der noch unter Domenico Fontana
am Bau des Schlosses gearbeitet hatte. Die beiden Arme der Treppe waren so angelegt, daß man über den linken die königlichen Gemächer, über den rechten die Palastkapelle erreichte; ein Mitteldurchgang im Untergeschoß führte in den nördlich angrenzenden Palazzo Vecchio.
Stellt man sich die barocke Anlage nach dem Muster der heutigen vor, so wäre sie eine überraschende Vorwegnahme von Le Vaus berühmter Gesandtentreppe im Schloß zu Versailles; doch erlaubt die einzige ältere Abbildung, ein Gemälde von Antonio de Dominici (2. Hälfte 18. Jh.), in dieser wichtigen Frage noch kein sicheres Urteil. Jedenfalls wurde die Treppe nach dem Tode bzw. der Abberufung des Auftraggebers nur notdürftig fertiggestellt und mehr oder weniger provisorisch dekoriert. 1838-42 konsolidierte Gaetano Genovese das Mauerwerk, errichtete das große Muldengewölbe (bis 1858 im Bau) und entwarf eine neue Wandgliederung. Die wichtigste Veränderung wurde durch den Abbruch des Palazzo Vecchio ermöglicht: In die dadurch freigewordene N-Wand legte Genovese 7 lichtspendende Bogenfenster, deren Achsenfolge den Rhythmus der Hofarkatur Fontanas von der gegenüberliegenden Wand übernimmt. Die Dekoration prunkt mit den farbigen Marmorsorten des Königreichs.
Im rückwärtigen Flügel des Obergeschosses befindet sich die der Maria Assunta geweihte Kapelle. Ihre zentrale Lage gegenüber dem Haupteingang des Palastes scheint schon Fontana angeordnet zu haben; erbaut wurde sie erst 1640-46 nach einem Entwurf Fanzagos. Zwischen 1837 und 1859 schuf Genovese die heutige Dekoration (vordem große Pilasterordnung, Fresken von Giac. del Pò und Nic. Rossi). 1943 wurde der Raum schwer beschädigt, nach dem Kriege restaur. Die Ausstattung entstand gleichfalls im 19. Jh.; der Hochaltar, mit Intarsien von Achat und Lapislazuli, ist ein Werk des Dionisio Lazzari (1674-91), das 1808 aus S. Teresa degli Scalzi hierher überführt wurde.
Die Besichtigung der historischen Räume beginnt mit dem großen Saal am rechten (nördl.) Ende des Frontbaus, der 1768 durch Ferd. Fuga als Hoftheater eingerichtet wurde und im wesentlichen seine damalige Gestalt bewahrt hat (nach Bombenschäden 1950 restaur., die dekorativen Malereien vollständig erneuert). — In den folgenden Sälen eine beträchtliche Anzahl guter Bilder, Möbel und anderer Ausstattungsstücke; die Dekoration der
 Palazzo Reale. Obergeschoß, Grundriß
Palazzo Reale. Obergeschoß, Grundriß
Räume meist 19. Jh. — I (Mittelsaal). Großes Deckenbild von De Mura, 1734 (Apotheose der Monarchie), gerahmt von Architekturperspektiven von Vincenzo Re; 2 prächtige Gobelins nach Le Brun, darstellend die Luft (allerlei Vögel, darunter ein pausbäckiger Sturmgott mit Schmetterlingsflügeln) und das Feuer (Hephästos als Waffenschmied). — II. An der Decke Corenzio (Triumphzug des Alfons von Aragon); erstrangige Bilder: Ribera, Besuch der Hl. Familie beim hl. Bruno (von 1635, mit merkwürdig klassizist., an den späten Raffael anknüpfenden Momenten); Stanzione, Einkleidung des hl. Ignatius; Honthorst, Orpheus verzaubert die Tiere, die mit großen Augen seinem Saitenspiel lauschen. — III. 2 schöne Landschaften aus der Brill-Nachfolge. — IV. Thronsaal, ausgestattet um 1850. — V. Fortsetzung der Teppichserie aus dem Mittelsaal: die Erde mit ihren Tieren und Pflanzen, Obst, Gemüse und Ackergerät, das Wasser mit Neptun und Amphitrite, Tritonen und Frutti di Mare; an der Decke die Waffentaten der spanischen Könige, von Corenzio. — VI. Zuschreibungen: Tizian, Bildnis des Pier Luigi Farnese (eher aus dem Umkreis des Parmigianino); Baciccia, Bildnis eines Kardinals; Filippino Lippi, Hei-
lige Familie; ferner eine Heilige Familie von dem Spanier Pietro Ruviale; David als Sieger von Jan Lys. — VII. Deckenbilder von Corenzio oder Caracciolo. — Weitere wichtige Bilder: XI. Rückkehr des verlorenen Sohnes, ein Meisterwerk des Mattia Preti; ein Apostelkopf von Fracanzano; ein saitenspielender Orpheus von A. Vaccaro (ringsum vielerlei Tiere, im Hintergrund sogar ein Dromedar; die bedrohlich sich nähernden Mänaden lassen verstört die Waffen sinken); von demselben Jakob und Rahel, ferner die hl. Katharina im Gebet; von Stanzione Lot und seine Töchter; von Giordano ein Erzengel Gabriel und eine Verkündigung. — XIII. Die Geldwechsler von Marinus van Roymerswaele; niederländische Porträts des 17. Jh. — XV. Josephs Traum von Guercino (wohl Schulwerk); Hl. Familie und Almosenverteilung (Caritas) von Schedoni. — In dem großen Herkules-Saal (XVII) sind die Dekorationen vollständig erneuert; Wandteppiche mit der Geschichte von Amor und Psyche, nach P. Doranti (ca. 1780).
Der rückwärtige Flügel des Palastes (Eingang Via Vittorio Emanuele) beherbergt seit 1927 die berühmte Biblioteca Nazionale, deren enorme Bestände an Büchern, Inkunabeln, Autographen, illuminierten Manuskripten und Papyri den Krieg nahezu unversehrt überstanden haben.
Palazzo dell’Università (Corso Umberto I. [»Rettifilo«] / Via G. Paladino)
Kurz nach der Mitte des 16. Jh. als Jesuitenkolleg errichtet, bildet der Palast seit 1777 den Sitz der ruhmreichen, 1224 von Kaiser Friedrich II. gegründeten Universität von Neapel. Der am »Rettifilo« gelegene Trakt wurde 1897-1908 hinzugefügt.
Nach Passieren seines Hofes gelangt man zu einer weiträumigen barocken Treppenanlage (von Cos. Fanzago), die zu dem höher gelegenen Jesuitenbau hinaufführt. Der große Hof mit dorisch-ionischen Pfeilerportiken von 5 x 5 Achsen wurde 1605 begonnen, möglicherweise nach einem Entwurf des 1596 verstorbenen Jesuiten-Architekten Guiseppe Valeriano, und nach verschiedenen Unterbrechungen erst 1653 vollendet. Das alte Eingangsportal liegt in der O-Wand (Via G. Paladino 39; daneben die Kirche Gesù Vecchio).
Piazza Dante
Vormals Largo del Mercatello oder auch Largo della Spirito Santo. Der Platz wurde 1757-65 von der Bürgerschaft zu Ehren des ersten Bourbonenkönigs Karl III. zum »Foro Carolino« ausgebaut; den Entwurf lieferte Luigi Vanvitelli.
Wie fast alle Versuche, dem Stadtplan von Neapel herrschaftlich-monumentale Formen einzuprägen, trägt auch dieser einen sonderbar ephemeren Charakter. Einmal hat man sich von vornherein auf die Gestaltung der östl. Platzhälfte beschränkt, während die gegenüberliegende unregelmäßige Bauflucht der Via Toledo ganz unangetastet blieb.
Zum anderen scheint es an einem konkreten Bauprogramm gefehlt zu haben, das dem Platz — nach Aufhebung des hier beheimateten Marktes — noch ein vitales Interesse hätte sichern können. V. a. aber fällt die urbanistische Beziehungslosigkeit des Projektes ins Auge: Weder sind seine Achsen aus denen der angrenzenden Straßenzüge entwickelt, noch wirken sie in die Umgebung hinaus. Bezeichnend hierfür scheint die Behandlung der Port’Alba, eines auf die Platzfläche mündenden Stadttors aus dem 17. Jh. (1625 vom Vizekönig Antonio Alvarez de Toledo, Herzog von Alba, errichtet, 1797 restaur.; der obenauf stehende Schutzpatron ist S. Gaetano): Schon von sich aus ohne rechte Verbindung mit dem Straßennetz des antiken Zentrums, hat das Tor bei der Planung des Platzes überhaupt keine Rolle gespielt, ja es wurde geradezu aus dem Blickfeld verdrängt und hinter dem nördl. Flügel des Neubaus verborgen. So kehrt das »Forum« des Bourbonenkönigs dem alten Neapel den Rücken, während das Leben der neuen Hauptstadt formlos und gleichgültig an ihm vorbeiströmt.
Vanvitellis Platzarchitektur, angeregt von dem (unausgeführt gebliebenen) Brunnenprojekt Pietros da Cortona für die Piazza Colonna in Rom, besteht aus einer weitgeschwungenen Exedra von etwa halbelliptischer Grundgestalt; d. h. die Krümmung nimmt von. den Flügeln zur Mitte hin stetig ab und geht im Zentrum in die Gerade über. Als Gliederung des 2geschossigen Traktes tritt eine dorische Kolossalordnung auf, an den Stirnseiten der Flügel mit Pilastern, in der Rundung mit Halbsäulen; darüber läuft eine Dachbalustrade mit marmornen Statuen, darstellend die 26 (!) Tugenden des Monarchen. In der Mitte öffnet sich eine geräumige Nische; ihr Bogen durchbricht das Hauptgebälk und wird von einem Attikaaufbau eingefaßt. Der vierschrötige Glockenturm ist eine spätere Zutat; Vanvitelli plante an seiner Stelle eine kurvig gerahmte Wappenkartusche. Vor der Nische sollte auf hohem Sockel ein Reiterbild des Königs stehen; ein Stuckmodell wurde 1765 aufgestellt und während der Revolution von 1799 zerstört, ein 2. Modell von 1801 stürzte nach wenigen Jahren Von selber um. 1872 wurde das Dante-Denkmal errichtet.
Porta Capuana (auf der gleichnamigen Piazza nordwestl. des Hauptbahnhofs) ist eines der schönsten Stadttore von Italien.
Die aragonesische Stadtmauer (s. S. 22), (von deren N- und O-Trakt sich ansehnliche Teile erhalten haben (Via Rosaroll, Via Carriera Grande, Via Carmignani), verlief ein Stück außerhalb des Castel Capuano, das seit normannischer Zeit den NO-Eingang der Stadt gebildet hatte. Das neue Tor wurde zwischen 1484 und 1488 von Giuliano da Maiano aus Florenz errichtet, später durch vielfache Anbauten entstellt, kurz vor dem 2. Weltkrieg wieder freigelegt und sorgfältig restauriert.
2 mächtige Rundtürme der Stadtmauer — genannt Onore und Virtù, Ehre und Tugend — flankieren den Torbogen. Seine marmorne Außenwand hat Giuliano, in richtiger Einsicht in die damit gegebene Situation (und im Gegensatz zu den Architekten des Triumphbogens am Castel Nuovo) als reines Relief behandelt; sie wirkt monumental nicht durch voluminöse Einzelformen (Säulen, Verkröpfungen o. ä.,) sondern allein durch die Größe und Klarheit der Linienführung und die klassische Festigkeit der Verhältnisse. Um die rundbogige Durchfahrt zieht sich eine breite, trophäengeschmückte Archivolte; sie wird von 2 Kompositpilastern und einem glatt durchlaufenden Gebälk gerahmt; der als Volutenkonsole ausgebildete Schlußstein verklammert Bogen und Architrav. In den Zwickelfeldern schweben Viktorien, darunter stehende nackte Figürchen wie am Trajansbogen in Benevent (vgl. auch Castel Nuovo, S. 339). Die Frieszone des Gebälks ist ungewöhnlich hoch: sie trug urspr. ein reliefiertes Reiterbildnis Ferrantes I., das 1535 entfernt werden mußte, weil Kaiser Karl V. durch dieses Tor in die Stadt einzuziehen wünschte (am Castel Nuovo, S. 340, der gleiche Vorgang). Der Frieshöhe einigermaßen angepaßt ist das stark ausladende Kranzgesims; es sorgt zugleich für einen deutlich markierten Abschluß der eigentlichen Torarchitektur, während die darüber erscheinenden Zinnen die Linie der Flankentürme aufnehmen. Die an ihnen erscheinenden Wappen sollen auf eine 1535 von Giov. da Nola unternommene Restaurierung zurückgehen; als Werk des gleichen Künstlers gelten die beiden Nischenfiguren des Frieses (S. Gennaro und S. Agnello).
Giuliano da Maiano, Porta Capuana, 1484, Neapel.
Die Porta Nolana (Piazza Nolana am Corso Garibaldi, der die Stelle des alten Befestigungsgrabens einnimmt) in der O-Partie der aragonesischen Mauer zeigt bescheidenere Dimensionen. Die flankierenden Türme
heißen Fede und Speranza — Glaube und Hoffnung; das Reiterbild Ferrantes blieb hier erhalten.
Teatro S. Carlo (an der N-Flanke des Palazzo Reale)
Neapels berühmtes Opernhaus blickt nicht nur auf eine Kette glänzender Musikereignisse (Uraufführungen von Rossini, Bellini, Donizetti), sondern auch auf eine bewegte Baugeschichte zurück. Auf Befehl König Karls III., der »in der kürzest möglichen Zeit das größte Theater Europas« gebaut haben wollte, errichtete Angelo Carasale nach einem Entwurf G. A. Medranos den Bau in angebl. 8 Monaten (März — Okt. 1737); die Eröffnungsvorstellung fand am 4. Nov. (S. Carlo, dem Namenstag des Königs) statt. 1762 wurde Giov. Maria Bibiena aus Bologna nach Neapel gerufen, um Akustik und Bühneneinrichtungen zu verbessern. Die Innendekoration erfuhr eingreifende Veränderungen durch F. Fuga (1768), D. Chelli (1797) und Antonio Niccolini (1810-12; vgl. dessen Zeichnungen und Aquarelle im Museo di S. Martino, Saal 40). Gleichzeitig errichtete dieser den Eingangstrakt an der Via Vittorio Emanuele III.; er bildet den ältesten Teil des heute stehenden Baues.
Als Untergeschoß fungiert ein 5achsiger Pfeilerportikus (Wagendurchfahrt) mit derber Rustika-Gliederung; darüber öffnet sich eine ionische Kolonnade mit verglaster Rückwand (Foyer); das gerade Gebälk wird von einer schweren Giebel-Attika bekrönt. 1816 zerstörte ein Feuer das Innere des Gebäudes; der Neuaufbau lag wiederum in den Händen Niccolinis. Unverändert blieben dabei die beträchtlichen Grundmaße von Bühnenhaus (33,1 x 34,4 m) und Zuschauerraum (26,6 )( 22,5 m, 6 Ränge, 3000 Plätze).
Die Dekoration erhielt ihre endgültige Gestalt 1841, immer noch unter Leitung A. Niccolinis, durch seinen Sohn Fausto und F. M. del Giudice; das von Niccolini entworfene kreisrunde Deckenbild malte Gius. Cammarano (Apollo, Minerva und die berühmtesten griech., latein. und italien. Dichter).
Teatro Mercadante (urspr. Teatro del Fondo, an der Piazza Municipio gegenüber dem Castel Nuovo),
1778 von Francesco Sicuro errichtet, später mehrfach restauriert. Zur Eröffnung am 20. Juli 1779 spielte man Cimarosas »L’infelicita fedele«. Hinter der unerfreulichen Fassade von 1892 verbirgt sich ein hübscher Innenraum, auch er freilich 1849-51 neu ausgestattet und 1892 restauriert.
Villa Comunale (Villa Reale)
Neapels großer Stadtpark erstreckt sich entlang der Riviera di Chiaia vom Chiatamone (Piazza della Vittoria) bis zur Mergellina (Piazza Principe di Napoli).
Sein Vorläufer war die Via Medinacoeli, so genannt nach dem Herzogstitel des Vizekönigs Luis de la Gerda, der 1697 den alten Strandweg pflastern und mit Weiden bepflanzen ließ, um der Stadt eine würdige »pubblica passeggiata« zu verschaffen. Den Ausbau zur »Villa«‚ d. h. zur Garten- und Parkanlage, unternahm 1778-81 Carlo Vanvitelli auf Befehl König Ferdinands IV. Er errichtete am östl. Eingang 2 flache Pavillons mit Läden, Restaurants und Cafés; zwischen ihnen begann eine breite Mittelallee, begleitet von schmalen Seitenwegen mit weinüberwachsenen Pergolen; Akazien, Linden, Ulmen und Steineichen schätzten die Spaziergänger gegen Sonne und Seewind, zahlreiche Brunnen und Statuen schmückten Wege und Plätze. 1807 ließ Joseph Bonaparte den westl. angrenzenden »boschetto« anlegen, ein von Schlängelwegen im englischen Stil durchzogenes Wäldchen mit Labyrinthen und Grotten; es endete an einem flachen, ehemals frei vor der Küste liegenden Felsvorsprung, der seit dem Mittelalter eine Kapelle S. Lorenzo in insula maris getragen hatte und nun als Aussichtspunkt gestaltet wurde (»la loggetta« — an ihrer Stelle heute eine halbrund ins Meer hineingebaute Terrasse an der Via Caracciolo). 1834 fügte Stefano Gasse die bis zur Piazza Principe di Napoli reichende »Villa Nuova« hinzu.
Die Villa war königlicher Besitz, wurde aber mit allen Erträgen (Weinernte, Restaurationsbetriebe etc.) an Privatunternehmer verpachtet. Der Zugang stand jedermann frei mit Ausnahme von »Bediensteten, Armen, Barfüßigen und sonstigen unpassend gekleideten Personen«; nur zum Piedigrotta-Fest (s. S. 218) wurde auch das gemeine Volk in die Gärten gelassen. Ein Anonymus {von 1839 schildert das von Stunde zu Stunde wechselnde Leben der neapolitan. »tuglieria«: Um 10 Uhr kamen die Gouvernanten mit ihren Kindern, die sich an Ball- und Reifenspielen vergnügten, um 11 Uhr in weite Mäntel gehüllte diskutierende Studenten, um 12 Uhr »sentimentali e misantropi« mit bleichen Gesichtern, gesenktem Blick und verschränkten Armen; ihnen folgte gegen 1 Uhr mittags eine Flut von Dichtern und Sängern, Schauspielern, Tänzern und Musikanten; 3 Uhr nachmittags war die Stunde der nach neuestem Pariser Schick gekleideten Dandys; der Abend endlich gehörte den Romantikern, die unbeweglich an einem Fleck saßen und in die untergehende Sonne starrten. In den Sommermonaten war die Villa auch nachts beleuchtet, die Zöglinge der städtischen Konservatorien boten Musikaufführungen dar. — 1869 ging die Anlage in den Besitz der Gemeinde über und war seitdem als »Villa Comunale« unbeschränkt zugänglich; die umgebenden Gitter und Mauern wurden niedergelegt, auch die Eingangspavillons beseitigt. Bauunternehmer und Spekulanten bedrohten mehrfach die Existenz der Villa; einschneidende Veränderungen brachten die Anlage der Zoologischen Station und der Via Caracciolo sowie die Aufstellung zahlreicher neuer Denkmäler. Vom modernen Großstadtverkehr eingekreist, ist der herrliche Park in
den letzten Jahren mehr und mehr verödet; überdies haben Wassermangel und fehlende gärtnerische Betreuung eine Art Versteppungsprozeß in Gang gesetzt.
Vom einstigen Wasserreichtum des Platzes geben die zahlreichen noch erhaltenen Brunnenfiguren des 19. Jh. einen Begriff. Längs der Seitenwege des O-Teils stehen vergrößerte Kopien der berühmtesten Statuen aus Antike und Renaissance, um 1830 bis 1840 entstanden. Der Hauptbrunnen im Zentrum des Mittelweges (früher von Enten bewohnt und daher Fontana delle paparelle genannt) hat eine riesige monolithische Schale aus rotem Granit; sie stammt wahrscheinl. aus Pästum, wurde von Robert Guiscard im Atrium des Domes von Salerno aufgestellt und 1826 hierher transportiert; die 4 Löwen schuf Pietro Bianchi. Der älteste Brunnen an dieser Stelle, aus den Gründungsjahren der Villa, war von Gius. Sammartino und zeigte die aus Stuck modellierten Figuren der Sirene Parthenope und des Flußgottes Sebeto; an seiner Statt wurde 1791 die aus Rom überführte Gruppe des »Farnesischen Stieres« aufgestellt, die aber leider die salzige Meeresluft nicht vertrug und ins Museum verbracht werden mußte (s. S. 379).
Einer der hübschesten Brunnen Neapels ist die Fontana di S. Lucia (Tafel S. 368), zwischen den Bäumen zur Linken des Hauptweges, von Michelangelo Naccherino und Tommaso Montani (1606).
Urspr. am östl. Ende der Via S. Lucia aufgestellt, wurde der Brunnen beim Umbau der Straße 1620 ein Stück versetzt, 1845 aus gleichem Anlaß restauriert und endlich 1898 hierher transportiert. Die Brunnenschale wurde ehedem von wasserspeienden Sirenen getragen; an ihre Stelle traten 1845 3 Delphine, die mit ihren Schwänzen die Schale in die Höhe stemmen; das Wasser springt in feinen dünnen Streifen aus ihren Nasen hervor und fällt in ein Becken aus künstlichem Felswerk. Darum baut sich eine großartige marmorne Schauwand auf, durch deren rundbogige Mittelöffnung man eigentlich aufs freie Meer hinaus blicken sollte (auch die kleinen Seitenbögen waren urspr. geöffnet — vgl. die Fontana dell’Immacolatella). Reichster plastischer Schmuck — weibliche Volutenhermen, jugendliche Atlanten, Reliefs mit Meergöttern und Pilasterfüllungen aus allerlei »frutti di mare« — belebt die schön proportionierte Architektur.
Am Ende des Hauptweges rechts das niedrige Gebäude des Kunstvereins (»Circolo Salvator Rosa«); es wurde 1870 errichtet und beherbergte damals das »Pompeiorama« mit lebensgroßen Schaubildern aus dem täglichen Leben des alten Pompei. — Der gußeiserne Musikpavillon stammt von 1877 und ersetzte einen hölzernen Vorgänger vom Anfang des Jahrhunderts.
Links zwischen den Buden eines Lunaparks noch ein hübscher Marmorbrunnen mit dem Raub der Europa auf künstlicher Felseninsel in ovalem Becken, von Angelo Viva (1798), von der Via Marinella hierher versetzt (1807).
Die beiden Tempelchen im rückwärtigen Teil der Villa wurden um 1820
von Stefano Gasse und dem Archäologen Francesco Avellino errichtet; der rechteckige ist Vergil (vgl. S. 467), der runde Tasso geweiht.
Inmitten der Villa Comunale an der Via Caracciolo liegt die Zoologische Station mit dem weltberühmten Aquarium und einem Freskenzyklus von Hans v. Marées, der zu den wichtigsten Denkmälern der deutschen Malerei des 19. Jh. gezählt wird.
1870 von dem Stettiner Gelehrten Anton Dohrn (1840-1909) ins Leben gerufen, stellt die Station das älteste Beispiel eines internationalen, unabhängig vom Lehrbetrieb einer Hochschule arbeitenden Forschungsinstitutes dar; in der Geschichte der modernen Biologie hat sie die Wendung von der reinen Anatomie und Embryologie zur Erforschung allgemeiner Lebenszusammenhänge eingeleitet. Gründung und Aufbau einer solchen Institution an diesem Ort müssen jedem Kenner neapolitan. Verhältnisse als eine fast unbegreifliche Leistung erscheinen. Eine nicht unwesentliche Rolle spielten in der ersten Gründungsgeschichte die von Dohrn selbst skizzierten Pläne des Gebäudes; sie wirkten so gewinnend, daß die Stadtverwaltung, allen Widerständen zum Trotz, aus freien Stücken das Herzstück der Villa Comunale als Baugrund anbot. Damals wußte Dohrn noch nichts von der bereits projektierten Uferstraße; er dachte sich seinen Bau direkt am Strande gelegen, was die Seewasserversorgung der Aquarienbecken bedeutend erleichtert hätte. Der Urbau umfaßte allein die 5 zentralen Achsen des ganzen Systems; die Flügel entstammen späteren Erweiterungen.
Für die Ausarbeitung der Pläne (die in manchen Details an Fanzagos Sapienza-Vorhalle, s. S. 224, erinnern) hatte Dohrn den Bildhauer Adolf o. Hildebrandt gewonnen, mit dem er seit seiner Jenaer Privatdozentenzeit befreundet war. Durch Hildebrandts Vermittlung wiederum stieß Hans v. Marées zum Kreis der Neapler Freunde. Ihm bot Anton Dohrns Unternehmen Gelegenheit Zur Bewährung an einer großen, ganz außerhalb seiner bisherigen Schaffensweise liegenden Aufgabe: Im seewärts blickenden Gemeinschaftsraum sollte ein Freskenzyklus »den Reiz des Meer- und Strandlebens ausdrücken«. Das war für ein Forschungsinstitut, das seine wissenschaftliche Seriosität damals erst noch zu beweisen hatte, ein recht originelles Programm; aber auch die Erteilung des Auftrages an den damals noch kaum bekannten 35jährigen Steffeck-Schüler bedeutete ein Stück wagemutigen Mäzenatentums, in dem die Stimmung jener Gründerjahre, die Dohrn selbst gelegentlich mit dem Aufbruch der »Bremer Stadtmusikanten« verglichen hat, gut zum Ausdruck kommt. Noch im Mai 1873 hielt Conrad Fiedler, Marees’ Mäzen und kritischer Mentor (der später die Kosten der Ausmalung übernahm), in einem warnenden Brief an Dohrn »es in der Tat für fast unmöglich, daß er bei seiner Art zu arbeiten die Aufgabe der Dekoration eines Gebäudes nur
einigermaßen wird lösen können«. Indes, zu seinem eigenen Erstaunen fand der nordisch vergrübelte Künstler sich unter dem Himmel des Südens unversehens in einen echt neapolitan. »fappresto« verwandelt: 4 von schöpferischer Euphorie erfüllte Sommer- und Herbstmonate des Jahres 1873 genügten, die zunächst auf 2 Jahre veranschlagte Arbeit zustande zu bringen.
Von Adolf v. Hildebrandt stammen die beiden im Raum aufgestellten Bildnisbüsten: links der von Dohrn besonders verehrte Zoologe Karl Ernst v. Baer, rechts Charles Darwin.
Wer die Fresken * von Reproduktionen her kennt, mag enttäuscht sein über die verhältnismäßige Enge des länglich geformten Saales oder Zimmers, die es schwer macht, den richtigen Abstand zu den weit über Kopfhöhe liegenden Bildern zu gewinnen. Die von Hildebrandt erfundene, halb pompejanische, halb frührenaissancehafte Scheinarchitektur behandelt den Raum in seiner oberen Zone als architravierte Pfeilerloggia, durch deren Öffnungen man in eine panoramaartig zusammenhängende Küstenlandschaft hinausblickt. Die westl. Schmalwand zeigt eine Felsenbucht, in der Fischer sich zur Ausfahrt rüsten; 2 Gruppen von je 3 nackten Figuren vereinigen sich zu einem Gesamtbild von großem plastischem Reichtum. — An der Eingangswand, im vollen Licht der gegenüberliegenden Fenster, geht der Blick aufs offene Meer. Ein von 4 aufrecht stehenden Ruderern bewegtes, mit einigen Fahrgästen besetztes Boot fährt von rechts auf die Szene; wirkungsvoll kontrastieren die wuchtigen Schrägen des Bootsstevens und der Riemen mit der Horizontlinie. — Die anschließende Schmalwand trägt das berühmte Gruppenporträt (»La Pergola«‚ Tafel S. 369). Vor dem Hintergrund der großzügig stilisierten Ruine des Palazzo Donn’Anna, wo Marées des Abends zu zechen pflegte, hat der Kreis der Freunde sich zu gemeinsamem Trunk versammelt. Links außen sitzt Anton Dohrn: »der Ausdruck des gesenkten Kopfes ist etwas verloren — doch nicht im Träumen, sondern in einer suchenden geistigen Aktivität, die auch die Stunde der Erholung nicht ganz frei gibt« (Theodor Heuß). Hinter ihm steht sein Mitarbeiter Nikolaus Kleinenberg; am Tisch sitzt breit aufgestützt Dohrns schottischer Freund Charles Grant, ein Literat und Bohémien, der später unheilbarer Trunksucht verfiel. Dohrn hat ihn in einem Nachruf beschrieben: »ein großer breiter Kopf voll schwarzen unordentlich gehaltenen Haares, ausdrucksvolle, funkelnde Augen, stark gerötete Gesichtsfarbe, voller, nicht proportionierter Oberkörper auf schmächtigen Beinen in überaus vernachlässigter Kleidung«. Es folgt der scheu im Hintergrund bleibende Marées und schließlich der energisch-lebendige Profilkopf Adolf v. Hildebrandts. Die Wirtin Marietta, Marées’ Hund Phylax und ein im Schatten der Mauer sitzendes Fischweib (frei nach
* Vgl. »Reclams Werkmonographien zur bildenden Kunst«: Marées, Die Fresken von Neapel. Einführung von L. Grote. UB Nr. B 9035
Tizians Eierfrau im »Tempelgang Mariae« der Akademie zu Venedig) runden das Bild nach rechts hin ab. — An der im Gegenlicht liegenden Fensterwand sieht man einen schattigen Orangenhain. Zwischen den Stämmen schimmert auch hier der Horizont des Meeres hindurch. Rechts sitzen 2 sonntäglich gekleidete Mädchen; Knabe, Jüngling, Mann und Greis symbolisieren die Lebensalter.
Die künstlerische Problematik der Bilder, die Verbindung von monumentaler Figurendarstellung und naturalistischer Milieumalerei, ist aus der freilich ungleich schärfer formulierenden, gesellschaftlich engagierten franz. Malerei der Epoche (Courbet, Manet) vertraut; allein das besondere Pathos des Suchens und Ringens um allgemeine Menschheitsideen verleiht dem Werk Marées’ einen eigenen Ton, der dem deutschen Publikum seit je zu Herzen ging.
Neuere Interpreten sind darauf ausgegangen, den Zyklus als Gipfelleistung strenger Formkunst zu deuten, und fanden Vergleiche mit Piero della Francesca nicht zu hoch gegriffen; Conrad Fiedler wertete ihn seinerzeit wohl treffender als vorläufigen und nur halb gelungenen Schritt in Richtung des vom Künstler erträumten Zieles. »Marées wußte wohl«, schreibt Fiedler, »daß er Besseres und Reiferes leisten konnte als diese schnell unternommene und gleichsam im Fluge beendete Bilderreihe.« Tatsächlich hat der unbestreitbar großartige Anlauf des Künstlers zur Verherrlichung mediterraner Leibesschönheit inmitten einer paradiesischen Natur, von dem die in verschiedenen deutschen Sammlungen verstreuten Vorstudien das beste Zeugnis geben, im Fresko nicht ungetrübt sich verwirklichen können. Kleinteiliges, rein motivisch gesehenes Beiwerk drängt sich allenthalben in die Lücken der Komposition; selbst die ernste, zusammengefaßte Stimmung des Freundschaftsbildes wird durch die den Vordergrund beherrschende Genreszene des auf den Korb der Hökerin starrenden Hündchens empfindlich gestört. Die vorbereitende Ölskizze im Wuppertaler Museum zeigte den Hund noch ruhig liegend und der Gruppe zugewandt: das Hervortreten anekdotischer Nebenhandlungen in der endgültigen Ausarbeitung eines Bildgedankens, das in gleichzeitigen Bildern Menzels und Feuerbachs wiederkehrt, ist ein charakteristisches Stilmerkmal der Gründerjahre. In den beiden Bootsszenen kontrastiert der Zug zur großen, statuarisch verfestigten Gestalt auffällig mit dem ganz willkürlichen Abschneiden der Konturen an den Bildrändern: ein Kunstmittel impressionistischer Bewegungsdarstellung, das im Wandbild nur als Stilbruch wirken konnte; zumal die Figurengruppe im Boot rechts erhält dadurch etwas sonderbar Vages, Unausgesprochenes, das auch ihren Stimmungsgehalt überschattet und schwächt. Der gleiche Widerspruch zeigt sich auf der Ebene des Handwerklichen, wo der fahrige, bedenkenlos improvisierende Pinselstrich der monumentalen Absicht immer wieder ärgerlich in die Quere kommt. Auch die Behandlung der Farbe schwankt zwischen dekorativer Großflächigkeit und einem im Sinn der Pleinair-Malerei gelockerten Natura-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Villa Comunale. Fontana di S. Lucia (M. Naccherino, T. Montani)
lismus, der sich freilich im einzelnen nicht immer verständlich zu machen weiß; ein drastisches Beispiel bilden die grünen Reflexe des vom Laubwerk gefilterten Sonnenlichtes auf dem Körper des Orangenpflückers, die so unklar geraten sind, daß ein neuerer Beurteiler sie als »Vorboten naturferner Farbaussagen« im Sinne der Moderne hat deuten können.
Doch verrät sich in solchem Mißlingen, über das bloß manuelle Unvermögen hinaus, der fundamentale Zwiespalt von Marées’ Kunst: die erstrebte »Zeitlosigkeit« des Gehaltes kollidiert mit dem fraglos akzeptierten Stand einer malerischen Technik, die auf die Erfassung flüchtigster Augenblicksreize gerichtet war. So soll das Einssein von Mensch und Natur, ideales Gegenbild der Entfremdung im Kapitalismus, doch zugleich als Ausschnitt der Wirklichkeit, momentan erhaschter farbiger Abglanz des Lebens erscheinen: ein präziser Ausdruck des subjektiv beglückenden, objektiv trügerischen Neapel-Erlebnisses des Deutschen, der den Garten der Hesperiden mitten im gegenwärtigen Dasein der Fischer und Bauern wiederzufinden glaubt. Daß die Beschwörung nicht bruchlos gelingen konnte, mag der sensible Künstler selbst empfunden haben. Unverkennbar liegt auch über diesem gelöstesten seiner Werke ein Zug von schwermütigem Ernst, der die oft berufene »reine Freudigkeit« des produktiven Vorgangs Lügen straft und etwas ahnen läßt von der unsäglichen Anstrengung, »heutzutage ... zur einfachen natürlichen Gesinnung zurückzugelangen«, die Marées’ spätere Schaffensjahre ausgefüllt hat.
Der Rang Neapels als Museumsstadt wird aus der Existenz von 5 Nationalmuseen deutlich (Archeologico und Capodimonte, s. u., ferner S. Martino, S. 229, Duca di Martina, S. 306, und Pignatelli, S. 312); dazu kommen die Bildergalerie des Palazzo Reale (S. 358), das Museo Civico Filangieri (S. 298), die musikhistorische Sammlung des Konservatoriums (S. 261) und eine Sammlung von Werken der neapolitan.
Malerei und Plastik des 19. Jh. in der Kunstakademie (Via Bellini 36). Der in ihnen vereinigte Kunstbesitz kann hier nur in Form eines Überblicks vorgeführt werden. Er ist aber seinem Umfang wie seiner Bedeutung nach dem monumentalen Bestand der Stadt zumindest gleichzusetzen und genießt überdies den Vorzug bequemer Zugänglichkeit; wer keine speziellen Interessen verfolgt, wird daher gut daran tun, ihnen einen Hauptteil seiner Zeit zu widmen.
Museo Archeologico Nazionale (Palazzo degli Studi; Piazza del Museo Nazionale)
Das Museum besitzt eine der größten Sammlungen von Kunstwerken wie auch von Gegenständen des täglichen Gebrauchs aus dem griech.-röm. Altertum. Mit seinen Marmor-und Bronzestatuen, den Mosaiken und Wandbildern, dem Metallgeschirr, der Keramik und den Gemmen verfügt es über die verschiedensten Erzeugnisse antiker Kunst und antiken Gewerbes in einer Vollständigkeit, wie sie kein anderes Museum aufweisen kann.
Die Bestände sind von vielen Seiten zusammengekommen und haben eine z. T. schon 400jährige Sammlungsgeschichte. Den Anfang bildete die Kollektion Farnese durch den Ankauf von Marmorwerken und durch Grabungen, die v. a. in den Caracalla-Thermen in Rom ausgeführt wurden. Von dort stammen u. a. die bekannten Kolosse: der Farnesische Herakles und der Farnesische Stier. Die Sammlung war in Rom im Palazzo Farnese und in der Villa Farnesina untergebracht und blieb auch dort, als sie in den Besitz der Herzöge von Parma aus dem Hause Farnese überging. König Karl III. von Neapel, durch seine Mutter Elisabeth Erbe der Farnese, faßte 1738 nach der Entdeckung (von Pompei
den Entschluß, seine Hauptstadt mit einem reichen Museum auszustatten. Die Funde aus den ersten Grabungen in Pompei, Herculaneum und Stabiae kamen in die Villa »La Favorita« bei Portici. 1777 schließlich entstand der Plan, alle Kunstwerke in einem Gebäude zusammenzuziehen; man bestimmte dafür den Palast, in dem die Sammlung sich heute noch befindet. Inzwischen wurde das Museum noch durch den Ankauf von Privatsammlungen und durch die Funde aus der Umgebung von Neapel bereichert. 1956 fand die neuere Malerei im Palast von Capodimonte, wo Teile der Sammlung Farnese vor 1818 schon einmal untergebracht waren, einen neuen Ort. So wurde das Obergeschoß des Museums für eine Neuanordnung frei. Nur die schweren Marmorskulpturen im Erdgeschoß blieben an ihrem Platz und können gemäß ihrer Aufstellung besprochen werden. Ansonsten wird das Gebäude (Stand 1982) konsolidiert und die Sammlung neu geordnet, wodurch die Aufstellung vielfach nur provisorisch ist.
Die Baugeschichte des ehem. Palazzo degli Studi reicht bis ins 16. Jh. zurück. 1585 begann Vincenzo Casale hier den Bau einer Kavallerie-Kaserne; jedoch erwies das Gelände sich als ungeeignet, und das Projekt wurde aufgegeben. Den Entschluß, statt dessen ein neues Gebäude für die Universität zu errichten, die seit dem 13. Jh. im Konvent von S. Domenico Maggiore beheimatet war, faßte der Vizekönig Fernandez di Castro (1610-16). Wie weit sein Architekt Giulio Cesare Fontana, der Sohn Domenico Fontanas, dabei auf die Anfänge des Kasernenbaus Rücksicht zu nehmen hatte, ist nicht mehr auszumachen; doch müssen dessen mit großem Kostenaufwand gelegte Fundamente die Neubauplanung wohl beeinflußt haben. Fontanas Entwurf, im Kupferstich überliefert, sah einen breit gelagerten Rechteckblock mit 2 gleichfalls querrechteckigen Innenhöfen vor; sie waren rings von Pfeilerportiken umgeben und durch einen 3schiffig in die Tiefe führenden Mittelportikus untereinander verbunden. Über diesem erhob sich der 2 Stockwerke hohe Hauptblock, der die großen Auditorien und die Bibliothek enthielt; die die Höfe umgebenden Flügel blieben auf das Erdgeschoß beschränkt. Realisiert wurden davon zunächst nur das Mittelcorps und der westl. Seitenflügel (1612-15); erst 1742 wurde unter Leitung von F. Sanfelice der O-Flügel angefügt. 1777 erhielt die Universität ihren neuen Sitz im ehem. Jesuitenkolleg (S. 360); der Palazzo degli Studi wurde ausersehen, die Kunstakademie, die Akademie der Wissenschaften, die Bibliothek und v. a. die königlichen Kunstsammlungen aufzunehmen, deren aus Pompei, Herculaneum und Stabiae gespeiste Bestände den Bau bald vollständig ausfüllten. Ferdinando Fuga und nach dessen Tode (1782) Pompeo Schiantarelli nahmen die nötigen Veränderungen des Gebäudes vor. Die wichtigsten Eingriffe bestanden einmal im Aufsetzen der Obergeschosse über den Seitenflügeln; zum anderen in Schiantarellis großer Treppenanlage in der Apsis am Ende der Mittelhalle, die vordem die Aula Magna der Univer-
sität gebildet hatte. Weitergehende Ausbaupläne des 19. Jh. (Francesco Maresca u. a.), die das nördl. angrenzende Gelände bis zum Konvent von S. Teresa einbeziehen wollten, blieben unausgeführt.
Von dem Bau des G. C. Fontana, der den nüchternen Formenschatz seines Vaters im Sinne des Frühbarock dekorativ zu bereichern versuchte, gibt die heutige Front an der Piazza del Museo Nazionale noch einen ungefähren Begriff.
Das 3achsige Mittelrisalit mit Giebel und hoher Attika hat sich fast unverändert erhalten, nur der Wappen- und Statuenschmuck ist verloren gegangen; der Glockenstuhl war als Ädikula mit Segmentgiebel und flankierenden Vasen geplant. Das Eingangsportal trug ehemals Wappen des 16. Jh. und stammt also viell. noch aus dem Kasernenbau von Casale. Von den Seitenflügeln gehören nur die Untergeschosse zum alten Bestand (Sanfelice scheint sich beim Bau der O-Hälfte genau an Fontanas Plan gehalten zu haben). Sie wurden bei Gelegenheit des Umbaus durch Fuga und Schiantarelli »purifiziert«: Urspr. befanden sich zwischen den Fenstern ädikulagerahmte Nischen mit Statuen (Allegorien der Wissenschaften und Gelehrten-Tugenden von D’Auria, Naccherino u. a., z. T. auch umgearbeitete Antiken). Nach ihrer Beseitigung wurden an den Außenkanten der Front die rahmenden Pflaster verdoppelt. Die Fenstergiebel waren mit Philosophenbüsten und Kandelabern verziert; die Seitenportale hatten Dreiecksgiebel, die das Gebälk überschnitten, darüber erhoben sich Türmchen mit Sonnenuhren; auf dem Kranzgesims lief eine Balustrade mit Vasen und Zierobelisken entlang.
Hauptsehenswürdigkeiten: Griech. Statuen, S. 373 — Herakles Farnese, S. 379 — Farnesischer Stier, S. 382 — Mosaiken, S. 384 — Funde aus der Villa der Pisonen, S. 388 — Wandmalerei, S. 392 — Farbiges Glas, S. 397 — Tazza Farnese, S. 397 Erdgeschoß In der 3schiffigen, gewölbten Eingangshalle sind hauptsächlich röm. Porträtstatuen, v. a. aus Pompei und Herculaneum, aufgestellt: vor dem 2. Pfeiler rechts die der pompejanischen Priesterin Eumachia (Nr. 6232; Reste von Farbe im Haar), links im Prunkpanzer der pompejanische Augustale und Patron der Kolonie Marcus Holconius Rufus (Nr. 6233).
In den Seitengängen der 3. Arkade 2 Reiterstandbilder und an
den Pfeilern Statuen: die Angehörigen des Prätors und Prokonsuls Marcus Nonius Balbus aus Herculaneum rechts zu Pferd (Nr. 6104; der Kopf ist ein Gipsabguß des in der Revolution von 1799 zerstörten Originals), rechts hinter ihm am Pfeiler eine seiner Schwestern (Nr. 6249) und links vor ihm in der Toga sein Vater Marcus Nonius Balbus (Nr. 6167), den auch der Reiter im linken Seitenschiff (Nr. 6211) darstellt. Dort stehen ferner die Mutter des Prätors Viciria Archas (Nr. 6168) und 2 weitere Schwestern (Nr. 6244, 6248). Diese Porträts sind Werke des frühkaiserzeitlichen Klassizismus der ersten Jahrzehnte n. Chr. — Im Bereich der 4. Arkade weitere Statuen von Beamten und Frauen aus Pompei.
In der 2. Arkade links vom Mittelgang steht die Basis einer Statue des Kaisers Tiberius (14-37 n. Chr.) aus Pozzuoli (Nr. 6780). In den Jahren 17 und 30 waren in Kleinasien mehrere Städte vom Erdbeben zerstört worden, die Tiberius wieder hatte aufbauen lassen. 14 von ihnen ließen daraufhin aus Dankbarkeit beim Venus-Tempel in Rom eine monumentale Statue des Kaisers errichten, um deren Sockel die Personifikationen dieser Städte standen. Eine verkleinerte Kopie des Denkmals wurde in Pozzuoli aufgestellt.
Die thronende Gestalt des Kaisers war aus Bronze. Die Figuren der Städte sind in Relief gearbeitet. Neben der Inschrift stehen Magnesia und Sardes, rechts Philadelphia, Tmolus und Kyme, auf der Rückseite Temnos, Kibyra, Myrina, Ephesus, Apollonia und Hyrkania, links Mostene, Aegae und Hierokaisaraia. — An der Wand des Seitenganges ein Sarkophag (Nr. 6776) mit dem Festzug des Bacchus, der auf einem Wagen von Kentauren gezogen wird.
In der rechten Seite der 2. Arkade Altar der Fortuna Redux des Kaiserhauses (Nr. 2608) und an der Seitenwand Sarkophag (Nr. 6705): Prometheus beim Erschaffen des Menschen. In der oberen Reihe die olympischen Götter zwischen der Nacht (links; auf dem Stiergespann) und dem Tag (rechts; Pferdegespann; 3. Jh. n. Chr.). — Rechts davon stehen an der Rückseite des 2. Pfeilers 2 spätrepublikanische Porträtstatuen aus Venafro mit freiem Oberkörper (Nr. 141836, 141835) und an der Stirnseite des rechten Seitengangs die kolossale Statue des Kaisers Alexander Severus (222-235 n. Chr.) in heroischer Nacktheit (Nr. 5993). Zu seiten des Eingangs 2 Säulen aus dunkelgeädertem Marmor (Cipollino) mit griech. Inschriften, die der griech. Redner und röm. Konsul d. J. 143 n. Chr. Herodes Attikus den Göttinnen Demeter und Kore sowie den Unterweltgöttern hatte weihen lassen (Nr. 2400, 2401) Durch die Tür rechts vom Eingang gelangt man in den Raum I. Hier stehen röm. Kopien berühmter griech. Statuen: Rechts zweimal die sog. Aspasia (Nr. 153654), deren Mantel in einfachen Falten Körper und Kopf umgibt (Mitte 5. Jh. v. Chr.). In der Mitte die Gruppe der Tyrannenmörder (Nr. 6009/10; Marmorkopien nach dem Werk des Kritios und Nesiotes, 476 v. Chr.). Harmodios und Aristogeiton hatten 517 bei einem Festzug Hipparch, den
einen der athenischen Tyrannen, ermordet und galten später als Mitbegründer der athenischen Freiheit und Demokratie. Der Kopf des Älteren ist ein Gipsabguß. Die urspr. Aufstellung der beiden Statuen ist umstritten: Ob sie, wie hier, nebeneinander standen, bleibt ungewiß. Das Original befand sich in Athen auf dem Markt. — Rechts davon an der Wand Kopffragment des sog. Omphalos-Apoll (Nr. 153 640), mit Resten von Farbe im Haar, nach einer Apollon-Statue aus der 1. Hälfte des 5. Jh. v. Chr. Links davon 2 Reliefs, griech. Originale: 1. Bruchstück einer Metope von einem Tempel aus Pästum, Europa auf dem Stier. An der oberen Leiste 2 Rosetten (Sandstein, um 510 v. Chr.); 2. Grabstele eines Mannes (Nr. 6556), der sich auf einen Stab stützt, vor ihm sein Jagdhund (Anfang 5. Jh. v. Chr.).
Aus Raum I führt rechts eine Tür in den Saal mit den (Nischen-) Räumen II-VI. Hier befinden sich einige jener griech. Bildwerke, die von der röm. Zeit an bis heute die Vorstellung der klassisch-griech. Bildhauerkunst mitbestimmen. Die griech. Originale der Statuen waren meist aus Bronze im Hohlguß hergestellt. Dieses Material ließ einen leichten Aufbau der Figuren zu. Bei der Umsetzung in Marmor mußten Stützen angebracht werden, die zwar die Standfestigkeit sichern, aber meist den Eindruck mindern.
Nimmt man neben der farblichen Veränderung von der dunkelkupferfarbenen Bronze zu dem weißen, bemalten Marmor und den technisch bedingten Differenzen noch die Tatsache hinzu, daß die Kopisten nicht an die Meister der Originale heranreichten, und daß die Kopien meist nur in zerschlagenem Zustand auf uns gekommen sind, so mag man ermessen, wie getrübt unser Bild von der großen Zeit der griech. Kunst ist.
Zu den wichtigsten Meistern des 5. Jh. gehört Polyklet aus Argos.
Im Wettstreit mit anderen griech. Bildhauern seiner Zeit schuf er die Statue einer zu Tode getroffenen Amazone. Von einer Kopie dieser Figur stammt der Kopf in Raum IV (Nr. 15041); er ist geneigt und schaut nach rechts unten Zu einer Wunde an der Brust; rechts neben der Tür die Beine der Amazone des Kresilas (Nr. 150399). — Im nächsten Raum (III) rechts steht die besterhaltene Kopie nach Polyklets Hauptwerk, dem Doryphoros; der nackte Jüngling in der Haltung eines Speerträgers ist eine Darstellung des mythischen Helden Achill (Nr. 6011). Mit seinem festen Körperbau und seinen ausgewogenen Proportionen bestimmte er das Bild vom Menschen bis in die Spätantike. Nur mit dem rechten Bein steht die Statue fest auf, während das linke leicht zurückgesetzt ist und nicht trägt. So kommt es, daß alle Gliedmaßen auf das labile Gleichgewicht Rücksicht nehmen müssen und den harmonischen Aufbau unterstützen. Die in der Figur selbst begründete Gesetzmäßigkeit verschaffte dem Doryphoros den Rang eines »Kanon«, einer Musterfigur für die folgenden Bildhauergenerationen. Die Statue ist 1797 in der Palästra von Pompei gefunden worden. — Rechts hinter ihr die Kopie des Kopfes allein aus Her-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Archeologico Nazionale. Kopf der Amazone des Polyklet aus Baiae
culaneum (Nr. 6412), links die des Polykletischen Herakles (Nr. 6164). — Rechts an der Wand der Torso des zweiten Hauptwerkes Polyklets, des Diadumenos, eines jungen Athleten, der sich mit erhobenen Armen die Siegerbinde umlegt (Nr. 150361).
Neben Argos war Athen der wichtigste Ort der griech. Plastik im 5. Jh. v. Chr.; dort entstand das Vorbild für die 2 leicht voneinander abweichenden Kopien einer Aphrodite (Raum II), die mit der Rechten einen Schleier über die Schulter zieht (Nr. 5997-98; aus Herculaneum und aus Pompei). Ebenso aus Athen stammen das Vorbild für die Pallas Athene (Nr. 6024) und das Orpheus-Relief (Nr. 6727) rechts vom Fenster. Der Sänger Orpheus hatte durch seinen Gesang die Mächte der Unterwelt dazu bewogen, ihm seine verstorbene Frau Eurydike wiederzugeben, die er auf dem Weg zur Oberwelt jedoch nicht anschauen durfte. Dieses Gebot vermochte er nicht zu halten. Mit einem Blick nimmt das Paar hier endgültig voneinander Abschied, während Hermes, der Geleiter ins Totenreich, schon sanft nach der Rechten Eurydikes greift, um sie von neuem in den Hades zu führen. — Gegenüber ein hellenistisches Weihrelief (Nr. 6725): im Reigen die 3 Grazien, 3 Nymphen und die als Kind gebildete Personifikation der Stadt Telonnesos.
In der Fensternische, der Eingangstür gegenüber (Raum IV), zeigt ein griech. Relief aus dem 4. Jh. v. Chr. die Götter des bei Athen gelegenen Heiligtums von Eleusis: links Triptolemos auf dem Schlangenwagen, Kore mit den Fackeln, daneben Hekate, in der Mitte auf einer mystischen Cista sitzend Demeter, deren wichtigstes Heiligtum Eleusis war, rechts am Rand die thrakische Göttin Bendis. — Gegenüber die Kopie einer schwebenden Nike (Victoria), Ende des 5. Jh. v. Chr., vor der Querwand eine sich links aufstützende Aphrodite (Nr. 6395), ihr gegenüber eine andere Kopie nach dem gleichen Original aus der 2. Hälfte des 5. Jh. v. Chr. (Nr. 6396). — Im Raum V, links der Tür, die in Cumae gefundene Kopie des Diomedes (Nr. 144978), wahrscheinl. ein Werk des athenischen Bildhauers Kresilas (2. Hälfte des 5. Jh. v. Chr.), der sich hier wie auch bei seiner Amazone (neben der Tür Nr. 150399) von dem Standmotiv Polyklets hat beeinflussen lassen; er gestaltet allerdings nicht wie jener eine in sich ruhende Figur, sondern gibt Diomedes auf seiner Flucht aus Troja wieder — in der abgebrochenen Linken muß man das geraubte Palladion ergänzen; Diomedes scheint sich über seine Schulter hinweg nach einem Verfolger umzuschauen.
Im letzten Raum (VI) seitlich 2 Kopien nach derselben weiblichen Statue, von 2 verschiedenen Kopisten, deren Signatur am linken Unterschenkel eingemeißelt ist (Nr. 150 383, 150 384; aus Baiae). Das Urbild ist am Ende des 5. Jh. v. Chr. entstanden, als man es liebte, durch den wie naß wirkenden Stoff der Gewänder den Körper zu modellieren. — Am Fenster 2 Gruppen: Nereiden, die auf Hippokampen reiten (Nr. 145070, 145080), in den bewegten Formen des Hellenismus. Aus derselben Villa eines reichen Römers
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Archeologico Nazionale. Orpheus-Relief
am Meer bei Formia stammt auch die Kopie einer Apollon-Statue aus dem 4. Jh. v. Chr., deren linker Arm auf einer als Statue gebildeten Stütze aufruht (Nr. 145 078).
Nach Verlassen des Saales folgt am rechten Ende des I. Raumes Raum VII, in dem archaistische und archaisierende Skulpturen aus der frühen röm. Kaiserzeit aufgestellt sind. Es handelt sich um Bildwerke, die auf früh- und vorklassische griech. Vorbilder zurückgreifen, deren Strenge aber als manieristischer Reiz aufgefaßt wird. Rechts ein Apollon aus Pompei (Nr. 146103) mit Resten von Malerei in den Augen und eine Angreifende Athena aus Herculaneum (Nr. 6007), links eine Schreitende Artemis aus Pompei mit zierlich herabfallenden Gewandfalten (Nr. 6008); vor dem Fenster Dionysos-Köpfe auf Hermenschäften; sie standen in röm. Gärten (Nr. 6324 zeigt die Form noch vollständig). — An frühklassischen Formen orientiert sich auch die Gruppe Orest und Elektra aus Pozzuoli (Nr. 6006). Bei dem Faustkämpfer aus Sorrent (Nr. 119 917, mit griech. Kopisten-Signatur an der Basis) ist die Statuenstütze als Herme gebildet. Das Original entstand um die Mitte des 5. Jh. v. Chr.
Im nächsten Raum VIII und dem dazugehörigen Saal mit den Räumen XI-XVI stehen Marmorstatuen der Sammlung Farnese, v. a. die kolossalen Stücke aus den Caracalla-Thermen in Rom. Es sind Arbeiten aus dem Beginn des 3. Jh. n. Chr., die sich durch eine Steigerung des Pathos und der Einzelformen auszeichnen. In der Raummitte (VIII) ein Krieger, der einen toten Knaben geschultert trägt, wohl Hektor, der den Leichnam seines von Achill erschlagenen Bruders Troilos vor der Schändung nach Troja hinein rettet (Nr. 5999); gegenüber die kolossale Statue einer Frau (Kopf und Arme neu). Unter den kleineren Stücken: rechts und gegenüber vom Eingang 4 griech. Grabstelen aus Chalkis und Rhodos, Ende des 5. Jh. v. Chr. (Nr. 152 792, 152 793, 152 794, 152 789), rechts vom Durchgang in den Saal 2 Wiederholungen der Statue des Ärztegottes Asklepios (Nr. 6360; aus der Sammlung Farnese, ergänzt). Die nicht ergänzte Figur ist die bessere Ausführung. Sie zeigt in reicheren Falten das für den Gott typische Gewand. Er hat die Linke in die Hüfte gestemmt und stützt sich mit der rechten Achsel auf einen Stab, um den sich das ihm heilige Tier, die Schlange, ringelt. Rechts vom ergänzten Asklepios eine hellenistische Frauenstatue (2. Jh. v. Chr.): Hygieia, die Tochter des Asklepios, ein Pendant zu der Statue links.
Rechts im Durchgang (Raum XIII) zum Saal eine Kopie des sog. Pothos des Bildhauers Skopas (Nr. 6253; 4. Jh. v. Chr.), eine Eros-Darstellung (der Kopf und die Leier falsch ergänzt). Von den über Kreuz gestellten Beinen führt die Bewegung nach oben; sie endet beim Original in einer sehnsüchtigen Gebärde des Kopfes und des Armes. Dazu bildet das herabgleitende Gewand einen Kontrast. Die Gans unter dem Gewand ist ein der Aphrodite heiliger Vogel.
Vor der Querwand rechts steht ein hellenistischer Zeus-Kopf. Es folgen der Torso eines jugendlichen Dionysos (Nr. 6034), ein Aphrodite-Torso (Nr. 6035) und der Torso eines sitzenden Ares, der mit verschränkten Händen um sein linkes Knie greift (Original 4. Jh. v. Chr.).
Die kolossale Figur inmitten des Saales gehört zu den berühmtesten Statuen des Museums: der sog. Herakles Farnese, eine röm.
Kopie nach einem Werk des Bildhauers Lysipp (4. Jh. v. Chr.).
Die Statue ist 3,17 m hoch und wurde unter dem Pontifikat des Farnese-Papstes Paul III. (1534-49) gefunden. Sie stand bis zu ihrem Transport nach Neapel im Treppenhaus des Palazzo Farnese in Rom und wurde dort von Romreisenden, unter ihnen Goethe, gesehen, bewundert und gezeichnet (heute ist in Rom ein Gipsabguß aufgestellt). Vom griech. Original stammen die Haltung im allgemeinen und die Proportion der Glieder; römisch dagegen ist das kleinteilige Herausarbeiten der einzelnen Muskelpartien. Der Held stützt sich erschöpft auf seine Keule, über der ein Löwenfell hängt. Er hat den Kopf schwermütig geneigt. In der Rechten, die auf seinem Gesäß aufruht, hält er die 3 goldenen Äpfel der Hesperiden. Das Erlangen dieser Äpfel gehörte zu seinen schwersten Taten, so daß er sich der Hilfe des himmeltragenden Atlas versichern mußte. Unterhalb der Keule ist auf dem Fels die Signatur des Kopisten Glykon aus Athen eingemeißelt.
Auf dem großen Sarkophagkasten rechts hinter dem Herakles ist eine Szene aus der Jugend des Achill dargestellt. Wegen der Prophezeiung seines frühen Todes wurde er zu Beginn des Trojanischen Krieges in Frauenkleidern unter den Töchtern des Königs Lykomedes verborgen und dort durch eine List von Odysseus entdeckt. — An den Wänden Reliefs: Rechts 2 tanzende Satyrn; in der Mitte ein Bruchstück: Es zeigt Dionysos, der neben seinem Altar thront beim Empfang einer Weinspende (Nr. 6728). Links Szene aus dem Leben des mythischen Helden Telephos, aus dem danach benannten Haus des Telephos in Herculaneum.
Am rechten Ende des Saales ist der Zugang zu den beiden kleineren Räumen IX und mit hellenistischen Skulpturen. Im Eingang Herakles und Omphale (Nr. 6406). — Im Raum IX Kopien nach einer figurenreichen Weihung des pergamenischen Königs Attalos auf der Akropolis von Athen (2. Jh. v. Chr.). Erhalten sind die jeweils Unterlegenen aus 4 Schlachtdarstellungen. In der Mitte eine getötete Amazone (Nr. 6012), links ein Perser (Nr. 6014), ein Gallier (Nr. 6015) und ein Gigant (Nr. 6013). Den Sieg über die im 3. Jh. v. Chr. in Kleinasien eingedrungenen Gallier hatten die pergamenischen Könige mit den großen mythischen und historischen Siegen gleichgesetzt: mit dem Sieg der Götter über die Giganten, dem sagenhaften Sieg der Griechen über die Amazonen und dem der Griechen über die Perser bei Salamis. — Ebenfalls von hellenistischen Kampfdarstellungen stammen die beiden Reiter, eine getroffene Amazone (Nr. 6405; Pferdekopf und Vorder-
hufe neu) und der Reiter (Nr. 6407; sein Oberkörper, die Beine und der Vorderteil des Pferdes neu). Raum X enthält hellenistische Aphroditen-Statuen: In der Mitte die Kallipygos (Nr. 6020); an der Rückwand 2 verschiedene Versionen nach der badenden Aphrodite des Doidalses (Abb. S. 381), rechts Aphrodite mit hinzugefügtem Erosknaben (Nr. 6293), links ohne Eros (Nr. 6297); welche der beiden Statuen das Original getreuer wiedergibt, ist umstritten. Ohne Eros fehlt der Figur das Genrehafte; da es sich aber auch bei einer badenden Aphrodite um eine Götterstatue und nicht um eine intime Szene handelt, dürfte die linke Kopie der urspr. Fassung entsprechen. — Zu seiten des Eingangs 2 Wiederholungen der sog. Pudica, einer Aphrodite-Statue, die mit den Händen ihre Blöße zu verdecken sucht. Im Gegensatz zu der Badenden des Doidalses ruht dieses Götterbild nicht mehr in sich selbst, sondern ist auf einen menschlichen Betrachter bezogen und scheint auf dessen zudringlichen Blick zu reagieren. Die Figuren sind stark ergänzt, die Köpfe neu, ebenso die Hände und Teile der Arme, bei der Statue am Fenster auch die Beine.
Wieder zurück im großen Saal, folgt rechts der Tür ein Puteal (Nr. 6670; 1. Jh. v. Chr.), eine runde Steineinfassung, die mit Reliefs versehen ist: Unter den olympischen Göttern thront Zeus, vor ihm auf einem Pfeiler sein Adler, dann folgen Ares, Apollon, Asklepios, Dionysos, Herakles und Hermes. — Das 2. Puteal (Nr. 6675; 1. Jh. n. Chr.) zeigt Satyrn bei der Weinlese und beim Pressen von Trauben. — In der Fensternische eine Nereide, auf einem Seewesen reitend (Nr. 6026), und Ganymed mit dem Adler (Nr. 6355). — In der nächsten Fensternische steht der Torso einer hellenistischen Aphrodite mit herabgleitendem Gewand. Die Figur war aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Deutlich sind noch die Ansatzstellen und Reste der Metalldübel zu sehen. — In der Fensternische dem Eingang (Raum XIII) gegenüber: Kopf eines bärtigen Dionysos auf einem nicht zugehörigen Sockel mit dionysischen Reliefs: der Panther unter einer Rebe, an den Seiten Eichen mit Musikinstrumenten, Tympanon und Krottalen (Metallklappern), auf der Rückseite ein Kantharos, das Trinkgefäß des Dionysos, mit angelehntem Thyrsos-Stab. — An der Wand ein Relief (Nr. 6682) nach späthellenistischem Vorbild: Helena wird von Aphrodite überredet, dem Paris (Alexandros) zu folgen. Diesem wendet sich ein geflügelter Eros zu. — In der Mitte ein Marmor-Kantharos (Nr. 6673) mit der Signatur des athenischen Bildhauers Salpion. Unterhalb der Signatur bringt Hermes das Kind Dionysos zu einer Nymphe am Berg Nysa. Hinter ihr steht der Ziehvater Silen auf einen Thyrsos-Stab gestützt. Es folgen weitere Nymphen. Hinter Hermes beginnt der Zug des Dionysos mit 2 Satyrn und einer den Tympanon schlagenden Mänade. Diese letzten 3 Figuren stammen aus dem Typenschatz der neuattischen Bildhauerwerkstätten (1. Jh. v. Chr. — 1. Jh. n. Chr.), in welchen
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Archeologico Nazionale. Aphrodite und Erosknabe (nach Doidalses)
dieses Prunkgefäß hergestellt wurde. Urspr. diente es als Zierde in einer Villa bei Gaeta, später stand es dort im Hafen als Pfosten zum Vertäuen der Schiffe und gelangte schließlich als Taufbecken in den Dom.
Neuattische Figuren sind auch auf einem Relief zu sehen, das in einer Wand im Raum XIV eingelassen ist (Nr. 6726). Ihm gegenüber zeigt ein anderes Dionysos-Relief (Nr. 6713) den Besuch des bärtigen Dionysos mit seinem Zug bei Ikarios. Den oberen Teil des Reliefs nehmen Architekturdarstellungen ein; späthellenistisch. — In der Mitte des Raumes die sog. Aphrodite von Capua (Nr. 6017). Sie stand in einer Arkade des Amphitheaters von Capua und gibt ein frühhellenistisches Original wieder. Der Göttin ist das Gewand zur Hüfte heruntergeglitten. Den linken Fuß setzt sie auf den Helm des Ares. Ihre Arme sind falsch ergänzt: Sie hielt mit ihnen ehemals den Schild des Ares, in dessen spiegelnder Oberfläche sie ihren Leib betrachtete. —‚ Ebenfalls vom Statuenschmuck des Amphitheaters in Capua stammen in der Fensternische gegenüber (Raum XIV) die Figur eines jungen Mannes (Nr. 6106) und der Torso einer Frau (Nr. 6019), die sog. Psyche von Capua. Die Statue bestand aus mehreren Stücken. Erhalten sind der Leib mit dem Kopf und der Rand des Gewandes. Das Gewand selbst war für sich gearbeitet und an der geraden, rauhen Fläche angesetzt; das gleiche gilt für die Arme, an denen man noch die Löcher zum Anstücken sieht. Die 3 Statuen stammen aus der Zeit des Kaisers Hadrian (117-138) und entsprechen mit ihrer weichen, gefühlvollen Gestaltung dem Geschmack jener Epoche. Bes. die sog. Psyche hat auch neuere Betrachter immer wieder ansprechen können.
Der widderhörnige Gott Zeus Ammon spielte für die Griechen seit Alexanders d. Gr. Zug Zum ägyptischen Wüstenheiligtum dieses Gottes eine Rolle (Nr. 6274, vor der Querwand). — Im nächsten Raum (XV) stehen v. a. hellenistische Dionysos-Statuen (Nr. 6318) und Satyrn seines Gefolges (Nr. 6325, 6331, 6332); ein Satyr trägt das Kind Dionysos (Nr. 6022). Der Flurgott Pan lehrt einen Hirten (Olympos oder Daphnis) das Spiel auf der Hirtenflöte Syrinx (Nr. 6329).
Einen besonderen Raum XVI nimmt die Statuengruppe ein, die dem Saal den Namen gegeben hat, der sog. Farnesische Stier.
Er stammt wie alle kolossalen Werke aus den Caracalla-Thermen in Rom und wurde dort zerstört aufgefunden. Bei der Zusammensetzung nahm man Ergänzungen vor: Alle Köpfe sind neu; hinzu kommen viele, den urspr. Eindruck entstellende Zutaten. Diese um 200 n. Chr. entstandene Kopie gibt eine berühmte Gruppe der hellenistischen Bildhauer Apollonios und Tauriskos von Tralleis wieder, die der ältere Plinius erwähnt. Das Thema der Darstellung ist die Bestrafung der thebanischen Königin Dirke. Sie hatte jahrelang Antiope, die Mutter der Zwillingsbrüder Amphion und Zethos, als Sklavin gehalten. Schließlich gelingt es den Söhnen,
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Archeologico Nazionale. Psyche von Capua (2. Jh.)
die Mutter zu befreien. Nach dem Mord an König Lykos von Theben finden sie Dirke auf dem Berge Kithairon bei einem Opfer für Dionysos. Das Gebirge ist durch die Tiere rings um den unregelmäßigen Sockel angedeutet. Vorne links liegt Dirke. Eine Girlande rechts von ihr deutet das Opfer an. Links von ihr ist ein Korb mit dem Dionysos heiligen Efeu umschlungen. Eine Efeuschärpe trägt auch der Hirte rechts vorne. Die Szene wird überragt durch den Stier, an dem Dirke angebunden wird, und der sie zu Tode schleifen soll. Hinten links steht die Mutter Antiope. Der Speer in ihrer Linken ist eine falsche Ergänzung.
Am Ende des Raumes VIII führt eine Tür in die Sammlung der ägyptischen Altertümer. In Raum XVII Stelen mit Inschriften aus verschiedenen Epochen, Gipsabgüsse von assyrischen Denkmälern aus Ninive, Bildnisse aus der Spätzeit der ägyptischen Kultur, ein Obelisk (Nr. 2317) aus rotem Granit, der im Fortuna-Heiligtum von Palestrina bei Rom gefunden worden ist.
An den Wänden der Treppe, die hinunterführt, Reliefbruchstücke mit Hieroglypheninschriften, darunter ein Stück des Obelisken Psammetichs II. (Nr. 2326; 6. Jh. v. Chr.), der heute in Rom auf der Piazza Montecitorio steht.
Zwischengeschoß
Im Zwischengeschoß sind auf der rechten Seite Wandbilder aus Pompei, Herculaneum und Stabiae untergebracht, die nach Neuordnung des Museums im Obergeschoß, an die dort ausgestellten Wandbilder anschließend, ihren Platz erhalten sollen. Unter diesen Gemälden befindet sich auch der Bildschmuck aus dem Isis-Tempel von Pompei (Raum LV bis LVI), der nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. wiederhergestellt worden ist.
Auf der linken Seite des Zwischengeschosses sind v. a. die Mosaiken untergebracht. Heute an den Wänden befestigt, waren sie (mit Ausnahme derjenigen in Nischen) im Altertum Fußbodenbelag. In Raum LVII links 2 Streifen aus Marmorintarsien (opus sectile), dazwischen Gorgomasken zwischen schwarz-weißen Landschaftsstreifen. Rechts: Hahnenkampf. Gegenüber ein Panther (Tier des Dionysos), vor ihm ein Trinkhorn, ein Thyrsos-Stab und Metallschellen. Links davon als Rundbild (Nr. 10 016) der Kampf des Theseus mit dem stierköpfigen Minotauros. — Man tritt zwischen 2 mosaizierten Säulen, die zusammen mit 2 gleichartigen im nächsten Raum (LVIII) aus einem nach ihnen benannten Haus in Pompei stammen, hindurch in Raum LIX.
Rechts Dionysos vor blauem Grund mit Panther und Thyrsos; darüber ein Totenkopf zwischen Handwerkssymbolen. Große Mosaiknische für einen Gartensaal; in der Mitte war ein Wasserspeier angebracht; darüber: Phrixos und Helle während ihrer Flucht auf dem Widder. Helle stürzt in den Hellespont. — Gegen-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Galleria Nazionale di Capodimonte. Tizian: Danae
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Nazionale di Capodimonte. Das Farnese-Kästchen (Manno di Bastiano Sbarri u. a.)
über: Nische mit Hahnenkampf. — Darüber: Teil einer Wand mit Ausblick auf die Statue eines Faustkämpfers. — Links: Skelettdarstellung. Neben der Tür eine groteske Szene: Ein Pygmäe überreicht einem im Hahnenkampf siegreichen Hahn die Siegespalme.
Im Raum LIX liegt ein rundes Mosaikbild in der Mitte auf dem Boden: eine allegorische Szene. In einer Landschaft vor einem Altar und einer Statue des Dionysos ist ein großer gefesselter Löwe von Amoretten und 2 sitzenden weiblichen Figuren mit dionysischen Attributen umgeben. — Links der Tür in der Mitte Vorbereitung für eine Theateraufführung (Nr. 9986). Die Masken für die Schauspieler liegen noch in einem Korb, rechts wird einer eingekleidet. — Zu beiden Seiten dieses Mosaiks 2 weitere aus feinen Steinen mit der Signatur des Dioskurides aus Samos. Durch die Wahl der kleinen Steine gelingt eine feine Abstufung der Farben. Es wird sich um die Mosaikkopien von Gemälden handeln.
Die Bilder zeigen Szenen auf der Bühne. Links eine Darstellung aus der neuen attischen Komödie: Eine junge Frau ist mit einer etwas älteren Begleiterin zu einer Hexe gegangen, um einen Liebestrank zu besorgen (Nr. 9987). Das andere Bild zeigt einen Zug von Musikanten (Nr. 9985), bei dem lebhaftere Farben verwendet sind als beim Bild mit der Hexe. Dieser Unterschied ist auf die verschiedenartige Farbigkeit der Originale zurückzuführen. — Rechts daneben (Nr. 124 545) eine Darstellung der 7 Weisen oder der platonischen Akademie in Athen (in diesem Falle rechts oben die Akropolis von Athen, unter dem Baume deutet Platon auf eine Himmelskugel). Neben dem Baum auf einer Säule eine Sonnenuhr. — Zwischen den beiden Mosaiksäulen ist an einem Pfeiler das Porträt einer Frau in besonders feinem Mosaik angebracht. — Meeresfauna auf schwarzem Grund (Nr. 120177). — Hahnenkampf (Nr. 9982). Nr. 114 281 wiederholt ein berühmtes Mosaik des hellenistischen Künstlers Sosos aus Pergamon: Tauben, die aus einem Becken trinken und sich im Wasser spiegeln. Beim Original war auf die verschiedenartigen Reflexe im Wasser und auf dem Metall des Beckens Wert gelegt. Nr. 9992 behandelt ein ähnliches Thema; die Tauben sind durch Papageien ersetzt. — An der Fensterwand: Theseus bezwingt Minotauros (Nr. 10 018); ein Meerthiasos mit Poseidon und Amphitrite (Nr. 10 007). Links vom Fenster wieder: Theseus bezwingt Minotauros.
Viele der im Raum LX ausgestellten Mosaiken stammen von den Fußböden der Casa del Fauno in Pompei (s. S. 536). Neben der Tür auf quadratischem Bildfeld ein geflügelter Genius auf einem Panther (Nr. 9991). Die Darstellung führt in den Bereich des Gottes Dionysos: Der geflügelte Genius ist mit Efeu bekränzt und hält mit seiner Rechten ein Trinkgefäß. Dem Panther ist eine Girlande von Weinlaub um den Hals geschlungen. Auf dem Boden liegt der Thyrsos. Auch im Rahmen sind dionysische Motive verwendet: Masken und im Grün der Girlande Weinlaub.
— Das große Maskenmosaik darunter (Nr. 9994) saß ehemals im Eingang der Casa del Fauno und die 3teilige Nil-Landschaft (Nr. 9990) auf der Schwelle des Saales, dessen Fußboden die sog. Alexanderschlacht (Raum LXI) einnahm. Dieses Schlachtenbild gehört nicht nur zu den berühmtesten Mosaiken von Pompei, sondern aus dem Altertum überhaupt. Es wiederholt ein Gemälde vom Ende des 4. Jh. v. Chr., das den Sieg des Makedonenkönigs Alexander d. Gr. über die Perser unter dem Großkönig Dareios III. zum Thema hatte. Gemeint ist vielleicht die Schlacht von Issos 333 v. Chr. Während des Gefechtes ist der Augenblick gewählt, als die Leibwache um den Wagen des Großkönigs vor dem Angriff Alexanders ins Wanken gerät. Dieser kommt von links (der beschädigten Seite des Mosaiks) auf seinem Pferd Bukephalos angesprengt. Er trägt keinen Helm. Deutlich ist das für ihn typische große Auge hervorgehoben. Ein Perser, der sich seinem Ansturm entgegenstellt, wird mit der Lanze niedergestochen. Ein anderer ist vom Pferd gesprungen, um es seinem König zur schnelleren Flucht anzubieten. Dieser macht angesichts seiner Niederlage eine hilflose Gebärde mit der linken Hand, ohne seinen Bogen, den die Rechte hält, zu benutzen. Die Makedonen sind von links kommend schon um die Garde des Perserkönigs herumgeritten. Links neben dem Wagen werden im Hintergrund ihre Helme sichtbar, und rechts deuten Lanzen, denen der Perser entgegengerichtet, in der Richtung des makedonischen Angriffs darauf hin, daß der Gegner bis hierhin vorgedrungen ist und die Truppe um den Großkönig fast umzingelt hat. Zur Flucht bleibt nur der Weg nach vorne rechts, quasi aus dem Bilde heraus.
Hierhin richtet der Wagenlenker die Pferde und treibt sie mit der Peitsche an. Die Bewegung ist nicht parallel zur Bildfläche gegeben, sondern die Perser werden von links hinten nach rechts vom gedrängt. Die räumliche Tiefe, die durch diese Anordnung des Geschehens entstehen soll, wird noch durch die beiden Pferde im Vordergrund betont. Das eine Pferd stürzt nach vorne, das andere ist verkürzt von hinten gegeben. Sie stehen vor dem Wagen und deuten so die Tiefe in der Bildmitte an, die an den Seiten beim bildparallel angreifenden Alexander und dem nach vorne rechts gelenkten Gespann geringer ist. Weitere räumliche Elemente sind der übereck gesehene Wagenkasten und das Kampfgewühl links daneben. Der Wald von Lanzen bildet nach hinten den räumlichen Abschluß. Auf der so geschaffenen Bühne akzentuieren verschiedenartige Bewegungen das Geschehen. Den größten Gegensatz bildet der klar ausgerichtete Angriff Alexanders zur entschlußlosen Unbeweglichkeit des Perserkönigs, die noch durch die ziellose Betriebsamkeit seines Wagenlenkers und die Unordnung im Viergespann unterstrichen wird. Bei der Farbwahl herrschen die Erdfarben vor; Gelb, Ocker und Brauntöne bestimmen das Bild. Blau und Rot sind weniger verwendet. Die zurückhaltende Farbigkeit ist der des einen Dioskurides-Mosaiks ähnlich (Besuch
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Museo Archeologico Nazionale. Mosaik der Alexanderschlacht, Detail: Dareios und Perser
bei der Hexe, Raum LIX); Sie entspricht der frühhellenistischen Kunstauffassung, der sich die Maler der beiden Vorbilder verpflichtet gefühlt haben. Mit dem Alexandermosaik ist ein wichtiges Beispiel der griech. Malerei und eine der einst zahlreichen Darstellungen aus dem Leben Alexanders d. Gr. erhalten geblieben.
In den Räumen LXI-LXII sind vorübergehend röm. Porträts aufgestellt, im Raum LXIV Köpfe griech. Statuen.
Obergeschoß
In den Räumen CXIV-CXVII sind die Funde aus einer von der Lava des Vesuv-Ausbruches von 79 n. Chr. begrabenen röm. Villa bei Herculaneum ausgestellt. Es war ein reich ausgestattetes Haus, und sein Schmuck an Skulpturen stellt einen der größten zusammenhängenden Komplexe dar, welcher den Kunstsinn und den Geschmack. der röm. Aristokratie in der ausgehenden Republik und zu Beginn der Kaiserzeit beleuchten kann.
Doch steht die vollständige Erforschung des Anwesens noch aus, und es fragt sich, ob sie je durchgeführt werden kann, weil die Ruine vollständig vom neu entstandenen Gestein eingepackt wurde. Durch Zufall war man bei der Anlage des Gartens unterhalb des Palastes von Portici im 18. Jh. auf die Villa gestoßen, und der damals regierende König von Neapel, Karl III., nahm von Anfang an regen Anteil an der Ausgrabung und ließ die Funde in den Palast bringen. Das Unternehmen selbst war sehr schwierig durchzuführen, weil die Lava zu einem festen Gestein erkaltet war. Ein Bergwerksingenieur, Carlo Weber, leitete die Arbeiten 1750-61 und legte in einem großen Plan und Tagebuchaufzeichnungen Rechenschaft darüber ab. In Stollen grub man sich durch das Gelände der Villa hindurch, an den Mauern und Säulenreihen entlang, und brachte die wichtigsten Funde nach oben. Vieles, was zu stark zerstört oder unwichtig schien, blieb unten. Man vermutet, daß die Villa einem Zweig der stadtrömischen Adelsfamilie der Pisonen gehörte und daß ein Calpurnius Piso Caesoninus, Schwiegervater Caesars, oder dessen Sohn, also Caesars Schwager, zu den Auftraggebern ihrer Ausstattung gehörte. Auch läßt sich eine Verbindung zur griech. Philosophenschule der Epikureer feststellen, und einer ihrer späteren Vertreter, Philodemos, scheint hier als Gast geweilt zu haben. Unter den verkohlten Papyrusrollen in der Bibliothek fanden sich solche mit Schriften des Schulgründers Epikur und v. a. auch dieses Philodemos.
In Raum CXV links neben der Tür der Plan von C. Weber mit Eintragungen von der Grabung oben und unten am Rand v. a. aus den Jahren 1750-54, dann bis 1758 weitergeführt (Süden = oben). Die Mitte nimmt das langgestreckte Gartenrechteck ein mit Säulenhallen an den 4 Seiten und dem schmalen Wasserbecken in der Mitte mit halbrunden Ausbuchtungen an den Schmalseiten.
Links davon befindet sich durch einen großen Raum getrennt das
Peristyl, ein quadratischer Innenhof mit je 10 Säulen an den Seiten und ebenfalls einem schmalen Wasserbecken in der Mitte. Nach oben im Plan folgt das Atrium mit dem quadratischen Impluvium in der Mitte. Durch eine Öffnung im Dach fiel das Licht ein und sammelte sich das Regenwasser. Weiter oben nach 5 gab es eine Porticus, von wo man einen freien Ausblick über das Meer in Richtung auf Capri und die Halbinsel von Sorrent hatte. Links vom Atrium und dem Innenhof befindet sich die Bibliothek hinter einer rechtwinkligen Säulenhalle. In 2 Räumen waren die Buchrollen magaziniert. Man las oder ließ sich vorlesen in der Halle, wobei man sitzen konnte oder auch auf und ab ging. Bad, Küche und Wirtschaftsräume lagen in den z. T. nicht erforschten Bezirken unten und links. Der Zugang zu dem Anwesen erfolgte von N (unten auf dem Plan), von der Landstraße Neapel-Herculaneum her, die später durch die Porta di Ercolano auch Pompei erreicht.
Der Grundriß entspricht mit seinen einzelnen Teilen dem von prunkvollen Häusern in den Vesuv-Städten seit dem 2. Jh. v. Chr., wobei das von der Eingangsseite abgewendete Atrium als Besonderheit auch in der Villa dei Misteri von Pompei vorkommt. Die Masse der Ausstattung stammt aus der 2. Hälfte des 1. Jh. v. Chr.
Es scheint, als sei das Haus zum Zeitpunkt der Zerstörung nicht mehr in der alten Weise verwendet worden. Vielleicht hat es auch schon unter dem Erdbeben von 62 n. Chr. gelitten. Es ist möglich, daß einige der Skulpturen nicht an ihrem urspr. Ausstellungsort aufgefunden worden sind. Bei der Neuaufstellung hat man nicht die Gelegenheit wahrgenommen, wenigstens einen annähernden Eindruck von der antiken Anordnung zu vermitteln. So stammt die Marmorstatue mit dem Bildnis eines Knaben aus einem Raum westlich des großen Gartens. In der Manier der röm. Porträtisten sind hier die Züge eines Kindes mit dem idealen, klassisch griechischen Körper einer Statue aus dem 4. Jh. v. Chr. verbunden. Es ist ein Werk des frühkaiserlichen Klassizismus. Die Bronzeplastiken sind z. T. Brunnenverzierungen.
Von einem runden Wasserbecken stammen die Tigerköpfe als Wasserspeier (Nr. 69 762-69 771). Die kleinen Bronzeköpfe in der Eckvitrine stellen berühmte Griechen dar und legen Zeugnis von der geistigen Einstellung vieler röm. Aristokraten der Epoche ab. Oben auf rundem Sockel mit griech. Inschrift der Philosoph Epikur und sein Schüler Hermarchos (die größeren), der Philosoph Zenon und der politische Redner Demosthenes (die kleineren). Sie wurden in einem Raum zwischen dem quadratischen Innenhof und dem Garten gefunden. Darunter auf modernen Basen wieder Demosthenes, der größte unter ihnen, und der Epikureer Metrodor. Dann noch ein zweiter Epikur, der im Bibliotheksraum gefunden wurde, und eine röm. Dame mit der Frisur der Kaiserin Agrippina d. J. (15-59 n. Chr.). Von den Wasseranlagen im Atrium stammen die bronzenen Putten und die Silene. Die Putten standen auf kleinen Säulen, jede hinter einem Wasserbecken, und die Silene um das
Becken des Impluviums herum, 2 mit Panthern, aus deren Mäulern feine Wasserstrahlen kamen, 2 mit ihren Wasser verströmenden Weinschläuchen; ebenso funktionierte auch der große Weinschlauch, auf welchem der fünfte, wohl die zentrale Figur, sitzt.
In Raum CXIV sind 2 Vitrinen mit Resten von verkohlten Papyrusrollen aus der Bibliothek der Villa aufgestellt. Sie enthalten Schriften v. a. von epikureischen Philosophen, des Schulgründers Epikur, seines Schülers Metrodor aus dem 3. Jh. v. Chr., besonders aber des späteren Philodem aus dem 1. Jh. v. Chr., dessen Werk hauptsächlich aus diesen Funden erschlossen werden kann.
Die Bilder an der Wand sind aus der Wanddekoration im 4. Stil herausgelöst. Die Stilleben, Landschaften und Tierbilder saßen ursprünglich in der Mitte von großen einfarbigen Flächen, die von gemalter Architektur gerahmt waren.
In den Räumen CXVI und CXVII ist die Masse der Kunstwerke ausgestellt, welche den Schmuck der Villa ausmachten. Sie wurden im Bereich des Atriums, des Säulenhofes und des Gartens gefunden. Leider hat man nicht den Versuch unternommen, wenigstens eine Vorstellung von ihrer ehemaligen Verteilung zu vermitteln.
Durch die vergrößerten Pläne und die darin eingezeichneten Fundstellen wird dieses Versäumnis ein wenig behoben.
Raum CXVI. Die Bildnisse stammen v. a. aus dem Atrium und dem Hof. Sie waren dort auf etwa 1,30 m hohen Steinpfeilern als Hermenschäften aufgestellt, die man bei der Grabung unten gelassen hatte. Die heutigen Sockel und die Gewandstücke bei einigen der Bildnisse wurden im 18. Jh. für die Aufstellung im Palast von Portici hinzugefügt. Es sind Kopien nach griech. Bildnissen, von denen nur der Kopf wiederholt worden ist. Links von der Tür: Ein hellenistischer Herrscher (Nr. 5588), der Kopf einer Siegerstatue aus dem 4. Jh. v. Chr. (Nr. 5594), ein hellenistischer Herrscher, wahrscheinlich Seleukos I. von Syrien (312-281; Nr. 5590), standen im Atrium; 3 nicht identifizierbare Bildnisse griech. Philosophen aus dem 4. Jh. v. Chr. (Nr. 5623, 5607, 5602) waren im Hof aufgestellt; abermals hellenistische Herrscher, wohl Ptolemaios II. und I. von Ägypten (304-285-246; Nr. 5600 und 5696), und ein nicht identifizierter hellenistischer Herrscher (Nr. 5598) wieder im Atrium. Ein Isis-Priester (Nr. 5634), ein röm. spätrepublikanisches Bildnis (Nr. 5586), ein röm. Priester (Flamen; Nr. 5587) sind Porträts aus dem 1. Jh. v. Chr. Sie waren in Räumen zwischen Hof und Garten aufgestellt. In der Nähe der abgerundeten Enden des langen Wasserbeckens im Garten wurden die beiden trunkenen Gestalten gefunden, der junge Faun, der sich im Schlaf zurücklehnt, und der alte Silen, der in seinem Rausch noch zu einem Lied mit den Fingern schnalzt. Sie sind nach hellenistischen Vorbildern gearbeitet. Von dort stammen auch die beiden Hirsche, die beiden aufeinander losgehenden Ringer, die wie der sich auf einem Fels ausruhende Hermes aus der Zeit des Überganges von der späten Klassik zum frühen Hellenismus stammen.
Die sog. Tänzerinnen, Mädchenfiguren im schweren Peplosgewand der frühklassischen Zeit, können auf Vorbilder aus der 1. Hälfte des 5. Jh. v. Chr. zurückgehen. Bis auf 2 wurden sie in der südl. Säulenhalle des Gartens gefunden. Sie waren dort in einer Reihe nebeneinander aufgestellt. Der tief zur Seite geneigte Bronzekopf rechts neben ihnen (Nr. 5618) stammt aus einem der Räume zwischen Hof und Garten, wo auch er auf einen Hermenpfeiler aufgesetzt war. Im 19. Jh. hielt man ihn für ein Bildnis des Platon, weil von diesem überliefert ist, daß er mit vornübergebeugtem Kopf gegangen sei. Später bezeichnete man ihn als Dionysos, den Gott des Weines. Wahrscheinlich ist es der Kopf einer Statue des Gottes der Gärten und der Fruchtbarkeit, des Priapos.
Die im Raum CXVII ausgestellten Statuen, Bronze-und Marmorhermen stammen aus dem Peristyl, dem Garten und dem Saal dazwischen. Dort wurde die marmorne Frauenstatue Nr. 6240 gefunden; wen sie darstellt, ist unbekannt. Ebenfalls im Saal stand die ausschreitende Athena (Nr. 6007) in der zierlichen Haltung und den fein gelegten Falten des archaistischen Stils, der im 1. Jh. v. Chr. besonders beliebt war. Die männlichen Statuen waren im Garten an der Schmalseite vor den Säulen aufgestellt. Sie hatten wahrscheinlich symmetrisch zu seiten des Durchganges, dem Garten zugewendet, ihren Platz, denn ursprünglich waren es 4, von denen jedoch eine so zerstört ist, daß bei der Grabung nur noch Reste vorgefunden wurden. Auch die Statue Nr. 6126 war sehr beschädigt; Kopf und Arme sind neu. Die Benennung, früher als Homer, heute als Isokrates (ein athenischer Redner des 4. Jh. v. Chr.), ist unsicher. Auch bei dem bartlosen Mann mit der freien rechten Schulter (Nr. 6210) ist nicht bekannt, wer dargestellt ist. Identifizierbar ist nur das Bildnis des athenischen Redners und Politikers Aischines aus dem 4. Jh. v. Chr. (Nr. 6018). In diesem Fall ist die spätklassische griech. Ehrenstatue als Ganzes kopiert und gibt einen Eindruck vom Wesen der griech. Bildniskunst, bei welcher nicht nur die Gesichtszüge, sondern der ganze Körper zur Darstellung eines Menschen gehörten. Auf Grund ihrer andersartigen Bildnisauffassung ließen die Römer häufig aber nur die Köpfe als Büsten oder Hermen kopieren, bei denen meist nur die Kopfwendung etwas vom ehemals dazugehörigen Körper wiedergibt. Solche Hermen aus Marmor sind in großer Zahl im Garten gefunden worden. Sie standen an den Langseiten des Wasserbeckens, je 2 als Gruppe beieinander, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Hecke oder Lauben, wie es römische Gartendarstellungen zeigen. Doch sind dafür nicht nur Bildnisse kopiert worden. So ist Nr. 6164 der Kopf einer Statue des klassischen Bildhauers Polyklet, Nr. 6322 der einer Athena-Statue. Von den Bildnissen sind mit einiger Sicherheit nur zu benennen: Philetairos (Nr. 6148), der erste Herrscher von Pergamon aus der Mitte des 3. Jh. v. Chr., und der spartanische König Archidamos III. (Nr. 6156), die zusammen auch im Garten eine Gruppe gebildet haben.
Unter den in diesem Raum ausgestellten Bronzehermen, deren steinerne Pfeiler ebenfalls bei der Grabung nicht geborgen wurden, befinden sich bemerkenswerte Stücke. Nr. 5616 ist das beste Exemplar eines in vielen Wiederholungen erhaltenen hellenistischen Bildnisses. Wessen Gesicht diese eindrucksvollen Züge wiedergeben, ist nicht bekannt. Früher galt der Kopf als der des röm. Philosophen Seneca; heute neigt man dazu, in ihm das fiktive Bildnis des frühgriech. Dichters Hesiod zu sehen. Nr. 5610 ist die Kopie nur des Kopfes einer Statue des jugendlichen Herakles von Polyklet, bei der die Kopfneigung wiedergegeben ist. Nr. 5592 stellt Hygieia dar, die Tochter des Ärztegottes Asklepios, die Göttin der Gesundheit. Nr. 4896 kann ein Frauenbildnis aus dem 4. Jh. v. Chr. sein; man hat schon an ein fiktives Porträt der Dichterin Sappho aus dem 7. Jh. v. Chr. gedacht. — Nr. 4885 und Nr. 4889 in der Ecke stammen aus dem Peristylhof; sie waren an Ecksäulen aufgestellt und aufeinander bezogen. Auch die ähnliche Zurichtung der bronzenen Hermenoberteile mit der Wiedergabe des quer durchgesteckten vierkantigen Holzbalkens läßt sie als Gegenstücke erscheinen.
Der männliche Kopf ist eine sehr gute Wiederholung vom Kopf des Hauptwerkes des unter den Kunstschätzen der Villa häufig vertretenen argivischen Bildhauers Polyklet (um 430 v. Chr.). Er stammt von der Statue des Speerträgers, dessen beste Gesamtkopie im Erdgeschoß steht (Raum III, Nr. 6011). Der Kopist hat auf der Brust seine Signatur eingegraben: Apollonios, der Sohn des Archias, aus Athen. Der weibliche Kopf gehört zu einer Amazonenstatue des Phidias, des attischen Zeitgenossen von Polyklet, und da man auf Grund von Hinweisen in der antiken Literatur den Speerträger als Bild des Achill ansehen kann, dürfte mit diesem Amazonenkopf eine Anspielung auf dessen Episode mit der Amazonenkönigin Penthesileia während des Trojanischen Krieges gegeben sein.
Die Mitte des Obergeschosses nimmt ein hoher Saal ein, dessen Gewölbe 1781 von Pietro Bardellino mit Fresken geschmückt wurde: ein Triumph der Künste und Wissenschaften unter König Ferdinand IV. von Neapel. Auf dem Fußboden ist ein Meridian mit den Sternbildern angegeben, die ihrer Stellung im Jahr entsprechend am Mittag, durch eine Öffnung an der S-Seite, von einem Sonnenstrahl getroffen werden. — An der Rückwand steht der Atlas Farnese (Nr. 6374), eine hellenistische Statue, die den Titanen Atlas als Träger der Himmelskugel zeigt. Das Relief auf der Kugel gibt Hinweise auf die astronomischen Kenntnisse im Altertum.
Mit seiner Sammlung antiker Gemälde steht das Archäologische Nationalmuseum von Neapel einzigartig da. Die Bilder stammen aus den vom Vesuv verschütteten Städten Pompei, Herculaneum und Stabiae; sie wurden bei den frühen Grabungen aus den Wänden geschnitten, da man damals noch nicht über die nötige Erfahrung verfügte, sie an der Wand selbst zu konservie-
ren. Daher sind die meisten aus dem Dekorationssystem, in das sie eingefügt waren, herausgenommen und erscheinen im folgenden Text als Einzelbilder behandelt, was nicht ihrem Sinn entspricht; urspr. sind sie mit der Dekoration Zusammen aufgemalt worden und waren in ihrer Farbigkeit oft von den kräftigen großen Flächen abhängig. Bei den pompejanischen Ausgräbern hat sich erst allmählich die richtige Einschätzung entwickelt. Heute werden die ausgemalten Räume überdacht, so daß die Bilder an ihrem Ort bleiben können. Über die pompejanische Malerei s. S. 515-517.
Raum LXVI enthält Teile von Wänden des 4. Stils aus Pompei (Stuckrelief und Farbe) sowie aus Wänden herausgeschnittene Einzelfiguren.
Raum LXVII: Italische Grabmalerei, Fragmente eines Frieses mit tanzenden Frauen, aus Ruvo, 5. Jh. v. Chr. (Nr. 9352-9357), ein Schwert und ein Schild aus Gnathia (Nr. 9359), aus Paestum Totenspiele, Krieger auf dem Marsch (Nr. 9362-9364) und gemalte Grabbeigaben (Nr. 9351), aus der samnitischen Nekropole von Cumae eine thronende Matrone (Nr. 123 929), ein Priester aus Capua (Nr. 9360). In der Mitte stehen bemalte Gräber aus Afragola (Nr. 152 850; 3. Jh. v. Chr.).
In Raum LXVIII sind Beispiele für Wanddekorationen vom 2. bis 4. Stil angebracht. Aus dem 2. Stil, rechts dem Fenster gegenüber, oben: der Kampf mit einem Greifen, zwischen einem Gefäß und einem Schild; darunter der Durchblick auf einen Rundtempel (Nr. 8594) aus der Villa des Diomedos, Pompei. Auf den roten Wänden hängen Fische, Geflügel und (Nr. 9847) ein Hase. — Links ein Beispiel der sorgfältig gemalten, feineren Dekoration 2. Stils (Nr. 8593), rechts ein fast barock wirkender Durchblick 4. Stils (Nr. 9731). — Zwischen den Fenstern hängen Ausschnitte von Wänden des 3. Stils. Geradeaus zu seiten der Türe (Nr. 9302) auf rotem Grund 2 Dreifüße mit Darstellungen von sterbenden Niobiden (2. Stil). In Raum LXIX befinden sich Wandteile einer Villa in Boscoreale (bei Pompei) — eines der besten Beispiele des 2. Stils in Kampanien (andere Wandstücke aus dieser Villa werden im Metropolitan Museum of Art von New York aufbewahrt). — In der Dreiergruppe vor rotem Grund wird eine Szene aus dem Leben am makedonischen Hof gesehen: rechts der König Amigonos Gonatas zu Füßen seiner Mutter Phila, links der Philosoph Menedemos aus Eretria. — In der Mitte zeigen 3 Stücke die für den 2. Stil typischen, perspektivisch gemalten Architekturdarstellungen: die Säulen vor der Wand, den vorspringenden Konsolenfries mit tanzenden Figuren und den Durchblick im oberen Teil der Wand. Zwischen den Säulen konnten auch Girlanden aufgemalt werden, wie das Bruchstück rechts davon zeigt.
In Raum LXX befindet sich ein Teil der aus den Wänden herausgeschnittenen Bilder aus Pompei: Nr. 8992: Herakles als Sklave bei Omphale, die die Waffen des Helden an sich genommen
hat. Nr. 8898: Die Stadt Alexandria als thronende Göttin, zwischen den Personifikationen des dunkelhäutigen Libyens und Asiens mit der Elefantenmütze. Nr. 9285: Triumph des jugendlichen Dionysos auf einem von Stieren gezogenen Wagen; daneben (Nr. 9270) die Kindheit des Dionysos (aus Herculaneum). — Nr. 9286: Dionysos entdeckt die schlafende Ariadne auf Naxos. — Nr. 9111: Orest und Pylades, die gekommen sind, um Iphigenie aus Tauris zu entführen, gefangen vor dem König Thoas.
In Raum LXXI stehen auf einem Pult Rötelzeichnungen auf Marmorplatten aus Herculaneum: ein Kentaurenkampf (Nr. 9560) und ein fahrendes Viergespann (Nr. 9564). An den Wänden sind die großen Bilder aus der Basilika von Herculaneum angebracht: Herakles entdeckt seinen Sohn Telephos, der von einer Hirschkuh gesäugt wird (Nr. 9008). Vor ihm die Nymphe Arkadia. Die paradiesische Sphäre, in der die Begegnung stattfindet, wird durch den Frieden zwischen den Tieren gekennzeichnet. Theseus, nachdem er den Minotauros bezwungen hat (Nr. 9049). Zu seiten dieses Bildes 2 mythische Unterweisungen: Der Kentaur Chiron unterrichtet Achill im Leierspiel (Nr. 9109); Pan unterrichtet Olympos im Flötenspiel.
Raum LXXII enthält verschiedene Wiederholungen nach der gleichen Vorlage; der Vergleich zeigt, wie frei die Maler kopiert haben. Bei der Befreiung der Andromeda durch Perseus (Nr. 8993 und 8998) läßt sich das gleiche Urbild noch verhältnismäßig leicht erkennen. In der Ecke, bei der Medea vor der Ermordung ihrer Kinder (Nr. 8976, 8977), sind Veränderungen in der Haltung der Arme und in der Farbigkeit des Gewandes vorgenommen worden.
Auf Nr. 8976 ist die Entschlußlosigkeit vor dem tragischen Schritt eindrucksvoll vorgeführt, während auf Nr. 8977 die gleiche Gestalt den Entschluß schon gefaßt zu haben scheint. Nr. 9026 und Nr. 9027 zeigen ähnlich die Gruppe um Admet und die sterbende Alkestis. Die Nebenfiguren sind anders geordnet. Nach einem Orakel sollte Admet sterben. Doch konnte ein anderer an seiner Stelle umkommen. Seine Frau Alkestis nahm dieses Schicksal auf sich. Nr. 9043 wiederholt das gleiche Vorbild wie Nr. 9049 aus der Basilika von Herculaneum: Theseus verläßt das Labyrinth, nachdem er den Minotaurus erlegt hat. — Nr. 116 085 und gegenüber Nr. 9110 variieren ein Bild, das die Entdeckung des Achill durch Odysseus und Diomedes darstellt. Wegen der Prophezeiung seines frühen Todes sollte er, als Mädchen verkleidet, vom Trojanischen Krieg ferngehalten werden; das bläst ein Trompeter Alarm, worauf sich der in Frauenkleidern verborgene Achill durch seinen Griff nach den bereitgestellten Waffen zu erkennen gibt. — Die 3 großen Bilder an der Rückwand stammen aus dem sog. Haus des tragischen Dichters in Pompei. Nr. 9105 und Nr. 9559 waren im selben Raum in die gleiche Dekoration eingefügt und auch thematisch aufeinander bezogen. 2 mythische Hochzeiten, links Achill und Chryseis, rechts Rhea und Kronos. — Das Bild in der Mitte (Nr. 9112) ist
früher, in einer einfacheren Auffassung und von weniger geübter Hand gemalt: die Opferung der Iphigenie in Aulis. Links steht der klagende Vater Agamemnon vor der Statuette der Göttin Artemis, die in den Wolken schon die Hirschkuh heranführt, die sie gegen Iphigenie austauscht, rechts der Seher Kalchas, der das Opfer fordert. — Auf dem Pult in der Mitte Rötelzeichnungen: eine Marmorplatte mit den Knöchelspielerinnen (Nr. 9562), signiert von dem athenischen Maler Alexandros.
Raum LXXIII wirkt einheitlich durch das Weiß im Hintergrund der meisten hier zusammengestellten Bilder. Die griech.
Vorlagen sind in den Geschmack des 3. Stils übersetzt, doch ist die Darstellung in der Mitte zusammengeschoben, um dem hellen Umraum mit den verschwimmenden Landschaften, die in dieser Zeit besonders beliebt waren, Platz zu machen. Auch hier sind Bilder jeweils eines Wohnraumes solchen von verschiedenen Malern, die das gleiche Thema behandeln, gegenübergestellt. Die Bilder neben dem Fenster und die Darstellung links der Tür gehören zusammen.
Vor einer Säulenhalle spielen Szenen aus der griech. Tragödie: Phädra berät sich mit ihrer Amme (Nr. 114 322); Medea vor dem Mord an ihren Kindern (Nr. 114 321); Paris vor der Entführung der Helena (Nr. 114320). Nr. 9257 und Nr. 9249 gehören zu einem Aphrodite-Zyklus: die Bestrafung des Eros und Aphrodite und Ares. — 3 schwarz gerahmte Bilder gleicher Größe stammen ebenfalls aus einem Zimmer, sind thematisch aber nicht aufeinander bezogen: Pan mit der Syrinx zwischen Nymphen (Nr. 111 473); Europa auf dem Stier (Nr. 111 475) und die Bestrafung des Kentauren Nessos durch Herakles (Nr. 111 474). Links daneben ist auf einem größeren Bild das gleiche Thema behandelt (Nr. 9001). Die beiden Maler haben das Motiv ihres Vorbildes sehr frei verwertet. Das Thema des kolossalen Farnesischen Stieres erscheint auf einem Wandbild (Nr. 9042; rechts neben dem Fenster): Dirke wird zur Strafe von Amphion und Zethos an einem Stier angebunden. — Ein bekanntes Bild aus der Welt des antiken Theaters steht auf dem Pult in der Mitte (Nr. 9019): ein Schauspieler mit den Insignien eines Königs; aus einem Kasten auf dem Tisch wird seine Maske für den Auftritt herausgenommen.
In Raum LXXIV sind auf dem Pult in der Mitte (aus Stabiae) und an den Wänden Figuren ausgestellt, die aus der Mitte großer Farbfelder herausgeschnitten wurden. Die meisten von ihnen sind schwebend dargestellt: Mänaden, Satyrn, Nymphen und Eroten. Neben dem bekannten Rot sind Schwarz, Gelb, Grün und Blau als Farbe des Grundes vertreten. — Dem Fenster gegenüber Teil einer Wand 4. Stils. Zwischen die Architektur ist ein rotes Feld eingespannt, auf welches das Bild gemalt ist: Der geflügelte Hypnos erscheint der schlafenden Pasithea (Nr. 9202); sie wird von einem Eros aufgedeckt. Hinter ihr sitzt, um die Weihen der Hochzeit zu vollziehen, die geflügelte Parthenos. Wie der rechts unten lehnende Thyrsos-Stab zeigt, vollzieht sich diese
mythische Hochzeit im Sinne der dionysischen Mysterien, wie sie in Pompei, in der sog. Mysterienvilla, gefeiert worden sind.
Die Bilder im Durchgangsraum LXXV stammen aus Rom.
In Raum LXXVIII sind Wände aus der Villa des Agrippa Postumus, eines Enkels des Augustus, in Boscoreale bei Pompei ausgestellt. Es handelt sich um die feinsten Beispiele für die Dekorationsweise des 3. Stils aus den Vesuv-Städten: Über dem schwarzen Sockel ist die rote Wand durch ein System von weißen Ornamentbändern unterteilt: Sie umrahmen weiße Bildfelder, auf denen zart getönte, idyllische Landschaften gleichsam schweben.
Die kleinen, aus den Wänden herausgeschnittenen Landschaften stammen aus anderen Häusern. Sie gehören zu einer Gattung von dekorativen Bildern, die während des 3. und des 4. Stils an verschiedenen Plätzen in das System der bemalten Wand eingefügt wurden. Mit ihren idyllischen kleinen Heiligtümern, den Villen und Anlagen am Ufer können sie Motive der röm. Villenarchitektur an der Sorrentinischen Küste verarbeiten.
Auch Raum LXXVII ist zu einem Teil von diesen Landschaften gefüllt, die in ihrer Vielfalt das Thema eines heiteren ländlichen Lebens variieren. Eine Ausnahme bildet Nr. 9506 mit dem Sturz des Ikaros. Daneben — in der Mitte der Wand, dem Fenster gegenüber — stellt ein großes fast quadratisches Bild ein bekanntgewordenes Ereignis aus den letzten Jahren von Pompei dar (Nr. 111 222). 59 n. Chr. war es im Amphitheater während eines Gladiatorenspiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Bürgern von Pompei und Gästen aus Nocera gekommen, bei der die Pompejaner ihre Gäste niedergemacht hatten. Der Vorfall wurde vom Senat in Rom behandelt, der das Amphitheater daraufhin für 10 Jahre schließen ließ. Auf dem Bild sieht man in das Rund des Amphitheaters. Um die Arena läuft ein Sockel aus Marmorimitation. Vorn führen die Treppen zu den Sitzreihen hinauf. Rechts ragt noch ein Teil der Palästra in das Bild hinein. Dahinter liegt die Stadtmauer. Das Gebiet um das Amphitheater ist also in vereinfachter Weise wiedergegeben. Über dem Theater ist das Sonnensegel ausgespannt. Durch kleine, braun aufgemalte Figuren wird das Geschehen angedeutet. — Den hinteren Teil der Wand nehmen Medaillons und Bildnisse ein, unter denen ein Paar besonders hervorsticht (Nr. 9058), der Mann in weißer Toga mit Schriftrolle, die Frau im roten Gewand und mit einer Schreibtafel. Die Frisur ist die der Jahre nach 50 n. Chr. — Die Bilder an der Rückwand des Saales führen z. T. in den religiösen Bereich. 2 Darstellungen befassen sich mit dem Kult der ägyptischen Göttin Isis. Nr. 8924 zeigt eine feierliche Handlung vor einer Treppe. Man kann in diesen Andeutungen den Isis-Tempel von Pompei wiedererkennen. Nr. 8919 gibt einen ekstatischen Tanz wieder. — Nr. 9693 bringt die beiden heilbringenden Schlangen von einem gemalten Lararium. Eine Schlange ist auch auf dem Bild mit dem Vesuv im
Hintergrund sichtbar (Nr. 112 286); der Berg ist zur Hälfte mit Reben bepflanzt. Weiter oben wachsen Bäume. Links steht der Gott Dionysos. Sein Gewand hat die Form einer Traube. Seine Attribute sind der Thyrsos-Stab und der Kantharos, zu dem hier der Panther hinaufspringt. Das Bild zeigt den Vesuv in der friedlichen Form, die er vor dem Ausbruch von 79 n. Chr. hatte. — Das Bild darüber stellt eine Opferszene vor einem Hausaltar dar. Der Genius der Familie mit dem Füllhorn vollzieht das Opfer. Seitlich tänzeln die beiden Laren, die Hausgötter. Den unteren Bildstreifen nehmen die beiden Hausschlangen ein. — An der Fensterwand sind Szenen des öffentlichen und privaten Lebens angebracht: das Urteil des Salomon (Nr. 113197), Vorgänge auf dem säulenumstandenen Forum (Nr. 9062, 9069, 9068, 9066, 9067, 9070), beim Brothändler (Nr. 9071) und Bankettszenen.
Die Vitrinen in Raum LXXIX enthalten Gladiatorenrüstungen. — In Raum LXXX v. a. Gegenstände aus Elfenbein und glasierte Terrakotten. In Raum LXXXI farbiges Glas (eine blau-weiße Vase mit kelternden Amoretten aus dem Grab vor der Porta Ercolano in Pompei; blaue Glasplatten der gleichen Technik mit dionysischen Szenen). — In Raum LXXXII v. a. Silbergeschirr aus Pompei und Herculaneum (das Geschirr in der mittleren Vitrine stammt aus dem sog. Haus des Menander in Pompei).
Die Wandvitrinen in Raum LXXXIII bringen Goldschmuck Von verschiedenen Orten vom 8. Jh. v. Chr. bis zum 7. Jh. n. Chr. In der Mittelvitrine ist die sog. Tazza Farnese ausgestellt, eine Schale aus Onyx, durch dessen verschiedenfarbige Schichten das Relief hell auf braunem Grund erscheint. Sie ist in Ägypten im 2. Jh. v. Chr. hergestellt worden. Durch das allegorische Relief wird auf die Fruchtbarkeit des Nil-Landes hingedeutet. Die Rückseite nimmt eine Gorgonenmaske ein. Das Gefäß befand sich im 14. Jh. in Persien, tauchte dann in Venedig auf und kam schließlich in den Besitz der Familie Farnese.
In den Räumen LXXXIV und LXXXV ist eine Sammlung antiker Glasgefäße untergebracht.
In den folgenden Räumen Beispiele für die verschiedenartige Verwendung antiker Terrakotten: Raum LXXXVI: Architekturverkleidung von griech. Tempeln (Cumae, Metapont, Paestum), etruskischen Gebäuden (Velitrae, Capua) und pompejanischen Häusern. — Raum LXXXVII: Figuren und Reliefs aus Terrakotta, die meist in Opfergruben gefunden werden sind (in der Mitte stehen 2 etruskische Sarkophagdeckel in Form von liegenden Figuren). — Raum LXXXVIII: Großplastik aus Terrakotta. Zu seiten der Tür Schauspieler mit den Masken vor dem Gesicht. Die lebensgroße Jupiter- und Juno-Statue sowie eine Büste der Minerva stammen aus dem Tempel des Zeus Meilichios in Pompei. Die Jünglingsfiguren haben als Grabstatuen gedient.
In Raum LXXXIX sind kleine Marmorskulpturen ausgestellt, die in röm. Gärten als Schmuck, z. T. als Brunnenfiguren, gedient haben.
Die Räume XC-XCVI enthalten Figuren, Geräte, Gefäße und Möbel aus Bronze. In Raum XCVI sind darüber hinaus noch Bilder aus Pompei und Herculaneum an den Wänden angebracht, hauptsächlich Stilleben und Tierbilder. In der Mitte steht eine Nachbildung der Grabungen von Pompei aus d. J. 1879 im Maßstab 1 : 100. Das Gelände zwischen dem Forum und der Via Stabiana und der Stadtmauer zwischen Porta Ercolano und Porta Vesuvio war damals freigelegt. Die Aquarelle auf der Empore sind moderne Kopien pompejanischer Wandbilder und Ansichten von Pompei von L. Bazzani aus d. J. 1901-18. Eine Karte zeigt den Stand der Grabungen zur Regierungszeit Ferdinands IV. von der Villa des Diomedes (oben links) bis zum Amphitheater und dem Haus der Julia Felix (rechts).
Museo Nazionale di Capodimonte
Der Palazzo Reale von Capodimonte liegt weithin sichtbar auf der Hügelkuppe von Miradois (vom spanischen »mira todos« = Rundblick) im N der Stadt.
Von Anfang an war die Geschichte der königlichen Kunstsammlungen mit der des Palastes verknüpft. 1731 starb Antonio Farnese, 8. Herzog von Parma, ohne Nachkommen zu hinterlassen; damit war seine Nichte Elisabeth, seit 1714 Gemahlin des spanischen Königs Philipps V. von Bourbon, die letzte Trägerin jenes in der italien. Kunstgeschichte so vielfach berühmten Namens. Nach allerlei internationalen Verwicklungen brachte die ehrgeizige Monarchin es fertig, ihrem Sohn Don Carlos nicht nur das Erbrecht auf den immensen Kunstbesitz des Hauses Farnese, sondern auch den Thron des Königreiches Neapel und beider Sizilien zu verschaffen. Als Sieger über die Österreicher, die seit dem Spanischen Erbfolgekrieg das Land besetzt hielten, zog der 18jährige König 1734 in Neapel ein, alsbald gefolgt von Wagen- und Schiffsladungen voller Bilder, Bücher, Statuen und anderer Kunstgegenstände aus Rom und Parma, die einstweilen mehr schlecht als recht im Palazzo Reale magaziniert wurden. Nachdem der Friede von Wien (1735) ihm den Besitz seines Reiches bestätigt hatte, begann Karl ein ausgedehntes Bauprogramm in die Wege zu leiten (Teatro S. Carlo, Albergo dei Poveri, Granili, Portici, Caserta); der Befriedigung einer speziellen Passion des Herrschers diente die Gründung der »Siti Reali«, einer ausgedehnten Kette von Jagdrevieren rings um die Stadt (Procida, Lago di Patria, Carditello, Fusaro, Portici, Resina u. a.). Auch am Hügel von Capodimonte scheint nicht sosehr die herrliche Aussicht den König gereizt zu haben als vielmehr (nach C. Justi) »der blöde Sport, im Monat August die zu Tausenden dort herumflatternden Feigenfresser (beccafichi) zu schießen«.
Gleichwohl wurde der 1737 geplante Palast von vornherein auf die Ausmaße eines Residenzschlosses angelegt, bei dessen Inneneinrichtung den neu erworbenen Kunstschätzen eine Hauptrolle zugedacht war.
Die Baugeschichte begann 1738 mit einer festlichen Grundsteinlegung, stand aber von da an unter einem recht unglücklichen Stern. Der Architekt Giovanni Antonio Medrano, von Hause aus Militäringenieur im Rang eines Oberstleutnants, hatte sich nach Erlangung des Auftrages der Hilfe des damals in Portici tätigen Antonio Canevari versichert; dieser zeichnete eine Serie von Entwürfen, die Medrano in halbfertigem Zustand an sich brachte und dann als eigene Erzeugnisse ausgab. Die Ausführung des so zustande gekommenen Planes vertraute man den Händen Angelo Carasales an, eines in jenen Jahren emporgekommenen Bauunternehmers, der 1742 wegen allerlei illegaler Geschäfte verhaftet und abgeurteilt wurde. Er befaßte sich hier zunächst mit der Anlage gewaltiger Substruktionen, die unkontrollierbare Kosten verursachten; überdies trieben Wassermangel und das Fehlen einer Fahrstraße auf den Hügel die Baukosten in schwindelhafte Höhen. So verlor der vielfältig abgelenkte König bald das Interesse an diesem Unternehmen; nach Fertigstellung von etwa zwei Dritteln des Mauerwerks (südl. und mittleres Karree) blieb der Bau im Rohzustand stehen und wurde nur im 1. Stock notdürftig bewohnbar gemacht. 1755 nahmen die Pläne für die Aufstellung der farnesischen Sammlungen Gestalt an: Ein Teil des königlichen Appartements sollte als »Regio Museo« eingerichtet werden. 1759 waren alle Bestände untergebracht, von musealer Ordnung allerdings noch weit entfernt. Winckelmann, der damals öfters »mit großer Beschwerlichkeit und Ermüdung« die Anhöhe von Capodimonte erstieg, hatte die optimistische Zukunftsvision: »Wenn unsere Enkel einmal das Glück haben werden, diesen ganzen Schatz in Ordnung aufgestellt zu sehen, so wird er einen so ansehnlichen Raum behaupten, als irgendeiner.« Die Bibliothek, oder was nach den fortgesetzten Diebstählen ihrer Betreuer von ihr übriggeblieben war, lag »in den Dachstuben übereinander«; die Gemälde hingen planlos an den Wänden halboffener Räume, dem Wechsel von Zugwind und Feuchtigkeit ausgesetzt. Nach 1782 hatte der zum königlichen Hofmaler ernannte Philipp Hackert Gelegenheit, sich um die Bilder zu kümmern und einen Restaurator einzustellen, der die schlimmsten Schäden ausbesserte. Doch stand ihnen bald ein neuer Transport bevor: Joseph Bonaparte, 1806 von seinem Bruder Napoleon als König eingesetzt, erkor das Schloß von Capodimonte zu seiner Hauptresidenz, richtete sich in den Räumen ein und ließ die Sammlungen in den Palazzo degli Studi hinunterschaffen, wo sie mit dem übrigen Kunstbesitz des Königs vereint wurden. Am Palast scheint Bonaparte nichts weiter verändert zu haben, wohl aber wird ihm die Anlage der Fahrstraße von der Stadt bis zum »Tondo di Capodimonte« verdankt (Corso Napo-
leone, später Amedeo di Savoia, 1809 eröffnet; die ägyptisierende Terrassen- und Treppenanlage am oberen Ende entstand 1836 nach einem Entwurf A. Niccolinis). Erst z. Z. der bourbonischen Restauration erhielt der Palast sein heutiges Aussehen: 1834-36 wurden nach den Plänen Medranos der N-Flügel zu Ende geführt und der Außenbau rundum abgeputzt; Tommaso Giordano errichtete 1835-38 das große Treppenhaus; gleichzeitig wurden die Säle des Piano nobile dekoriert. In ihnen fand in der Folgezeit eine stetig wachsende Sammlung zeitgenössischer Gemälde und kunsthandwerklicher Erzeugnisse Platz. Die alte Bildergalerie blieb im Palazzo degli Studi (seit 1860 Museo Nazionale); ihre Bestände vermehrten sich durch bedeutende Ankäufe (Sammlung Borgia aus Velletri, mit Werken des 14. und 15. Jh.); dazu kamen die Bilder der Francavilla-Galerie (s. S. 295). Erst 1947 ging der Palast von Capodimonte aus dem Besitz des italien. Königshauses in den des Staates über. 1952 begann die Rückführung der kunsthistorischen Sammlungen, 1957 konnte das neue Museum eröffnet werden; seine Einrichtung durch den damaligen Direktor Bruno Molajoli zählt zu den exemplarischen Leistungen moderner Museumstechnik.
Die Architektur des Palastes erfreut das Auge durch ein kräftiges Wandrelief, frische Farbigkeit (der für Neapel charakteristische Effekt von dunkelgrauen Peperingliederungen vor rotem Verputz) und nicht zuletzt dank der splendiden Vegetation des umgebenden Parks. Doch können solche Vorzüge kaum über die Roheit der Einzelformen hinwegtrösten; Canevari selber hatte bei seinen vergeblichen Protesten gegen das Vorgehen Medranos auch mit Nachdruck darauf verwiesen, daß seine Zeichnungen unfertig gewesen seien und eingehender Verbesserungen und Verfeinerungen bedurft hätten. Der Bau ist als langgezogenes Rechteck mit 3 quadratischen Innenhöfen angelegt. Die äußeren Quertrakte greifen T-förmig über den Block hinaus und bilden an den Längsseiten rahmende Risalite; die Maße der Fronten verhalten sich dadurch wie ungefähr 1 :2 (9 : 17 Fensterachsen). Der Aufriß zeigt 2 Ordnungen von gebündelten Pilastern (unten dorisch mit Rustika, oben toskanisch), die je ein Haupt- und ein Mezzaningeschoß umfassen; eine massive Attika kaschiert den Dachansatz. An allen 4 Seiten wiederholen sich die gleichen einfachen Portal- und Fensterformen; ebenso läuft die Pilastergliederung ununterbrochen ringsum, wobei die gelegentlich auftretenden doppelten Bündelungen die Struktur des Innenbaus andeuten sollen. Dieser entwickelt sich nämlich über einem gleichmäßig durchgezogenen Ach-
sennetz: die Innenhöfe messen jeweils 33 Achsen, die Gebäudeflügel sind 2 Achsen tief; dementsprechend sind die Außenfassaden in 2-und 3achsige Abschnitte unterteilt, was allerdings erst bei genauem Zusehen verständlich wird.
Die Höfe haben im Erdgeschoß durchlaufende Portiken mit klobigen Vierkantpfeilern. Im mittleren Hof sollte urspr. die aufwendig geplante Haupttreppe aufsteigen. Zur Ausführung kam im ersten Bauabschnitt nur eine provisorische Stiege; sie wurde abgebrochen, nachdem Giordano 1835-38 den neuen N-Flügel mit einer großen repräsentativen Treppe ausgestattet hatte, für deren dorische Säulen er sich nach eigener Bekundung die Tempel von Paestum zum Vorbild nahm.
Antonio Canevari und Giovanni Antonio Medrano, Palazzo Reale di Capodimonte - Hauptfassade, 1738-59, Neapel.
Antonio Canevari und Giovanni Antonio Medrano, Palazzo Reale di Capodimonte - Nordöstliche Fassade, 1738-59, Neapel.
Antonio Canevari und Giovanni Antonio Medrano, Palazzo Reale di Capodimonte - Salone da Ballo, 1738-59, Neapel.
Antonio Canevari und Giovanni Antonio Medrano, Palazzo Reale di Capodimonte - Salone d'Armi, 1738-59, Neapel.
Hauptsehenswürdigkeiten: 2. Stock: Simone Martini (Saal 4) — Masaccio, Masolino (Saal 6) — Raffael (Saal 7 u. 10) — Correggio (Saal 15) — Giov. Bellini (Saal 17) — Tizian (Saal 19) — Bruegel (Saal 20) — Carracci (Saal 25) — Reni (Saal 27) — Ribera (Saal 31) — Giordano (Saal 41) — Goya (Saal 45). — 1. Stock: Neapolitan. Meister des 19. Jh. (Saal 47-65) — Porzellan und Majolika (Saal 68-71, 82-84) — Renaissance-Bronzen (Saal 83, 87) — Porzellankabinett (Saal 91) — Cofanetto Farnese (Saal 95).
Von den Schätzen der Galleria Nazionale im 2. 0bergeschoß können hier nur die Hauptstücke besprochen werden; ein vollständiges Verzeichnis des ausgestellten Bestandes bietet der Katalog von Molajoli.
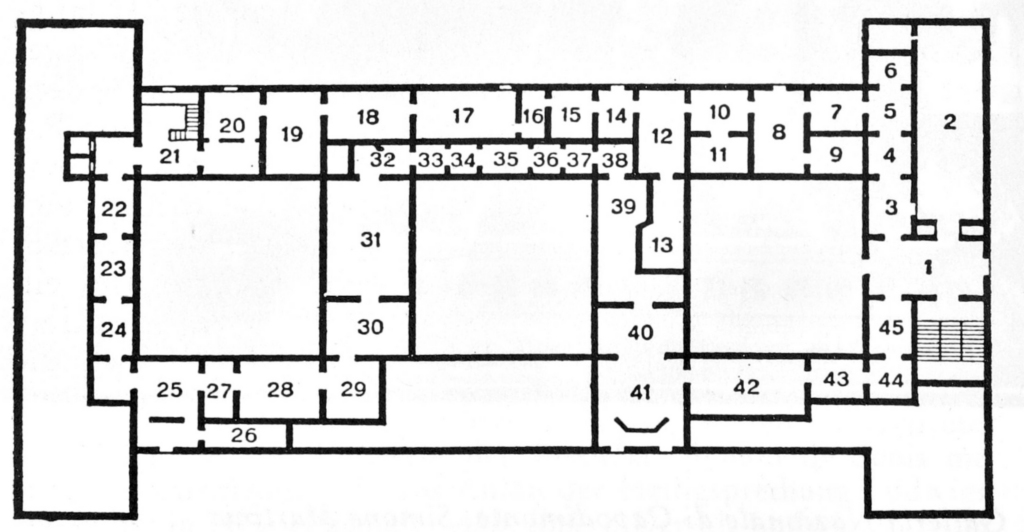 Palazzo Reale di Capodimonte. 2. Obergeschoß, Grundriß
Palazzo Reale di Capodimonte. 2. Obergeschoß, Grundriß
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Galleria Nazionale di Capodimonte. Simone Martini: Der hl. Ludwig von Toulouse krönt Robert d. Weisen
In Saal 2 hängt die berühmte Teppichserie der Schlacht von Pavia, wahrscheinl. nach Entwürfen des Bernart von Orley in Brüssel gewebt, später in den Besitz der Avalos del Vasto gelangt (s. S. 288) und 1862 dem Museum gestiftet. Das große Treffen, das den europäischen Hegemonieträumen Franz’ I. ein Ende setzte, war eine typische Landsknechtsschlacht: Schweizer und Deutsche, Italiener und Spanier standen auf beiden Seiten. Der Kampf entbrannte im Morgengrauen des 24. April 1525 um ein befestigtes Feldlager der Franzosen im Park nördlich der von ihnen belagerten Stadt; nach einer Stunde hatte das kaiserliche Entsatzheer den Feind in die Flucht geschlagen. Die Teppiche geben eine ausführliche Chronik der Ereignisse: 1. Vormarsch der kaiserlichen Truppen, Duell zwischen Franz I. und dem kaiserlichen Feldherrn Marchese Civita Santangelo. 2. Angriff der Kaiserlichen auf die französ. Artillerie. 3. Sturm auf das französ. Lager; die Schweizer Franz’ I. desertieren. 4. Einbruch ins Lager, Flucht des königlichen Gefolges. 5. Die in Pavia eingeschlossenen Spanier brechen aus und greifen die französ. Nachhut an. 6. Gefangennahme Franz’ I. 7. Flucht der französ. Artillerie. — Bei allem Figurengewimmel sind die Bilder von bewundernswert klarer Anordnung und Genauigkeit in der Wiedergabe der militärischen Vorgänge. In einzelnen Episoden kommt flämisch-derber Humor zu seinem Recht, etwa bei den fliehenden Damen des Hofstaates oder in den Figuren einzelner Krieger, die schon während des Kampfes auf Beute ausgehen und mit Hühnern beladen in die Schlachtreihe zurückkehren. Außerordentlich schön die Hintergründe, die die einförmige lombardische Ebene in eine Hügel-und Parklandschaft verwandeln; der Horizont ist stets hoch genommen, um die Übersicht über den Kampfplatz zu geben. In Bild 5 eine Ansicht des türmereichen Pavia mit der gedeckten Holzbrücke über den Ticino, wohl nach einem zeitgenössischen Holzschnitt.
Saal 3 enthält das erstaunliche Fragment eines großen marmornen Osterleuchters, vermutl. süditalienisch (kampanisch?) Ende 13. Jh., mit 4 halb nackten, halb in transparente Gewänder von griech. Feinheit gehüllten Tragfiguren. Vergleichbare Figuren, die in die Mitte des 13. Jh. datiert werden, hat der Osterleuchter der Cappella Palatina zu Palermo; ihnen gegenüber erweist sich das Neapler Stück als jünger, schon gotisch beeinflußt. — Bemerkenswert außerdem die große Tafel der Madonna del flumine aus der gleichnamigen Kirche bei Amalfi (kampanisch 2. Hälfte 13. Jh.), und die Tafel mit dem hl. Dominikas und 12 Szenen aus seinem Leben, wohl schon vom Ende des Jahrhunderts, aus S. Pietro Martire.
In Saal 4 das berühmte Krönungsbild von Simone Martini aus Siena (sign. in den Zwickeln der Predella: Symon de Senis me pinxit), wahrscheinl. 1317 aus Anlaß der Heiligsprechung Ludwigs von Anjou in Neapel gemalt (Abb. links). Der hl. Ludwig, 2. Sohn Karls II., war 1296 als Franziskanermönch zum Bischof von Tou-
louse ernannt werden und hatte bei diesem Anlaß zugunsten seines jüngeren Bruders Robert auf die ihm zukommende Neapler Königskrone verzichtet; vermutl. wollte Robert selbst durch seinen Hofmaler den damals recht umstrittenen Vorgang im Lichte himmlischer Gnade verklären lassen. — Über den im Faltstuhl sitzenden Bischof halten 2 Engel die Krone der Heiligkeit; er selbst setzt die angiovinische Lilienkrone seinem demütig verkleinert neben ihm knienden Bruder aufs Haupt. Die Predellenbildchen zeigen das Leben des Heiligen bis zu seinem frühen Tod (1298); das Wunder der 5. Szene (Auferweckung eines aus dem Fenster gefallenen Kindes) bewirkt er posthum auf Anrufung eines Mannes, der seine Figur in die Höhe hält. Urspr. scheint sich das Bild im Franziskanerkonvent von S. Chiara befunden zu haben, später in S. Lorenzo Maggiore, von wo es 1921 in die Galerie kam. Obwohl die Oberfläche im Lauf der Jahrhunderte schwer gelitten hat, bleibt die Tafel eines der schönsten Zeugnisse für den malerischen Sinn der Sienesen des 14. Jh. Mit dem Goldgrund verbinden sich die gebrochenen Braun-, Weiß-und Rottöne zum »koloristischen« Gesamteffekt — man vergleiche dagegen den rein gegenstandsbezogenen, distinktiv-rationalen Gebrauch der Farben bei Giotto und seinen Florentiner Nachfolgern; von besonderem Raffinement die Wiedergabe der kostbaren Gewandstoffe mit ihren abwechselnd aufscheinenden Außen-und Innenseiten. Das hierarchische Kompositionsschema (reine Frontal-und Profilansicht) wird durch leichte Achsenverschiebung gemildert, die ungleiche Verteilung der Massen wiederum im Spiel der langen, welligen Linienzüge ausbalanciert.
Saal 5 enthält Werke mittelitalien. Meister des 14. und 15. Jh. (Taddeo di Bartolo, Gualtieri di Giovanni, Bernardo Daddi u. a.).
In Saal 6 zwei Hauptmeister der Florentiner Frührenaissance: Masolino und Masaccio. Von Masaccio die Kreuzigung aus dem 1426 für S. Maria del Carmine in Pisa gemalten Polyptichon (weitere Teile des Altars heute in Pisa, Wien, Berlin und London). Ein charakteristisches Werk des jungen Revolutionärs, der 2 Jahre später 27jährig verstarb: 4 monumentale Figuren ohne jedes Beiwerk agieren vor einem raumlosen Goldhintergrund; die straff und wuchtig umrissenen Farbflächen werden im seitlich einfallenden Licht weich-fest modelliert, ungestüme Verkürzungen und Überschneidungen zwingen den Effekt der Dreidimensionalität herbei; in Mimik und Gestik sind die inneren Positionen der »dramatis personae« zu konzentriertestem Ausdruck gebracht. Ikonographisch interessant der aus dem Kreuzesstamm sprießende Lebensbaum, den erst die jüngste Restaurierung wieder zum Vorschein gebracht hat. — Als Werke Masolinos werden heute einstimmig die beiden Bilder aus S. Maria Maggiore zu Rom anerkannt; sie bildeten urspr. Vorder- und Rückseite der Mitteltafel des von Martin V. Colonna gestifteten Schneewunder-Altars. Der Stil des 18 Jahre älteren Meisters ist sanfter und zierlicher, aber keineswegs reaktionär, wie die kühnen und glänzend gelungenen Ver-
kürzungen (Gottvater über der Assunta!) beweisen. Die Maria Assunta, umgeben von Cherubim und musizierenden Engeln, war der Rückwand des Altars zugekehrt; die Vorderseite zeigt — frei nach dem Fassadenmosaik vom Ende des 13. Jh. — die Gründungslegende der Kirche: Ein Schneefall mitten im Sommer (3. August 352) markiert auf dem Gipfel des Esquilin den Grundplan des Baues, einschließlich des erst im Mittelalter angefügten Querschiffs; Papst Liberius eilt herbei und zieht den. Umriß mit der Hacke nach. Das umstehende Gefolge, das den Vorgang fromm und ernst verfolgt, ist höchst kunstvoll im Raum verteilt; die in die Tiefe führenden Leitlinien der Seitengebäude wie auch des Basilikagrundrisses laufen in einem zentralen Fluchtpunkt zusammen.
Mit liebevollem Realismus ist die meteorologische Natur des Wunders geschildert: Unter dem Goldhimmel kommen, perspektivisch geordnet, unverkennbare Schneewolken angesegelt; dank der Restaurierung ist auch das Geriesel der Flocken wieder sichtbar geworden. Im Jenseits, über den Wolken, erscheinen in kreisrunder Aureole die Halbfiguren Christi und der Maria.
In Saal 7 einige bedeutende Bilder des Quattrocento aus Mittelitalien, darunter der schauerlich-großartige Kindermord von dem Sienesen Matteo di Giovanni, einem Spezialisten für diesen in Siena besonders beliebten Gegenstand, mit reichstem architektonisch-dekorativem Beiwerk all’antica, dat. 1468 oder, wahrscheinlicher, 1488 (aus S. Caterina a Formiello). — Zu beachten ferner die Verkündigung mit Johannes d. T. und dem hl. Andreas, ein Frühwerk des Filippino Lippi (ca. 1483-85), mit Ausblick auf das Arno-Tal und Florenz: Man erkennt die Türme und Kuppeln von S. Maria Novella, Baptisterium, Dom, Palazzo Vecchio, Bargello, Badia und im Hintergrund den Doppelgipfel des Monte Morello.
— Mit dem Namen Raffaels verbinden sich die beiden Fragmente mit der Gestalt Gottvaters von einem ca. 3,92,3 m großen Altarbild aus der Augustinerkirche zu Città di Castello, für das der 17jährige Meister am 10. Dezember 1500 einen Vertrag unterzeichnete. 1789 wurde das Bild bei einem Erdbeben zerstört. Außer den Neapler Stücken ist von der Haupttafel nur noch ein Engelskopf in der Pinakothek von Brescia übriggeblieben; Teile der Predella (von Gehilfenhand) wahrscheinl. in Detroit. Dargestellt war die Krönung des Nikolaus von Tolentino: Der Heilige stand mit 4 Engeln und dem zu Boden geworfenen Satan in einem gegen die Landschaft geöffneten Kapellenraum; unter dem Gewölbe erschien in einer Mandorla mit 4 Seraphim der hier erhaltene Gottvater, flankiert von den Halbfiguren Mariens und des hl. Augustinus. Obwohl die Urkunden eindeutig zugunsten Raffaels sprechen, bereitet die Zuschreibungsfrage Kopfzerbrechen. Typik und Stil sind ohne weiteres von Raffaels Lehrer Perugino herzuleiten (Fresken im »Cambio« zu Perugia); in der gedrängten und festen Fügung der Figuren und der höchst energischen individuellen Durchbildung mancher Details möchte man wohl die »Klaue des
Löwen« erkennen, doch ist anderes wieder so hölzern und leblos geraten, daß es sich in das Jugendwerk Raffaels nicht recht einfügen läßt; möglicherweise hat der im Vertrag genannte, 25 Jahre ältere Mitarbeiter Evangelista di Pian di Mileto bei der Ausführung dieses Oberteils mitgewirkt.
Saal 8 wird beherrscht von dem mysteriösen Doppelbildnis des Fra Luca Pacioli und eines vornehm gekleideten Schülers, wahrscheinl. des Herzogs Guidobaldo von Urbino (1495). Der offensichtlich dem Kreise Piero della Francescas nahestehende, viell. auch venezianisch geschulte Künstler »Jaco. Bar.« hat sich noch nicht identifizieren lassen. Luca Pacioli aus Borgo Sansepolcro, selber ein Freund und Verehrer seines Landsmannes Piero, lehrte Mathematik und Geometrie in Perugia, Urbino, Florenz, Venedig, Rom und Mailand, wo er auch zu Leonardo da Vinci in Beziehung trat. 1494 erschien seine »Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità«, 1509 die speziell für Künstler gedachte Abhandlung »De Divina Proportione«, ergänzt durch Pieros um 1480 niedergeschriebenen Traktat »De prospectiva pingendi«.
Der Glaube der Zeit an das mathematische Fundament der Künste, zu dem bereits Brunelleschi und Alberti sich bekannt hatten, wird in unserem Bild aufs feierlichste verkündet: »Schon der langgesichtige, in eine härene Kutte gehüllte Franziskaner hat das Aussehen eines geometrischen Körpers; auf dem mit einem grünen Tuch bedeckten Tisch des gelehrten Tausendkünstlers liegt ein aufgeschlagenes Buch, auf das der Finger des Professors weist, daneben ein geschlossenes Buch, auf dem ein glitzernder Dodekaeder ruht und dessen eine Schnittfläche die Aufschrift Li. R. Luc. Bur. (Liber Reverendi Lucae Burgensis) trägt; auf der Tafel wird die Konstruktion des dem Kreis eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks demonstriert, darüber der kristallene Ikosahexaeder, der in De Divina Proportione beschriebene Sechsundzwanzigflächner« (A. Chastel).
Die kürzlich erfolgte Reinigung hat die alte Leuchtkraft der Farben herrlich zur Geltung gebracht. — Ferner hier und im folgenden Saal 9 eine Reihe wichtiger Bilder aus neapolitan. Kirchen, Werke einheimischer oder zugewanderter Meister der 2. Hälfte des 15. Jh., die einen Einblick in die komplizierte Stilsituation mit ihren sich kreuzenden Einflüssen aus Flandern, Frankreich, Spanien und Oberitalien vermitteln. Der schöne Hieronymus mit dem Löwen gilt als ein Hauptwerk des Colantonio, des angebl. Lehrers Antonellos da Messina; dahinter scheint ein verlorenes Bild des Jan van Eyck zu stehen, das Facius 1456 in der Sammlung König Alfons’ I. sah.
In Saal 10 begegnen wir nochmals einem von Zuschreibungsproblemen belasteten Raffael: Es ist das um 1510-12 zu datierende Bildnis des Kardinals Alessandro Farnese, der 1534 als Paul III. den Päpstlichen Stuhl besteigen sollte und der uns später im Tizian-Saal wieder begegnen wird. Ein 1511 entstandenes Freskoporträt Farneses von Raffaels Hand findet sich in den Stanzen
des Vatikan (Übergabe der Dekretalien). Unser Bild wird seit 1587 unter dem Namen Raffaels in den farnesischen Inventaren geführt. Vom Glanz seines Pinsels ist hier freilich nichts zu spüren; die vielfach verdorbene Oberfläche wirkt stumpf und tot, das Kolorit ohne Reiz, die Landschaft im Hintergrund entbehrt jeder Feinheit. Und doch ist die Auffassung der Figur im ganzen so groß und so neuartig, die Charakteristik so eindringlich, die Zeichnung des Kopfes und v. a. der Hände von so hoher Meisterschaft, daß an der wenigstens teilweisen Authentizität des Bildes kaum gezweifelt werden kann; Vollendung von anderer Hand oder spätere Beschädigung und Übermalung könnten die offenkundigen Schwächen erklären. — Eines der berühmtesten Bildnisse Raffaels, darstellend Leo X. mit den Kardinälen Luigi de’ Rossi und Giulio de’ Medici (dem späteren Clemens VII.), ist durch eine Kopie von Andrea del Sarto oder einem seiner Gehilfen vertreten; sie wurde 1524 für den Marchese Gonzaga zu Mantua angefertigt (das Original in Florenz, Uffizien). — Aus dem weiteren Umkreis Raffaels stammen 3 Darstellungen der Hl. Familie. Die von Vasari hoch gelobte Madonna del Divino Amore (Nr. 146) scheint zumindest einen Bildgedanken des späten Raffael (um 1518) zu enthalten; der Durchblick im Hintergrund gibt einen gewissen Begriff von raffaelischer Landschaftsbehandlung. Die Ausführung, von schwankender Qualität, wird meist dem Francesco Penni (Il fattore) zugeschrieben; auch Giulio Romano und dessen Schüler Raffaele Pippi sind genannt worden. Eine stark beschädigte Kartonvorzeichnung befindet sich gleichfalls im Besitz des Museums (nicht ausgestellt). — Ein sicheres Werk des Giulio Romano ist die Madonna del Gatto (Nr. 140; genannt nach der dämonisch starrenden Katze im Vordergrund), um 1524, düster und kompliziert. — Die Hl. Familie mit dem Johannesknaben (Nr. 148) ist ein »Pasticcio« verschiedener Raffael-Motive, von einem unbekannten Nachahmer (in anderen Museen zahlreiche Varianten dieses Typus). — Die anderen Bilder des Raumes stammen von Sebastiano del Piombo (Seb. Luciani), der als gebürtiger Venezianer und Schüler Giorgiones 1511 nach Rom kam und mit dem Raffael-Kreis in fruchtbare Wechselbeziehungen trat, später jedoch zu Michelangelo überlief. Ein packendes Dokument vom Ende der Hochrenaissance ist sein großes Bildnis Clemens’ VII. (1526): Dank der katastrophalen Politik dieses Medici-Papstes kam es 1527 zum »Sacco di Roma«‚ der Plünderung Roms durch die Truppen Karls V., mit der der glänzendste Abschnitt der neueren Kunstgeschichte sein Ende fand. Äußerer Herrschaftsanspruch und innere Unsicherheit vereinigen sich zu einem Bild von fataler Eindruckskraft; »doch mit keinem Zug wirbt der Künstler um eine gefühlshafte Teilnahme: Eine eisige Sphäre breitet sich um die Gestalt, sie ist entrückt in einen abstrakten Bereich des Erhabenen, wo das Humanitätsideal nicht mehr verpflichtendes Zentrum ist« (L. Dussler). Der Papst sitzt hoch aufgerichtet in seinem Armstuhl, doch geht der
Blick seitlich ins Leere, der Ausschnitt mit dem fehlenden linken Unterarm wirkt sonderbar zufällig; die Malweise ist breit und flüssig, die Modellierung betont die plastischen Werte des Körpers; das Kolorit erhält durch fahlsilbrige Lichter und graublaue Schatten eine fast dissonante Spannung. — Aus den letzten, von Krankheit und vorzeitigem Altersverfall überschatteten Lebensjahren des Papstes stammt die geisterhafte Porträtstudie rechts neben dem Hauptbild (um 1532, auf Schiefer gemalt). — Die gleiche Technik kennzeichnet die nicht ganz fertig gemalte Hl. Familie, um 1520 bis 1525 entstanden. Im Motiv von Raffael angeregt (Madonna del Velo, Louvre), läßt die statuarisch verfestigte Komposition v. a. den Einfluß Michelangelos spüren. Die dumpf lastende Grundstimmung der Figuren ist mit artistischer Kühle reflektiert; eine kostbare und überaus reiche Farbigkeit zeugt von dem eigensten Interesse des Venezianers.
Nebenraum 11 enthält Werke der Hochrenaissancezeit aus Neapel und Süditalien; am interessantesten die vielfigurige Kreuztragung von Polidoro Caldara di Caravaggio, einem Lombarden, der in Rom zum Kreis der Raffael-Schüler zählte und sich v. a. als Fassadenmaler einen Namen machte. Nach dem Sacco di Roma ging er für einige Jahre nach Neapel und dann nach Messina, woher unser Bild stammt. Die niederländisch anmutenden Züge des Werkes könnten durch graphische Vorlagen angeregt sein.
In Saal 12 eine große Himmelfahrt Mariae (Madonna della Cintola) von dem Florentiner Hochrenaissancemeister Fra Bartolomeo, dat. 1516. — Ein charakteristisches Werk des am Mediceerhof gepflegten Manierismus ist das um 1533 entstandene Bild von Venus und Amor, dessen Zuschreibungen von Bronzino und Allori bis zu dem damals in Florenz tätigen Flamen Hendrik van der Broecke reichen. Aus der gleichen Zeit (1534) die Auferstehung Christi von dem Sienesen G. A. Bazzi (il Sodoma); ferner ein sehr schönes JÜnglingsporträt von Rosso Fiorentino. Die Kopie ’von Michelangelos Jüngstem Gericht, von Marcello Venusti 1549 für den Kardinal "Alessandro Farnese gemalt, ist das wichtigste Dokument für den urspr. Zustand dieses Werkes (vor den Übermalungen durch Daniele da Volterra).
In Saal 13 spätere Manieristen aus Mittelitalien (Vasari, Pulzone, Passignano) und aus Neapel: Bei diesen zeigt sich der Weg von der Raffael-Nachfolge (Andrea Sabatini da Salerno) zur Aufnahme oberitalien. Einflüsse, v. a. aus dem Umkreis Correggios, die für die spätere Wirkung Caravaggios den Boden bereiteten (Pino, Curia, Santafede).
Saal 14 zeigt lombardische Maler des 16. Jh., alle mehr oder weniger unter dem Eindruck Leonardos.
Die Nachbarlandschaft Emilia, die in jenen Jahren eine führende Rolle in der Entwicklung der italien. Malerei übernimmt, ist in Saal 15 mit bedeutenden Werken vertreten. Der größte Name ist der des Correggio (Antonio Allegri); die hier vereinigten Werke
gehören sämtlich der Frühzeit des jung verstorbenen Künstlers an.
Die kleine »Zigeunermadonna« (La Zingarella, um 1515) ist wohl als Ruhe auf der Flucht nach Ägypten zu verstehen: Maria sitzt am Boden und beugt sich tief über das auf ihrem Schoß eingeschlafene Kind; hinter ihr erscheinen 3 sachte herniederschwebende Engelchen. Ein sanftes Leuchten durchdringt die Düsternis des umgebenden Waldesdickichts, hebt einzelne Partien der Gruppe hervor und läßt andere im Schatten verschwinden; der Linienführung eignet jene weich-flüssige Anmut, durch die Correggio auf nahezu 3 Jahrhunderte europäischer Malerei gewirkt hat. — Die gleiche proto-barocke Einheit von Figuren und landschaftlichem Ambiente zeigt das 1517 oder wenig später entstandene Verlöbnis der hl. Katharina (es handelt sich um die anerkannt beste von etwa 20 in verschiedenen Sammlungen verstreuten Fassungen dieses Bildchens).
Die aus duftigen Schattentönen auftauchenden Farben sind hier zu beinah unglaublicher Leuchtkraft gebracht; die Pinselführung ist von bezaubernder Frische, dabei sehr fein und genau in der Zeichnung der Hände und Gesichter. — Correggio zugeschrieben werden die Tafel mit dem hl. Antonius Abbas (aus S. Filippo Neri) und die beiden 1529 datierten Nischenfiguren (Schranktürflügel?) des hl. Joseph und eines Stifters. — Parmigianino (Francesco Mazzola) brilliert hier v. a. als Porträtist. Die luxuriös gekleidete junge Dame gilt als die röm. Kurtisane Antea; das höchst fesselnde Männliche Bildnis, das durch Ritterrüstung und Waldesdunkel im Hintergrund einen romantisch-poetischen Einschlag erhält, stellt den Grafen Galeazzo Sanvitale dar (dat. 1524). Die Hl. Familie mit dem Jobannesknaben in skizzenhaft frei behandelter Landschaft wird um 1528 angesetzt. Das letzte Werk des 1540 im Alter von 37 Jahren verstorbenen Künstlers ist nach dem Zeugnis Vasaris die malerisch sehr delikate Lukrezia. — Von Gerolamo Mazzola Bedoli, der zeitlebens im Banne seines Landsmanns Parmigianino blieb, gibt es als Hauptwerk eine in kompliziertesten Lichteffekten schwelgende Verkündigung, ferner eine Anbetung des Kindes durch die hll. Franziskus und Antonius von Padua. Zwischen ihm und Parmigianino strittig sind das groß aufgefaßte Bildnis der hl. Klara und das Porträt eines Schneiders. — Den übermächtigen Einfluß Correggios verraten die Bilder des begabten Michelangelo Anselmi. Die reine Lichtmalerei, als eigentliches Credo der emilianischen Schule, offenbart sich besonders schön in den Engelwolken über dem Stall des Christkindes in der Geburt (Nr. 126) und in manchen Landschaftshintergründen (das frische Waldinterieur Nr. 277).
Im Durchgangsraum 16 steht eine Bronzegruppe des aus Flandern gebürtigen Florentiner Bildhauers Giovanni Bologna (Jean Boulogne). Der Künstler selbst schrieb 1579 an Ottavio Farnese, man könne den Gegenstand als Raub der Helena, der Proserpina oder einer Sabinerin interpretieren; er sei jedenfalls so gewählt, daß ein Bildhauer daran seine Fähigkeiten er-
weisen könne. Tatsächlich illustriert das Werk in erster Linie »die enorme Schwierigkeit der selbstgesetzten Aufgabe: es stellt weniger einen Raub dar als einen pas-de-deux« (j. Pope-Hennessy); die Verschlingung der beiden Figuren entwickelt sich in einer Spirale (serpentinata), so daß dem ringsum wandelnden Betrachter eine ununterbrochene Folge durchkomponierter Ansichten geboten wird.
Saal 17 führt ins östl. Oberitalien; das Hauptbild ist eines der schönsten Werke Giovanni Bellinis, die Transfiguration von ca. 1480-85. Der Berg der biblischen Erzählung (Lukas 9, 28-36) ist in die venezianische Voralpenlandschaft verlegt, ein klarer Herbsttag läßt die fernen Berge wie zum Greifen nah erscheinen. Im Vordergrund jedoch trennen ein felsiger Absturz und ein Geländer den Bildraum ab und rücken die Szene in eine unbestimmte (da durch keine Perspektivkonstruktion überbrückte) Distanz vom Beschauer. Jakobus, Petrus und Johannes knien und sitzen im Wachtraum auf dem Boden, hinter ihnen steht Christus zwischen 2 Männern, »welche waren Moses und Elia; die erschienen in Klarheit und redeten von dem Ausgang, welchen er sollte erfüllen zu Jerusalem«. Die Darstellung der »Verklärung« des Herrn geschieht durch rein irdische, innerweltliche Mittel : Die (im Bibeltext genannte) weiße Lokalfarbe des Gewandes erstrahlt im seitlich einfallenden Sonnenlicht, die überragende Größe Christi wird durch die leicht zurückgenommene Position perspektivisch motiviert; die nur scheinbar simple und lockere, in Wahrheit äußerst subtile Komposition zieht ihre Wirkung nicht zuletzt aus dem Umstand, daß von den 6 dargestellten Personen Christus als einziger rein frontal gesehen ist. Unverwechselbar venezianisch ist schließlich die farbliche »Klangwirkung«, die gleichsam vor den (durchaus nicht überall stimmigen) Einzelheiten da ist und gewisse Schwächen und Unschärfen in Verkürzung und Proportionierung der Figuren gar nicht ins Bewußtsein dringen läßt. — Von Andrea Mantegna, der auf Bellinis Frühzeit bestimmend eingewirkt hat, sieht man eine 1454 datierte Hl. Eufemia, leider schlecht erhalten. Für Mantegna bezeichnend die etwas gepreßte Haltung und v. a. die starke Untersicht (»sotto-in-sù«) des linken Armes und der rahmenden Bogenarchitektur. Der Biß des Löwen kann nach dem Text der Legende nur spielerisch-freundlich gemeint sein: Das Tier wird später über den Henkersknecht herfallen, der die Heilige martern will. Von Mantegna ferner ein miniaturhaft feines Profilbildnis des jungen Kardinals Francesco Gonzaga, um 1462 (viell. Replik eines größeren Bildes). — Ein Frühwerk des Venezianers Lorenzo Lotto, noch stark von. Giovanni Bellini beeinflußt, ist die 1503 datierte Madonna mit dem hl. Petrus Martyr und dem Johannesknaben; an dessen Stelle befand sich urspr. wohl ein Bildnis des Stifters Bernardo de’ Rossi, Bischofs von Treviso. Daneben dessen lebensfrisches Porträt von 1505; es zeigt die Nachwirkung Antonellos da Messina, aber auch neue koloristische Tendenzen.
Saal 18 enthält vorwiegend Venezianer des 16. Jh., darunter eines der besten Werke des Palma Vecchio (Sacra Conversazione). Nicht übersehen darf man die beiden kleinen Madonnenbildchen des Ferraresen Dosso Dossi (Giovanni Luteri) rechts und links vom Eingang, mit schönen, romantisch gestimmten Landschaftshintergründen; Berührung mit Lotto verrät die um 1510 zu datierende Sacra Conversazione des gleichen Künstlers. — Als Frühwerk des Greco (Domenico Theotocopulos) gilt das feine Bildnis des röm. Miniaturisten Giulia Clovio. Der ins Feuer blasende Knabe, ein beleuchtungstechnisches Bravourstück, ist möglicherweise eine Replik von der Hand des Jacopo Bassano.
Der folgende Tizian-Saal (19) umschließt das größte Besitztum der Galerie. »Es ist eine Eigentümlichkeit der Bilder Tizians«, sagt Theodor Hetzer, »daß sie, wo man ihnen auch begegnet, herrschen« — und es gibt viell. keinen anderen Museumsraum, der diese Erfahrung so konzentriert vermittelte. Tizians Porträtkunst nimmt innerhalb seines Œuvres eine besondere Stellung ein. Jedes einzelne seiner Bildnisse hat den Rang einer Neuschöpfung, in der sich Farbe und Zeichnung, Komposition und Lichtführung zur Darstellung eines Menschen zusammenfinden. Psychologischer Scharfblick und Sinn fürs »decorum« der Macht haben Tizian in den Stand gesetzt, ein umfassendes Bild des sozial bedingten Charakters bedeutender Zeitgenossen zu entwerfen; seine eigene elementare Lebenskraft aber hat jene Aura naturhafter Unbedingtheit um sie gelegt, die das absolutistische Herrscherporträt der Folgezeit bis zu seinem Ausgang (Goya) festzuhalten bestrebt war. — Die Farnese-Porträts bilden Tizians größte geschlossen erhaltene Bildnisgruppe; sie führen uns in den innersten Kreis einer Familie, die in der ersten Hälfte des 16. Jh. aus bescheidenen Anfängen zu europäischer Bedeutung emporstieg. Die Schlüsselfigur dieses Aufstiegs war Alessandro Farnese: Günstling des Borgia-Papstes Alexander VI. (mit dem seine Schwester Giulia »la bella« ein Verhältnis unterhielt), trug er seit 1493 den Kardinalspurpur; von 1534 bis 1549 saß er als Paul III. auf dem Stuhl Petri. Sein Aussehen als Kardinal unter Julius II. hat uns Raffael überliefert (s. o. Saal 10). Tizians großes, nicht ganz vollendetes Gruppenbildnis von 1546 schildert den 78jährigen in Gesellschaft seiner Enkel Alessandro (links) und Ottavio. List und Intrige, Mißtrauen und Haß der Generationen verdichten sich in Tizians Vibrierenden Weiß-, Rot-und Brauntönen zur präzisen Vorahnung kommenden Unheils: 3 Jahre später sollte sich die Spannung zwischen Paul und seinen Nepoten in jener furchtbaren Auseinandersetzung entladen, die den Tod des Papstes zur Folge hatte. — Von der körperlichen und geistigen Mächtigkeit seiner Person gibt am ehesten das links daneben hängende, wahrscheinl. 1543 entstandene Einzelportrait einen Begriff. »Es wird nicht leicht etwas Großartigeres geben«, schreibt Hetzer, »als die Belebung seines Gewandes — dieses ins Unendliche bewegte und gebrochene
Rot, das strömendes Blut und glimmendes Feuer in sich hat und sich mit dem Blick der schwarzen Greisenaugen, dem eingesunkenen, durchfurchten und doch so starken Gesicht so unvergleichlich vereinigt.« — Der Kriegsmann in schwarz schimmernder Rüstung rechts neben dem Gruppenbildnis ist Pauls kühner und gewalttätiger Lieblingssohn Pier Luigi, Herzog von Parma und Piacenza und Bannerträger der röm. Kirche, der 1547 von Parteigängern Karls V. ermordet wurde; Tizians Porträt dürfte ein Jahr vorher entstanden sein. — Pier Luigi war der Vater Ottavios und Alessandros, der beiden Assistenzfiguren des Gruppenbildes. Von dem schlangenklugen Alessandro, der 1534 (mit 15 Jahren) den Purpur erhielt und als »Gran Cardinale« bis zu seinem Tode 1589 im Kollegium eine beherrschende Rolle spielte, hängt rechts noch ein fesselndes Einzelbildnis (1543 oder 1546, die Eigenhändigkeit wohl zu Unrecht umstritten). — Den historischen Rahmen ergänzen die Bildnisse Philipps II. von Spanien und seines Vaters Karls V., der seit 1538 durch die Heirat zwischen seiner Tochter Margarethe von Parma mit dem damals gerade 13jährigen Ottavio mit dem Haus Farnese verschwägert war. Das Bildnis Philipps entstand um 1553 in Venedig (viell. nur eine Werkstattreplik des in Spanien verschollenen Originals); das des Kaisers wird 1549 datiert und ist wahrscheinl. nach den ein Jahr zuvor in Augsburg angefertigten Skizzen gemalt worden. — Von minderer Qualität und deshalb zweifellos dem Kreis der Werkstattwiederholungen zuzurechnen sind die beiden weiblichen Halbfigurenbilder, eine Büßende Magdalena und das Porträt einer unbekannten Dame. — Dagegen ist die große Danae * eines der zentralen Werke aus Tizians Reifezeit; um 1545/46 für Ottavio Farnese in Rom gemalt, später vielfach abgewandelt und kopiert (Tafel S. 384). Wie stets bei Tizian spricht am mächtigsten die Farbe — Weiß, tiefes Sammetrot und das leuchtende Inkarnat des Frauenleibes; zugleich aber hat sich der Venezianer hier das Körperideal der röm. Renaissance zu eigen gemacht und die schwingenden Umrisse der Figuren, die Kurven der Falten und das Rund der Säule im Hintergrund als ein plastisch bewegtes Ganzes durchgebildet.
Die Marmorbüste Pauls III., aus dem Palazzo Farnese zu Rom, stammt von Guglielmo della Porta, dem auch Pauls Grabmal in der Peterskirche zu Rom verdankt wird (um 1546; Werkstattrepliken in Saal 87 und im Museo di S. Martino, s. S. 237). Im Umriß großartig zusammengefaßt, ragt der knochige, von pergamentener Haut umspannte Greisenkopf aus dem Halskragen des Pluviale hervor. Die Modellierung der Züge ist von äußerster Feinheit und Schärfe — »Klugheit paart sich mit Resignation, energievoller Tätigkeitsdrang mit der Schwäche des ermüdeten Alters; aber auch dann noch bleibt Paul III. der schlaue, ganz in
* Vgl. »Reclams Werkmonographien zur bildenden Kunst«: Tizian, Danae. Einführung von Ordenberg Bock v. Wülfingen. UB Nr. B 9036
sich verschlossene Realpolitiker seines Staates und der eigenen Hausmachtpläne« (W. Gramberg). Das Gewand ist geschmückt mit den Allegorien der päpstlichen Herrschaft: Abundantia mit dem Füllhorn; Justitia mit der Waage; Pax verbrennt mit der Fackel die Waffen des Krieges (das Motiv einer trajanischen Silbermünze entlehnt); Victoria, den überwundenen Gegner zu Füßen, verzeichnet ihre Siege auf einem Schild; an den Seiten der Volksführer Moses, der die Gesetzestafeln empfängt und, nach dem Durchzug durchs Rote Meer, die Fluten über die verfolgenden Ägypter hereinbrechen läßt.
Eine neue Welt eröffnet sich in Saal 20 mit 2 herrlichen Bildern Pieter Bruegels d. A., der 1551-54 Italien bereiste und durch seine Freundschaft mit Giulio Clovio (s. o. Saal 18) auch zu dem Künstlerkreis um Alessandro Farnese in Beziehung trat. Der Blindensturz, dat. 1568, ist eine Allegorie der menschlichen Torheit nach dem biblischen Gleichnis Matth. 15, 14: »Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube.« Bei Bruegel sind es 6 Männer — ein endloser Zug —, die mit schauerlich verwüsteten Physiognomien durch eine idyllisch begrünte Landschaft taumeln; des Augenlichts (der Vernunft) beraubt, suchen sie sich vergeblich mit ihren Stöcken (den Sinnen) voranzutasten. Im Hintergrund eine Kirche, davor ein dürrer Baum: Sinnbild der Heilswahrheit, welche die mit Blindheit Geschlagenen nicht zu erkennen vermögen, oder aber (was zeitgenössische Texte nahelegen) ein versteckter Hinweis auf eine pharisäische Priesterschaft, die ihre Gemeinde in die Irre führt. — Aus dem gleichen Jahr stammt der Misanthrop, zu dessen heuchlerischer Klage »Weil die Welt so treulos ist, lege ich Trauer an« der Maler einen sarkastischen Kommentar liefert: Während die in eine zerbrechliche (vergängliche) Glaskugel eingeschlossene »Welt« ihn hinterrücks bestiehlt, kommt vom der unter der Kutte des Frömmlers versteckte Geldbeutel zum Vorschein; der Schäfer im Hintergrund stellt wohl das Gegenbild wahrer, naiver Treue dar. An der Schilderung der holländischen Landschaft mit ihren silbrigen Nebeltönen und dem flimmernden Laub der Bäume kann man sich nicht sattsehen. »Kaum ein anderer Maler hat die Welt als so schön gemalt wie Bruegel, welcher das Treiben der Menschen als so verkehrt darstellte«, hat ein deutscher Dichter hierzu bemerkt; »eines denunziert das andere und zeigt es in seiner Besonderheit, aber zugleich erhalten wir Landschaft schlechthin, Leute überall.« — Werke höchsten Ranges sind ferner die beiden großen Flügelaltäre des Joos van Cleve und die 5 phantastischen Bibellandschaften von Herri met de Bless. Die charakteristische Physiognomie Karls V. begegnet wieder in einem kleinen und feinen Brustbild von Bernart van Orley. — Die deutsche Malerei ist vertreten durch einen respektablen Cranach, Christus und die Ehebrecherin, und ein fesselndes Bild aus dem Umkreis des Konrad Witz (um 1445), die Hl. Familie in der Kirche, d. h. in einem ziemlich verwegen stilisierten Basler Münster. Höchst
merkwürdig kontrastiert das repräsentative van-Eyck-Thema (»Madonna in der Kirche«) mit der Privatsphäre eines Familienbilds: »Die Kirche erscheint als Herberge; es ist das Menschliche, das Gefühl der Geborgenheit, das unmittelbar in Bann zieht« (H. Röttgen). Die Hauptgruppe ist aus Figuren verschiedener Bilder von Witz kompiliert; der seitliche Ausblick in eine besonnte Gasse, von scharfen Schlagschatten zersägt, scheint vom Flémalle-Meister angeregt. — Bilder von Vinckbooms, Dujardin, Both, Teniers u. a. leiten ins 17. Jh. über.
Ein willkommenes Intervall bietet der Erfrischungsraum (21). Die von hier aus erreichbare Dachterrasse zeigt das Panorama der Stadt in einem besonders glücklich komponierten Ausschnitt: Den Blick Zum Hafen, entlang der Via del Duomo, rahmen rechts die Konturen des Vomero und des Pizzofalcone, links der Vesuv und die Kette der Monti Lattari; Capri schwimmt in der Mitte.
Im anschließenden Quertrakt (Säle 22-24) wechselnde Ausstellungen aus den Beständen der Handzeichnungssammlung, außerdem 2 große, eigenhändige Kartonvorzeichnungen von Raffael (Moses vor dem brennenden Dornbusch, für die Decke der Stanza d’Eliodoro, 1512-14) und Michelangelo (3 Soldaten, für die Kreuzigung Petri der Cappella Paolina, 1546/47).
Den von hier aus zum Eingang zurückführenden Weg durch die Malerei des 17. und 18. Jh. (Säle 25-45) legen die meisten Besucher geschwinder zurück; wir bezeichnen hier wenigstens seine wichtigsten Stationen.
Größte Aufmerksamkeit verdient der den Brüdern Carracci aus Bologna gewidmete Saal 25. Im Zentrum hängt Annibale Carraccis Herkules am Scheidewege, als Deckenbild des »Camerino« im Palazzo Farnese zu Rom 1595-97 gemalt, 1662 abgenommen und in die Farnesischen Sammlungen eingereiht; es handelte sich um eine Art Probearbeit für die Ausmalung der großen Galerie des Palastes, die den Ruhm Carraccis in Rom begründen sollte. Prodikos’ Fabel von der Wahl des Herkules zwischen Tugend und Wollust, als Paradigma einer ethischen Entscheidung in die Bilderwelt des Abendlandes eingegangen, hat durch Carracci ihre für lange Zeit kanonische Formulierung erfahren. Der jugendlich kraftstrotzende Held sitzt auf einem Felsblock; Haltung und Miene sind noch unentschieden, doch wandern die Pupillen schon in Richtung »Virtus«. Diese, mit einem röm. Kurzschwert bewaffnet, sucht ihn zum Besteigen des steilen und kahlen Tugendberges zu überreden, von dessen Gipfel unsterblicher Dichterruhm (Pegasus) winkt; zu ihren Füßen gelagert ein Poeta Laureatus, der eindringlich zu dem Helden emporblickt. »Voluptas«, eine kunstvoll frisierte Blondine in durchscheinendem Schleiergewand, steht als Rückenfigur vor einem anheimelnden Waldesdickicht, umgeben von den Emblemen trügerisch-kurzlebiger Weltfreuden: Masken, Musikinstrumente, Kartenspiel. Dies alles ist mit sicherem Können klar und deutlich, ohne jede »manieristische« Verschlüsselung, ins
Bild gebracht; die formale Struktur freilich ist, wie Erwin Panofsky gezeigt hat, von äußerster Komplexität: »Mit der Klarheit einer strengen Reliefkomposition ist die Fülle gerundeter Einzelfiguren und die Tonigkeit einer silbrig schimmernden Wald- und Felsenlandschaft verbunden, in ein und derselben Gestalt bald Caravaggeskes mit Raffaelischem, bald Michelangeleskes mit Klassisch-Antikem zur Einheit gebracht.« Eine phidiasische Dreierkomposition — das Hesperiden-Relief der Sammlung Torlonia in Rom — hat auf die eurhythmische Ordnung der Gruppe mit dem im Zentrum aufwachsenden Baumstamm bestimmend eingewirkt. — Die große Beweinung Christi zählt zu den machtvollsten religiösen Äußerungen des späten Annibale (man vergleiche seine frühere Version des Themas im »Cristo di Caprarola«‚ 1. Stock Saal 93). Der formale Aufbau wiederum von staunenswertem Gedankenreichtum: Der in der Diagonale ausgestreckte Körper Christi ist einer Pyramidalkomposition von der Art Raffaelscher Madonnen eingefügt; Michelangelos Marmorgruppe von St. Peter und Sebastianos Pietà in Viterbo sind als exemplarische Vorbilder gegenwärtig. Im Kolorit wie in der großzügig-pastosen Pinselführung ist der Affekt des Schmerzes zu stärkster sinnlicher Wirkung gebracht. — Aus der bolognesischen Frühzeit Annibales (um 1586) stammt das Verlöbnis der hl. Katharina, noch stark im Banne Correggios und Parmigianinos (charakteristisch der Farbakkord von dunklem Blaugrün und leuchtendem Krapprot). — Den Einfluß der Bassano und des Niccolò dell’Abbate zeigt die stimmungsreiche Landschaft mit dem hl. Eustachias, wohl wenige Jahre später entstanden. — Von Annibale noch hervorzuheben eine saftige, farbenprächtige Szene aus der Erzählung von Rinaldo und Armida (Tasso, »Gerusalemme liberata«). — Strittig zwischen Annibale und seinem älteren Bruder Agostino ist die »Satirische Komposition« von Halbfiguren und Tieren, deren Aussage uns nicht mehr verständlich ist; von Agostino ferner ein Hl. Hieronymus und die Hl. Familie mit S. Caterina.
Saal 27 wird beherrscht von Guido Renis fabelhaftem Atalante-und-Hippomenes-Bild, entstanden ca. 1625 (also ungefähr gleichzeitig mit Berninis Apoll-und-Daphne-Gruppe in Rom). Aus der tiefsinnigen Erzählung vom Wettlauf der Liebenden (der Freier gewinnt die Braut, indem er während des Laufes die von Aphrodite geschenkten goldenen Äpfel fallen läßt, nach denen das schöne Mädchen sich bückt) wird eine elegisch getönte Beschwörung des Hellenismus — »in der Zeit der Gegenreform«, schreibt G. C. Cavalli, »ein profaner Mythos vom verlorenen Paradies«.
Den verschlungenen Bewegungsablauf hat Reni in klassisch reine Umrißlinien auseinandergelegt; in sublimer Balance von Antrieb und Hemmung, Spannung und Lösung entfaltet sich das innere Drama der Handelnden. Die den heutigen Betrachter leicht irritierende Wirkung der realistisch-kühlen Aktmalerei wird aufgehoben durch den Irrealismus Renischer Farb- und Lichteffekte: In hellen,
blassen Tinten von unglaublicher Delikatesse heben die Leiber sich ab vom Dunkel des weiten und flachen Hintergrundraumes. — Von Lodovico Carracci, einem Vetter Annibales und Agostinos, stammt der große Sturz des Simon Magus (zum Thema vgl. S. 255); von Domenichino der Angelo Custode, liebenswürdig-strenger Verteidiger kindlicher Unschuld gegen die Einflüsterungen des Bösen.
In Saal 28 eine umfängliche Sammlung von Werken des Carracci-Schülers und Hochbarockmeisters Giovanni Lanfranco, dessen großartiges Temperament sich in heftig bewegten Helldunkelszenen auslebt. Das Formenrepertoire ist von unerschöpflich anmutendem Reichtum, wenngleich wenig differenziert nach Gehalt und Gegenstand; die dramatische Wirkung schlagend eindringlich bei stets gleichbleibender Lautstärke.
Saal 29 bietet einen Überblick über das Schaffen eines anderen Emilianers vom Anfang des 17. Jh., Bartolomeo Schedoni (Schidone) aus Modena.
Saal 30 führt in den Kreis der neapolitan. Carravaggio-Nachfolger. Von dem Spanier Giuseppe de Ribera, der sich in Valencia, Parma und Rom ausbildete und gegen 1616 in Neapel niederließ, sieht man ein brillantes Frühwerk: Der hl. Hieronymus hört die Posaune des Jüngsten Gerichts, auffallend hellfarbig und atmosphärisch gelockert. — Sein wichtigster einheimischer Zeitgenosse Gian Battista (»Battistello«) Caracciolo ist durch eine Flucht nach Ägypten vertreten. — Die pathetische und koloristisch sehr reizvolle Lukrezia stammt von Massimo Stanzione, der als Eklektiker von hoher Begabung und nie versagendem Schönheitssinn (hierin Luca. Giordano vergleichbar) die Lehren Riberas und Caracciolos mit den Errungenschaften Renis, Guercinos und Lanfrancos zu verbinden wußte. — Weitere Spielarten des europäischen Caravaggismus verkörpern Artemisia Gentileschi, als Tochter Orazio Gentileschis seit 1630 in Neapel ansässig (ihre Judith, ein fatales Schauerstück, ist die Replik eines Bildes aus den Uffizien); Simon Vouet aus Paris, 1613-27 in Rom tätig (2 Engel mit Passionswerkzeugen); und Carlo Saraceni (6 feine Landschaften in der Art Elsheimers).
Fortsetzung in Saal 31: 3 Hauptwerke Riberas machen verständlich, wie mächtig seine Kunst in Neapel wirken mußte (wobei freilich weder der scharfe und bittere Realismus des Spaniers noch die kalte Brillanz seiner Technik einen wirklichen Nachfolger fanden). Der Trunkene Silen, ein grandioses Exempel schwarzen Humors in der Barockmalerei, wurde 1626 für einen flämischen Kaufmann gemalt; das Motiv ist angeregt von einem Stich A. Carraccis (vgl. 1. Stock, Saal 93, La Tazza Farnese). Wahrscheinl. vom Anfang der 30er Jahre stammen die Halbfigurenbilder der hll. Hieronymus und Sebastian. — Die exzellente Kopie von Velazquez’ »Borrados« (1628), wohl gleichfalls als mythologische Satire zu verstehen, ist seit dem 17. Jh. in Neapel nachweisbar; einer Herkunft aus der eigenen Werkstatt des Meisters scheint die
freskoartige Technik entgegenzustehen (Tempera auf farbig grundiertem Papier). — Massimo Stanzione ist durch 3 große Bilder vorzüglich vertreten. — Sein Schüler Pacecco (Francesco) de Rosa entfaltet sein vorwiegend lyrisches Talent am schönsten in der Darstellung der dem Bade entsteigenden Diana im Kreis ihrer Nymphen (im Hintergrund rechts naht Aktäon); auch die Flucht nach Ägypten und die Beweinung sind beachtliche Bilder. — Von A. Gentileschi noch eine Judith und eine Verkündigung; von dem derben und kraftvollen Ribera-Nachahmer Francesco Fracanzano ein Triumph des Bacchus und die Heimkehr des verlorenen Sohnes.
In den Sälen 32-37 die bekannten Meister des Hochbarock in Neapel, alle mehr oder minder auf den Spuren Riberas und der Bolognesen: Andrea Vaccaro, Francesco Guarino, der von Callot beeinflußte Genre-Spezialist »Micco Spadaro« (Domenico Gargiulo); schließlich Bernardo Cavallino, ein Schüler Stanziones, der auch von A. Gentileschi Anregungen empfing.
Aus Saal 38 grüßt von weitem ein herrlicher Claude Lorrain, Landschaft mit der Nymphe Egeria, die über den Tod des Numa Pompilius klagt (1669); ferner eines der beliebten Kruzifixbilder des Anton van Dyck.
Saal 39 enthält Stilleben, vorwiegend Fische und frutti di mare, im 17. Jh. eine Spezialität der genußfrohen Neapolitaner (Ruoppolo, Recco, Porpora), und 2 Bilder des unruhigen Virtuosen Salvator Rosa, der den Ruhm der neapolitan. Barockmalerei in der Welt begründete, in Neapel selbst aber kaum noch zu sehen ist. Charakteristisch für ihn das Schlachtenbild, eine in düsterbranstige Farben getauchte Massenszene, aus der einzelne momentane Bewegungen, zerfetzte Fahnen, Helme und Waffen hervorblitzen. — Außerdem Varia des italien. 17. Jh., darunter das famose Porträt des Kardinals Louis de Vendôme von. G. B. Gaulli (il Baciccia).
Saal 40 enthält eine ausgezeichnete Sammlung von Werken des Mattia Preti aus Kalabrien: gedrängte Kompositionen mit starken Helldunkelkontrasten, in Nahsicht auf brüske Verkürzungen angelegt; die Handlung stets auf den dramatisch fruchtbaren Augenblick konzentriert, oft in einen einzigen Gestus zusammengedrängt, der die angestauten Emotionen zu plötzlicher Entladung bringt.
Die Wirkung Caravaggios, Guercinos, Lanfrancos ist unverkennbar; aber auch Tintoretto und Veronese haben ihre Spuren hinterlassen, so v. a. in der ergreifenden Rückkehr des verlorenen Sohnes und in den beiden großen Bankettszenen: dem Gastmahl des Balthasar, wo die himmlische Erscheinung sich auf jede erdenkliche Weise in Mienen und Gebärden spiegelt, und dem Gastmahl des Absalom, einer finsteren Mordgeschichte.
Von Luca Giordano, Neapels größtem Barockmaler, dessen märchenhaftes Talent in immer neuen Brechungen — und Trübungen — aus weit über 1000 Bildern und Fresken hervorstrahlt, sind in
Saal 41 einige Spitzenwerke versammelt. Giordanos Künstlertum ist die vollkommene Inkarnation neapolitan. Lebens-und Selbstgenusses. So wenig Grenzen seiner Begabung gesetzt waren, so wenig wurde ihm die Kunst je zum Problem. Der gigantischen Schaffenskraft hielt eine Wandlungsfähigkeit die Waage, die der eigenen Identität kaum noch achtete; nur wenige große Maler des 16. und 17. Jh. (auch Dürer und Rembrandt nicht) sind dem Schicksal entgangen, von Giordano nachgeahmt, ausgebeutet, ja gefälscht zu werden. Als »Proteus«, »Fà presto«, »fulmine della pittura« haben die Zeitgenossen das Phänomen Giordano bestaunt und zu begreifen versucht; Carl Justi glaubte, er müsse »etwas geerbt haben von dem flüchtig-geistreichen Pinsel, der leichten Aneignungsfähigkeit, dem Leben, der heiteren Farbe, der üppigen Weichheit alter Pompejaner«. — Das früheste der hier ausgestellten Bilder, die Madonna del Rosario von 1657 (Nr. 472), macht freilich auf Anhieb klar, welch unendlicher Sorgfalt in der Detailbehandlung dieser Schnellmaler fähig war. In Gesichtern und Händen paart sich der Ausdruck der Andacht mit einem Höchstmaß an individueller Charakteristik; das duftig-lebendige Inkarnat gibt dem Vorbild Rubens nichts nach. — 1659 sind die beiden in kräftiges Helldunkel getauchten Gastmähler entstanden (Herodias, Hochzeit zu Kana); sie verraten nicht nur die Kenntnis Veroneses, sondern auch eine enge Berührung mit der Kunst Mattia Pretis. — Aus dem gleichen Jahr stammt der Gang der hl. Lucia Zur Richtstätte; wenig später dürften die beiden Oktogonbilder mit dem Toten Christus und dem Tod des hl. Alexius gemalt worden sein. — Stark venezianisch wirkt auch der blendend schöne Rückenakt der Lukrezia, die sich des auf sie eindringenden Tarquinius zu erwehren sucht (1663). — Den entwickelten Stil der späten 80er Jahre, in dem Giordano sich mit Reni, Cortona, Gaulli und v. a. wieder mit Rubens auseinandersetzt, zeigen die beiden kolossalen Altarbilder aus S. Ferdinando und S. Anna di Palazzo. Das erste verherrlicht die Tätigkeit der Jesuitenmissionare Franz Xaver and Francesco Borgia. Die Beherrschung des überaus komplizierten Bildaufbaus — eine Unzahl klar vorgestellter Figuren gruppiert sich locker und leicht um 2 gleichgeordnete Zentren — offenbart das fast schrankenlose formale Können des Meisters; das Kolorit hat helle und kühle Halbtöne, in deren Umgebung auch das Schwarz des Ordenskleides etwas geradezu Strahlendes annimmt. — In der Baldachin-Madonna ist die Farbe noch weiter ausgezehrt; Schwarz und Weiß treten nicht als Helldunkelwerte auf, sondern bilden den Grundakkord einer chromatischen Skala. von aquarellhafter Durchsichtigkeit, in der Lichtblau und Hellgelb klare, bestimmte Akzente setzen. Dementsprechend hat auch die Komposition etwas extrem Offenes, ja fast Diskontinuierliches: ein Flockentanz halb kniender, halb schwebender Figuren, deren Köpfe und Hände wie zufällig zum Kreis um den verehrten Rosenkranz zusammenkommen. In ihrer Mitte thront die blasse, lichtumflossene Madonna,
hoheitsvoll-bescheiden, von verführerischer Schönheit und zugleich unnahbar rein — ein Idol barocker Volksfrömmigkeit, wie nur Neapel es sich hat schaffen können.
In Saal 42 noch 3 große Schlachtenbilder Giordanos, um 1690 entstanden (Semiramis verteidigt Babylon, Horatius Cocles kämpft am Pons Sublicius gegen Porsenna, Amazonenschlacht). Gewaltige Bewegungsströme durchziehen Menschen und Tiere, Landschaft und Atmosphäre; doch ist alles räumlich geordnet und zeichnerisch artikuliert. Ein Vergleich mit dem »Romantiker« Salvator Rosa ist geeignet, die »klassische« Grundsubstanz von Giordanos Kunst ins Licht zu rücken: Wo jener Stimmungsmomente gibt, führt dieser Ereignisse vor; Rosa schildert lyrisch, Giordano episch; der Kampf bei Rosa fast ein Naturvorgang, bei Giordano eine Kette humaner Konflikte, in welchen dem großen Einzelnen (die Gestalt der Semiramis!) die beherrschende Rolle zukommt. — Ins 18. Jh. leitet Giordanos berühmtester Nacheiferer Francesco Solimena über. Er ist hier vertreten durch eine Serie fulminanter Bozzetti, darunter 2 für die Fresken in S. Filippo Neri, von 1728-30 (s. S. 107), und die virtuose Massenkomposition des Martyriums der Giustiniani in Chios (1715-17). Inmitten des dekorativen Brillantfeuerwerks stößt man überall auf rein akademisch studierte Posen und Gruppen (die von hier aus wiederum ihren Weg in die Spätbarockmalerei auch nördlich der Alpen fanden); in der Behandlung von Farbe und Licht lenkt Solimena zurück in die für Neapel traditionellen Bahnen der Ribera-und Lanfranco-Nachfolge: An die Stelle der kühnen Chromatik des späten Giordano (die bei Tiepolo ihre eigentliche Vollendung erfuhr) tritt wieder der Wechsel von leuchtenden, festen Lokalfarben und rötlichbraunen oder grünschwarzen Schattenmassen. Der entscheidende, ja bahnbrechende Schritt ins Settecento vollzieht sich im Bereich der Komposition: Figuren und Architekturen, helle und dunkle Zonen werden schachbrettartig über das Bildfeld verteilt, die Bewegung im Zickzack von Gruppe zu Gruppe geführt — kein zentrales »Motiv« mehr (wie noch bei Giordano), sondern einzig die Füllung der Fläche ist Gegenstand des Entwurfs. — Ferner eine gute Übersicht über die anderen Hauptmeister des neapolitan. Settecento: Francesco de Mura, Sebastiano Conca, Giuseppe Bonito, Corrado Giaquinto, Giacomo del Pò, Gaspare Traversi, Domenico Antonio Vaccaro.
Saal 42bis enthält eine Sammlung von Bildern des 16.-18. Jh. aus dem Besitz des Banco di Napoli. Wir heben hervor: 3 Schlachtenbilder von Salvator Rosa; von Solimena die ganz giordaneske Hagar in der Wüste; 2 düster funkelnde Stilleben Porporas mit Blumen, Morcheln, Reptilien, Insekten und Kröten sowie ein gleichfalls vorzügliches Fischstilleben von Recco; 2 malerisch delikate, grotesk-komische Interieur-Szenen von Traversi; eine Reihe schöner Muras.
In Saal 43 oberitalien. Maler des Settecento: Sebastiano Ricci, Marieschi, Magnasco, Pannini (von diesem sehr feine Ruinenstücke
und Rom-Veduten sowie 2 große historische Reportagen vom Besuch Karls von Bourbon bei Papst Benedikt XIV., 1746).
In Saal 44 eine mondbeschienene Ruinenlandschaft am Meer von dem Neapolitaner Leonardo Coccorante. Die zarte Landschaft mit Erminia unter den Hirten ist vermutl. das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen Solimena und dem Landschaftsspezialisten Michele Pagano. Porträts von Raphael Mengs und Angelika Kauffmann; 2 feine Bildchen von G. M. Crespi.
In Saal 45 sieht der dem Ausgang zustrebende Besucher sich aufgehalten durch die lebensgroßen Bildnisse des spanischen Königspaares, Karls IV. und Marie-Louises von Parma, gemalt in den letzten Jahren des 18. Jh. von Francisco Goya (viell. Repliken oder Kopien nach den Bildern im Schloß zu Madrid). Die Königin, ein Schreckgespenst des sterbenden Absolutismus, erzhäßlich, böse und dabei von unantastbarer Würde, steht einsam und kerzengerade im goldgelben Flitterkleid, mit Juwelen und Troddeln behängt, vor einem dunklen Hintergrund. In Goyas Schilderung paart die Distanz des Beobachters sich mit einer beklemmenden Intimität. Das Fleisch ist wattig verschleiert, wie mit Spinnweben überzogen; der drohend aufgereckte, ganz frontal gerichtete Kopf und die steif angewinkelten Arme bilden ein Dreieck, aus dem die kohlschwarzen Vogelaugen giftig hervorstechen; spitze, den Umriß durchbrechende Einzelformen — der Kopfputz, der Fächer, die Schuhe — vollenden das Charakterbild der Monarchin. — Ihr Gatte Karl, 1748 in Portici geboren, stand als König von Spanien (1788 bis 1808) ganz unter der Fuchtel Marie-Louises und ihres Geliebten und Staatsministers Godoy; von Napoleon zur Abdankung gezwungen, zog er sich später in seine Neapler Heimat zurück, wo er 1819 starb. Goya stellt ihn als Jäger dar, in der privaten Lieblingsrolle aller Bourbonen-Herrscher. Freundlich, unprätentiös und ein wenig bequem steht er da; ein Paar wasserblauer Augen leuchtet aus dem weichlich verschwommenen Gesicht, in dem das sächsische Erbteil der Mutter Maria Amalia sich unverkennbar ausprägt.
Das farbenprächtige Jagdgewand, die große Flinte und der treue Hund verleihen der Figur ihren Halt. Im Hintergrund eine nebelerfüllte Berglandschaft im ersten Frühlicht: wohl die einzige Stunde, zu der dieser König glücklich war; es liegt etwas Versöhnliches darin, wie die dunstige Atmosphäre die Gestalten umgibt und einhüllt.
Das 1. Obergeschoß enthält die historischen Räume des Palastes, mit der sorgfältig restaurierten und ergänzten Ausstattung der 1830er Jahre; darin die Gemälde und Skulpturen des 19. Jh. und die verschiedenen Abteilungen des Kunstgewerbemuseums (insgesamt 55 Säle). Eine Bar gibt es unterwegs nicht; dafür winkt am Ende der Bildergalerie ein Rauchzimmer mit wohlerhaltenen Dekorationen im pompejanischen Geschmack von 1825-30 und reizender Aussicht (Balkon).
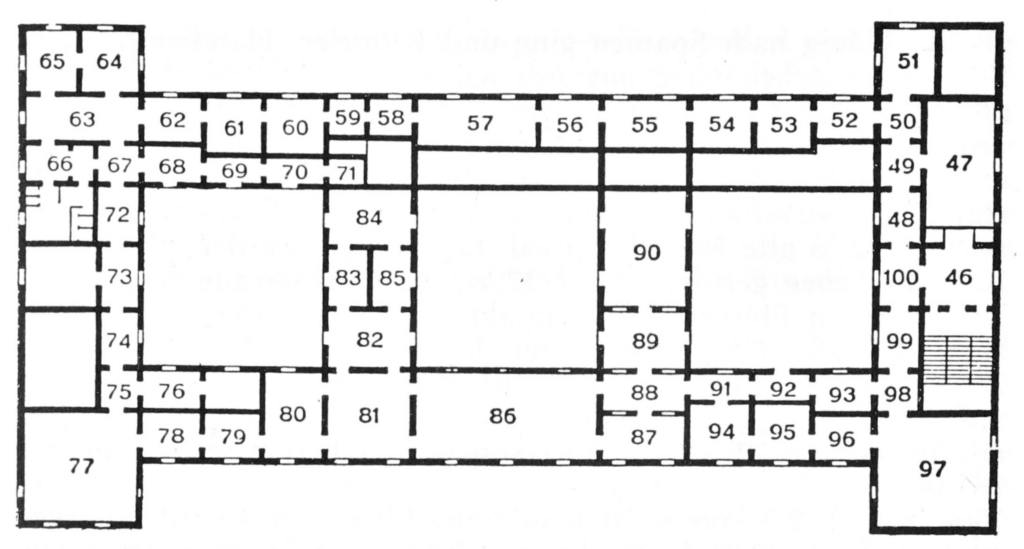 Palazzo Reale di Capodimonte. I. Obergeschoß, Grundriß
Palazzo Reale di Capodimonte. I. Obergeschoß, Grundriß
Der Rundgang beginnt im W-Flügel mit der Galerie des 19. Jh. (Säle 47-65bis). Aus den von Philipp Hackert und Alexandre Dunouy bestimmten Anfängen entwickelte sich in der 1. Jahrhunderthälfte eine einheimische Schule von Landschafts- und Genremalern, die als Scuola di Posillipo eine gewisse Parallele zur »Ecole de Barbizon« bildet und später auch mit dem Pariser Impressionismus in Berührung trat. Der führende Meister war anfangs der Holländer Antonio Sminck Pitloo, nach ihm kamen Giacinto Gigante, die Brüder Palizzi, Domenico Morelli, Antonio und Francesco Mancini, Giuseppe de Nittis, Francesco Paolo Michetti u. a. Ihre unbekümmerte Freude an Farbe und Licht hat die Landschaft des Golfes mit neuen Augen sehen gelehrt, ihr freilich auch jene Aura genommen, mit der Jahrhunderte humanistischer Überlieferung sie umkleidet hatten. So ist der rein malerische Genuß hier erkauft um den Preis des Abschieds von einer der klassischen Paradieslandschaften des alten Europa (während die Franzosen der gleichen Zeit ein neues Glücksversprechen in der Alltagswelt der Moderne entdeckten). — Dazwischen einige charakteristische Werke des neapolitan. Bildhauers Vincenzo Gemito, dessen »Verismo« eine der extremen Positionen der Plastik im späten 19. Jh. bezeichnet.
Raum 66 ist der erwähnte Rauchsalon.
Die Säle 68-71 enthalten eine Auswahl aus der etwa 3000 Stücke umfassenden königlichen Porzellan- und Majolikasammlung (Capodimonte, Neapel, Sévres, Wien, Meißen, Wedgwood); außerdem Gobelins (Neapel 18. Jh.), Porträts u. a. Die neapolitan. Porzellanmanufaktur erhielt ihren Anstoß durch Maria Amalia von Sachsen, die 1738 als Gemahlin Karls von Bourbon in Neapel einzog. 1743 gründete Karl die Fabbrica Reale von Capodimonte; ihre Produktion dauerte bis zum Jahre 1759,
als der König nach Spanien ging und Künstler, Handwerker und Fabrikationsgeheimnisse mit sich nahm. Eine zweite, von Ferdinand IV. errichtete Werkstatt mit vorwiegend klassizist. Tendenz arbeitete von 1771 bis zum Anfang des 19. Jh. zuerst in Portici, dann im Palazzo Reale zu Neapel, und zwar meist in unglasiertem Weichporzellan (»Bisquit«). Auch die Gobelin-Werkstätten von S. Carlo alle Mortelle (Real Tapezzeria) wurden von König Karl ins Leben gerufen, der 1737 einige Künstler aus den damals aufgelassenen Florentiner Manufakturen an sich zog; ihre fruchtbarste Periode fällt in die letzten Jahrzehnte des 18. Jh.
In Saal72 weitere neapolitan. Gobelins, z. T. nach Bildern von Guido Reni und Guercino, sowie ein großer, in Wasserfarben angelegter Grundriß des Parks von Capodimonte, vom Ende des 18. Jh.
Von Saal 73 aus wirft man einen Blick in das hübsche Treppenhaus dieses 1835-38 errichteten Flügels, mit 2 ineinandergesetzten Spindeln (die die verschiedenen Geschosse jeweils getrennt bedienen) über 6eckigem Grundriß.
In den Sälen 74 und 75 wieder Gobelins (Neapel Ende 18. Jh.) und Musikinstrumente.
Der große Ecksaal 77 hat einen herrlichen antiken Fußboden mit geometrischen Mustern aus buntem Marmor aus einer der Tiberius-Villen auf Capri, 1798 in der Villa Favorita in Resina verlegt und dabei in seine elliptische Form gebracht, seit 1877 hier. An den Wänden riesige Landschaftsbilder, darunter 2 Ansichten des Schlosses zu Benrath, von Dunouy nach Horace Vernet.
Saal 78 : Porträts und Historienbilder des frühen 19. Jh.
In Saal 79 das lebensgroße Gipsmodell der Statue der Lätitia Bonaparte, Mutter Napoleons I. (»Madame Mére«), von Antonio Canova (die Marmorausführung beim Herzog von Devonshire in Chatsworth); weitere Bildnisse.
Säle 80 und 81: Fortsetzung der Porträtgalerie, darunter Bilder von Angelika Kauffmann und Elisabeth Vigée-le-Brun; ein phantastischer Gigantensturz in Bisquitporzellan von Fil. Taglioni (Neapel um 1790).
Die Säle 82-85 enthalten die Collezione De Ciccio, eine staunenswert reiche kunstgewerbliche Privatsammlung (ca. 1400 Nummern), 1958 von Mario De Ciccio dem Museum geschenkt.
In Saal 82 und 83 Majoliken, darunter eine einzigartige Gruppe von etwa 40 hispano-arabischen Stücken des 15. und 16. Jh.; syrische, kleinasiatische und persische Arbeiten des 13. bis 16. Jh.; aus Italien Proben fast aller bekannten Werkstätten und Meister, durchweg von vorzüglicher Qualität. — In der Porzellan-Sammlung (83, 84) sind beide Neapler Perioden glänzend repräsentiert, außerdem Meißen, Sévres, Frankenthal, Ginori, Venedig, Wien, Zürich; dazu kommt eine Sammlung riesiger China-Vasen (17. und 18. Jh.). — Unter den Kleinbronzen der italien. Renaissance (83) finden sich zahlreiche große Namen.
Nicht minder interessant die Murano-Gläser und -Leuchter, Elfenbeine, Goldschmiedekunst, Stoffe, Möbel, ferner toskanische Terrakotta-Reliefs des Quattrocento, verschiedene Holz- und Marmorskulpturen, schließlich 2 große Vitrinen mit griech. und röm. Fundstücken: Vasen, Skulpturen, Bronzen, Gläser u. a.
Man geht in Saal 81 zurück und gelangt von dort in den großen Festsaal (86) des Schlosses; er verdankt seine Dekoration einer Gruppe von Künstlern unter Leitung von Antonio Niccolini und Salvatore Giusti (1835-38).
Saal 87 enthält eine Sammlung bedeutender Bronzeskulpturen der italien. Renaissance: die Guido Mazzoni zugeschriebene Büste Ferrantes J. von Aragon oder, nach neuester Vermutung, seines Sohnes Alfons II.; von Giovanni Bologna den bekannten Merkur (eine verkleinerte Wiederholung des Originals von 1564 im Bargello zu Florenz) und Herkules mit dem eurymanthischen Eber; ein unvollendetes Tabernakel des Michelangelo-Schülers Giacomo del Duca (Reliefs mit Passionsszenen); eine Replik von Guglielmo della Portas Marmorbüste Pauls III. (s. o. Saal 19). — In den Vitrinen erstrangige Kleinbronzen von Pollaiuolo (ein Unikum), Roccatagliata, L’Antico, Riccio, Bandinelli u. a. sowie weitere Kostbarkeiten aus der farnesischen Kunstkammer (in Vitrine 1: Helm und Schild des Ottavio Farnese mit Darstellungen des Horatius Cocles und des Mucius Scaevola, Mailand 2. Hälfte 16. Jh.). — An den Wänden 2 herrliche Gobelins: Kreuzabnahme mit Grablegung, Auferstehung und dem ersten Menschenpaar, flämisch Anfang 16. Jh. nach einem Entwurf von Jean Provost; Opfer Alexanders d. Gr., viell. nach Salviati, Florenz Mitte 16. Jh. — Das große Deckenfresko (Glorie Alexanders d. Gr.) von Fedele Fischetti aus dem Palazzo Sangro di Casacalenda wurde 1956 hier angebracht (ebenso die Deckenbilder in Saal 89 und 95; ein Bozzetto im Museo Filangieri, s. S. 298).
Die folgenden Säle 88-90 enthalten eine imponierende Waffensammlung. Die ältesten Stücke finden sich unter den Überresten des farnesischen Arsenals (Saal 90): Prunkharnische der berühmten Mailänder Waffenschmiede des 16. Jh. (signierte Stücke von Pompeio della Cesa) aus dem Besitz der Herzöge von Parma und des Helden der Schlacht von Pavia, Alfonso d’Avalos; italien. Blankwaffen des späten 15. und 16. Jh.; Feuerwaffen des 16. und 17. Jh. (Mailand, Nürnberg, Augsburg). Aus der Bourbonenzeit stammen hauptsächlich Feuerwaffen der von König Karl gegründeten »Fabbrica Reale di Napoli«, ferner kostbare Einzelstücke aus allen großen europäischen Werkstätten.
Zurück in Saal 88 und von dort in Saal 91, mit neapolitan. Gobelins (18. Jh.); die Vitrinen enthalten die Schätze der farnesischen Medaillen- und Münzsammlung (u. a. Pisanello, Matteo dei Pasti, L’Antico, Leone Leoni, Riccio; zahlreiche berühmte Stücke von unschätzbarem Quellenwert für Porträtikonographie und Baugeschichte).
Saal 92, Fortsetzung der Medaillen und (Abteilung X) Plaketten der Renaissance; außerdem mittelalterl. Kunsthandwerk, zum größten Teil aus der 1819 erworbenen Sammlung Borgia zu Velletri (Elfenbein, Emaille, Goldschmiedekunst); der große Alabasteraltar mit Passionsszenen ist eine englische Arbeit vom Anfang des 15. Jh. aus S. Giovanni a Carbonara, wahrscheinl. aus dem Besitz des Königs Ladislaus. Außerdem 2 exquisite deutsche Elfenbeinarbeiten aus der 2. Hälfte des 17. Jh. (ein Krug mit Jagdszenen und ein ovales Tablett mit Bildern aus Ovids »Metamorphosen«).
Saal 93: Weitere Gobelins aus Neapel und neueres Kunsthandwerk. In Vitrine B ein prachtvoller Tafelaufsatz aus vergoldetem Silber (Diana auf einem Hirsch reitend), mit beweglichen Figuren, die von einem Uhrwerk angetrieben wurden, von Jakob Miller aus Augsburg (Anfang 17. Jh.). Ferner 3 Silbergravüren von Annibale Carracci, von denen auch Drucke nach Art von Kupferstichen angefertigt worden sind. Der große runde Präsentierteller mit dem trunkenen Silen (Tazza Farnese — nicht zu verwechseln mit der berühmten antiken Kamee gleichen Namens im Archäologischen Nationalmuseum, Saal 83) wurde um 1598 für den Kardinal Alessandro Farnese gefertigt. Seine graziöse Figurengruppe kehrt wieder auf dem Paniere Farnese, dem Untersatz eines silbernen Brotkorbs, nach einer Zeichnung Carraccis von F. Villamena gestochen. Die 3. Platte, 1598 dat.‚ war für den Kardinal Antonio Maria Salviati bestimmt; Carracci wiederholte hier seine unter dem Namen Cristo di Caprarola bekannte Radierung von 1597.
Von der Hand A. Carraccis stammt auch die elfenbeingerahmte Alabastertafel mit einer Madonna und einer Verkündigung. — Die Vitrinen C und D enthalten islamische Arbeiten, darunter einen einzigartigen arabischen Himmelsglobus von 1225. Weitere Plaketten und geschnittene Kristalle.
Von Saal 91 gelangt man in das Porzellankabinett (94), wohl das umfangreichste und technisch wie künstlerisch perfekteste Exemplar dieser auch in deutschen Schlössern des 18. Jh. vorkommenden Gattung. Es stammt aus dem Palazzo Reale von Portici (1866 hierher überführt, die Stuckdecke erst nach dem 2. Weltkrieg übertragen) und war ein Geschenk Karls von Bourbon an seine Gemahlin Maria Amalia von Sachsen. 1757-59 ausgeführt, bildet es die letzte Arbeit der Manufaktur von Capodimonte; nach der Übersiedlung des Königs nach Spanien schuf die gleiche Werkstatt ein etwas einfacheres Gegenstück in Aranjuez.
Die Porzellanarbeiten stammen von Giuseppe und Stefano Gricc, als Maler werden der Sachse Johann Sigismund Fischer und Luigi Restile genannt. Die Wände enthalten 6 große Spiegel, die übrigen Flächen sind mit glattweißem Porzellan verkleidet, darauf sitzen plastische Dekorationen mit großfigurigen Chinoiserien zwischen geistreichstem Rocaille- und Rankenwerk; der Eindruck ist überaus glanzvoll v. a. dank der lebhaften Farbigkeit. Von der Decke
hängt ein herrlicher Lüster, gleichfalls aus Porzellan; er ging im 2. Weltkrieg durch einen Bombentreffer zu Bruch und wurde aus Tausenden von Splittern wieder zusammengesetzt.
Zu den Gipfelleistungen des Kunsthandwerks der Spätrenaissance zählt der in Saal 95 aufgestellte Cofanetto Farnese (Tafel S. 385). Es handelt sich um ein Kästchen aus vergoldetem Silber, 1548-61 für den »Gran Cardinale« Alessandro Farnese gefertigt und wahrscheinl. zur Aufbewahrung von Büchern und illuminierten Manuskripten bestimmt. Als Goldschmied wird von Vasari der Florentiner Cellini-Schüler Manno di Bastiano Sbarri genannt; die 6 in die Wände eingelassenen geschnittenen Bergkristalle stammen von Giovanni Bernardi. Wie die Architekturformen zeigen auch die Figuren den Stil der Florentiner Michelangelo-Nachfolge (Ammanati). An den Ecken, über schräg vorstoßenden liegenden Sphingen, 4 sitzende Göttergestalten (Mars, Minerva, Diana, Bacchus); obenauf kauert der farnesische Hausheros Herkules, in der Hand die Äpfel der Hesperiden. Die getriebenen und ziselierten Reliefs zeigen auf dem Deckel den kindlichen Herkules als Schlangentöter und den Tod des Helden; an der Innenseite des Deckels erscheint der Raub der Proserpina. Der Boden hat innen ein Relief mit Alexander d. Gr., der aus den Schätzen des überwundenen Darius einen Schrein auswählt, in dem er seine Homer-Handschrift aufbewahren will; an der Unterseite Wappen und Impresen des Kardinals. Die Kristallscheiben, im Stil von der Raffael-Schule (Perin del Vaga) wie auch von antiken Gemmen und Münzen beeinflußt, zeigen Amazonen- und Kentaurenschlacht (vom), Seeschlacht (links), Jagd des Meleager und Triumphzug des Bacchus (Rückseite) sowie Wagenrennen im Zirkus (rechts); darüber griech.-latein. Motti. — An den Wänden des Raumes wieder neapolitan. Gobelins des 18. Jh. (Geschichten aus »Don Quijote«); Deckenfresko von Fischetti (s. o. Saal 87).
Fortsetzung der Teppichserie in Saal 96 (vgl. die beiden gemalten »Modelli« in Saal 99). Der schöne bronzene Cupido in der Mitte des Raumes ist ein charakteristisches Werk des »Antico« (Pier Jacopo Alari Bonacolsi aus Mantua), wohl nach einem antiken Marmorvorbild.
Im Ecksaal 97 weitere Don-Quijote-Gobelins; dazu ein Stück aus der franz. Vorbildserie, von 1730-33. Der große Rundtisch hat ein marmornes röm. Fußbodenmosaik, ergänzt unter Murat und Franz I. von Bourbon.
Saal 99: Ein großes Jagdbild (Ferdinand IV.) von Philipp Hackert, 1784; Sänften aus der Zeit Karls von Bourbon.
Saal 100: 2 Beichtstühle von Matteo Bottiglieri, 1737; eine Marmorgruppe von Giuseppe Sammartino.
Nördlich des Palastes erstreckt sich in einer Tiefe von ca. 1,5 km der Park, mit weiten, schattigen Spazierwegen und herrlichen Ausblicken auf den Vesuv. Nach Passieren des
Eingangstors zwischen den Stallungen (links) und dem Wohnhaus der königlichen Prinzen (rechts) eröffnet sich die überraschende Perspektive von 5 großen Alleen, die sich sternförmig ins Grüne verlieren. Ihre Anlage geht auf einen Plan Ferdinando Sanfelices zurück (1742); den alten Baumbestand (meist Steineichen) ergänzte in den 1830er Jahren der deutsche Botaniker Friedrich Dehnhardt im »englischen Geschmack« (Lichtungen mit Solitären, u. a. prachtvolle Magnolienbäume). Von Sanfelice stammen auch die Gebäude der Königlichen Porzellanmanufaktur und die kleine S.-Gennaro-Kapelle, am Ende der linken Sternallee; weiter nördlich ein um 1800 ausgebautes Jagdhäuschen (Casina della Regina) und ein von Ferdinand IV. (1817) eingerichteter Kapuzinerkonvent.
Umgebung
Hauptsehenswürdigkeiten: Pozzuoli: Serapeion, S. 443; Amphitheater, S. 445 — Baiae: Thermen, S. 454 — Bacoli: Piscina Mirabile, S. 457 — Cumae: Sibyllengrotte, S. 462 — Resina: Villa Campolieto (Vanvitelli), S. 477; Villa Favorite. (Fuga), S. 479 — Herculaneum: Casa Sannitica, S. 489; Casa del Tramezzo di legno, S. 490; Casa dei Cervi, S. 493; Palästra, S. 498; Casa del Bicentenario, S. 500; Haus der Augustalen, S. 503 — Pompei: Forum, S. 518; Forum triangulare, S. 521; Via dell’Abbondanza, S. 523; Stabianer Thermen, S. 524; Haus des Menander, S. 526; Haus der Julia Felix, S. 529; Amphitheater, S. 531; Haus des Fauns, S. 535; Haus des M. Lucretius Fronto, S. 538; Haus der Vettier, S. 542; Mysterienvilla, S. 542; Antiquarium, S. 551 — Castellammare di Stabia: Antiquarium Stabiano, S. 555; Röm. Villen, S. 559 — Sorrent: Villa Pollio, S. 564; Museo Correale, S. 569 — Capri: Villa Jovis, S. 575; S. Costanzo, S. 581; Anacapri: Villa Damecuta, S. 577; S. Michele (D. A. Vaccaro), S. 583 — Caserta: Schloß und Park (Vanvitelli), S. 587.
Seit dem Altertum ist der Golf von Neapel, nach den Worten des griech. Geographen Strabo, »seinem ganzen Umfang nach teils mit Orten, teils mit Villen und Anpflanzungen geschmückt, die zusammen den Anblick einer einzigen Stadt gewähren«. Wir besprechen daher seine Kunstwerke in einer topographischen Abfolge, die mit den nordwestlich gelegenen Phlegräischen Inseln beginnt, der Uferlinie nach S folgt und in Capri endet; das letzte Kapitel behandelt die »Reggia« von Caserta. Das Hauptinteresse gilt hier den Denkmälern der Antike, wie denn überhaupt der Zustand des Landes zur Römerzeit mit seinen Städten und Häfen, Tempeln, Bädern und Küstenvillen uns als ein Wunschbild erscheint, an dem gemessen alle spätere Veränderung notwendig auch eine Verarmung bedeutete. Daß es gerade die landschaftlich ausgezeichneten Punkte des Golfes sind, an denen die Reste des Altertums sich konzentrieren, erklärt sich einmal aus der friedenstiftenden Macht des Imperiums und der dadurch ermöglichten freien Bebauung der Meeresufer; zum anderen aus einer ungebrochenen, dabei höchster Bewußtheit fähigen Sinnlichkeit, die die Alten in ganz anderer Weise als ihre christlichen Nachfahren zum Genuß der Natur instand gesetzt hat. Erst Barock und Klassizismus haben gelegentlich wieder den Kontakt mit der Küstenlandschaft gesucht, freilich kaum je die vom Mittelalter ererbte »Wasserscheu« des neueren Villenbaus überwunden.
In der vielfach zerrissenen, von Feuer und Wasser geprägten Landschaft der nördl. Golfküste tritt Ischia mit dem Monte Epomeo als beherrschende Masse hervor.
Die Entstehung der »Grünen Insel«, scheinbar dem Kratersystem der Phlegräischen Felder zugehörig, vollzog sich in Wahrheit vom Festland unabhängig und bildet ein durchaus selbständiges Kapitel in der Geologie des Golfes. Die erste Vulkanexplosion (im frühen Quartär) war nur der Beginn eines wechselvollen Prozesses, der bis weit in historische Zeit hinein in Gang blieb; das dramatische Ineinandergreifen vulkanischer und tektonischer Kräfte ist von A. Rittmann und P. und G. Buchner erforscht und beschrieben werden. Ihr letzter Zerstörungsakt war das Erdbeben von Casa-
micciola (1883); eine segensreiche Gegengabe die außerordentlich heilkräftigen Thermalquellen, die seit dem Altertum Fremde nach Ischia gelockt haben.
Ein welthistorischer Punkt ist die stille Bucht von S. Montana an der NW-Spitze der Insel: Hier landeten in der 1. Hälfte des 8. Jh. v. Chr. Einwanderer aus Euböa und gründeten die erste griech. Siedlung im Bereich des italischen Festlandes. Sie erklärten sich die unruhige Natur des Ortes durch den Mythos von Typhon (Typhoeus), einem Gewitter-und Erdbebengott, den Zeus nach furchtbarem Kampf besiegte und unter der Insel gefangen hielt. Petrarca, Ariost und die Dichter des Kreises um Vittoria Colonna (s. u.) haben die Sage von »Tifeo« neu belebt; seine aus griech. Vasenbildern bekannte Figur kehrt nicht nur auf den im 16. und 17. Jh. gestochenen Karten von Ischia wieder, sondern hat auch Raffael zu seiner Personifikation des Erdbebens auf dem Wandteppich mit dem gefangenen Paulus angeregt. — Die Bedeutung der griech. und latein. Namen der Insel — Pithekussa, Inarime, Aenaria — hat sich nicht eindeutig klären lassen; mittelalterl. Urkunden sprechen einfach von der »insula maior«, woraus im Dialekt Ischia und später Ischia wurde. Das Hauptsiedlungsgebiet lag bis in die Spätantike an der N-Küste, @. a. in der Bucht von Lacco Ameno. Architektonische Überreste des Altertums haben sich auf Ischia nicht erhalten; doch sind unter den Fundobjekten im Museo dell’lsola (s. u.) Fragmente archaischer Tempeldekorationen in Terrakotta, für deren Herstellung der tonhaltige Boden der Insel besonders günstige Voraussetzungen bot. Ein Tempel des 6. oder 5. Jh. v. Chr. ist auf der Punta S. Pietro östlich der heutigen Hafeneinfahrt nachgewiesen worden.
Zu den Besonderheiten der Insel-Archäologie zählt die Möglichkeit, mit Hilfe historischen Fundmaterials erdgeschichtliche Ereignisse zu datieren. »Unter der Lava des Hafens«, schreibt Paul Buchner, »liegen die Reste eines griechischen Städtchens, das hier um 450 v. Chr. von der Tiefe verschlungen wurde. Die Wurfschlacken einer zweiten Phase der Rotarogruppe haben noch ältere geometrische Scherben eines griechischen Gehöftes begraben. Unter den Lapillimassen, die der Montagnone zu Beginn ausgeworfen, findet sich allerorts die Keramik römischer Kaiserzeit. Der Cafieri-Spaltenerguß, der zwischen Porto d’Ischia und Castiglione vom Meer bis zum Belvedere der Fahrstraße emporquoll, hat dabei den eisenzeitlichen Strand eine Strecke weit gehoben und so die an ihm liegenden Scherben vor dem Vergehen bewahrt. Den Lavastrom, der oberhalb der Häuser von Castiglione dem Berg entquoll, können wir auf solche Weise der Zeit Diokletians zuweisen, während der größte derartige Erguß der Insel, der Zara-Strom, sich zum namenlosen Entsetzen der damals auf dem Monte di Vico blühenden Griechenstadt um 400 v. Chr. wie ein Gebirge weit ins Meer hinauswälzte.« Nach dem diokletianischen Ausbruch kam Ischia für etwa
1000 Jahre zur Ruhe; 1301 erfolgte der große Lavaerguß von Fiaiano hinab Zur O-Küste (Lava d’Arso), unter dessen Schuttmassen mittelalterl. Keramik und Silbermünzen Karls II. von Anjou gefunden wurden. Zu jener Zeit war das städtische Leben der Insel auf das »Castrum Gironis«, die Burg von Ischia Ponte beschränkt, wo seit dem 11. Jh. der Sitz der Grafen von Ischia wie auch der des Bischofs bezeugt sind. Im 12.-15. Jh. stand der strategisch wichtige Punkt im Zentrum heftiger Kämpfe zwischen Sarazenen, Normannen und Pisanern, Staufern, Angiovinen und Aragonesen. Um die Wende des 15. Jh. verteidigte Innico d’Avalos, Markgraf von Vasto und Pescara, als Statthalter Ferdinands II. von Aragon das Kastell erfolgreich gegen die Franzosen; seine Nachkommen blieben bis 1729 Lehnsherren der Insel. Ferrante d’Avalos, der später in der Schlacht bei Pavia fiel, vermählte sich 1509 mit Vittoria Colonna, die den größten Teil ihres Lebens auf dem Kastell von Ischia verbrachte und hier einen Kreis bedeutender Dichter und Humanisten um sich versammelte; zu ihnen zählten Paolo Giovio, Bernardo Tasso, Galeazzo di Tarsia, Bernardino Kota, aber auch Innicos glänzend begabte Schwester Costanza und Maria von Aragon, die Gemahlin des Feldherrn Alfonso d’Avalos.
Nachdem unter der Herrschaft der spanischen Vizekönige die Verhältnisse im Golf sich einigermaßen stabilisiert hatten, begann die Insel sich wieder Zu bevölkern, und es entstand der Kranz der Küstenstädte Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio. Allerdings blieben die türkischen Seeräuber bis zum Ende des 18. Jh. eine ständige Gefahr, gegen die man sich durch ein System von Wacht-und Verteidigungstürmen nur unvollkommen zu schätzen vermochte. Im 19. Jh. gewannen die Heilquellen, von dem Arzt Giulio Jasolino schon im 16. Jh. neu entdeckt und in einem gelehrten Werk beschrieben, europäischen Ruf. Die Liste der Badegäste, die zu kürzerem oder längerem Aufenthalt auf die Insel kamen, zeigt Ischia als unerwarteten Hintergrund manchen Kapitels der neueren Geistes-und Literaturgeschichte. Die großartigste Schilderung einer Reise nach Ischia freilich steht im 4. Buch des »Titan« von Jean Paul, der die Insel nie betreten hat.
Wir besprechen die Orte im Sinne des klassischen »Giro dell’lsola«‚ der von der Hauptstadt Ischia westlich bis nach Forio führt. Die Dörfer an der S-Küste haben keine nennenswerten Kunstdenkmäler.
Den Anfang macht das Kastell, ein der O-Küste vorgelagerter, 100 m hoher Trachytkegel, dessen steil aus dem Meer aufsteigende Wände im Mittelalter den besten Schutz vor sarazenischen Überfällen versprachen.
Die historische Überlieferung des Ortes reicht bis ins 11. Jh. zurück, doch stammen die ältesten architektonischen Überreste erst aus dem 14., die jüngsten aus dem 18. Jh. Nachdem eine Beschießung durch die englische Flotte 1809 den größten Teil der Gebäude in Trümmer gelegt hatte, wurde der Burgberg von seinen Bewohnern verlassen; seitdem bietet er ein Bild trostloser Verwahrlosung.
Der Brückendamm und der durch den Felsen gebohrte Aufgang stammen aus der Zeit Alfons’ I. von Aragon, der das Kastell 1438 eroberte, ausbaute und 4 Jahre später seiner Favoritin Lucrezia d’Alagno zum Geschenk machte. — Vom oberen Ende des Tunnels gelangt man zur Ruine der Kathedrale, einer 3schiffigen Basilika, 1301 gegr. und im 18. Jh. umgestaltet, 1809 teilweise eingestürzt; berühmt als Schauplatz der 1509 vollzogenen Trauung Ferrantes d’Avalos mit Vittoria Colonna. Die älteste Kirchenanlage scheint sich in der Krypta erhalten zu haben; sie hat spitzbogige Kreuzgratgewölbe und aus dem Tuff gehauene Kapellennischen mit ganz verdorbenen Freskenresten (die ältesten aus der Mitte des 14. Jh.).
Im weiteren Aufstieg passiert man rechts den Torbau des ehem. Basilianerkonvents, mit großer Spitzbogenarkade. — Linker Hand erscheint die Chiesa dell’Immacolata, deren Kuppel sich in der Silhouette des Berges von fern her abzeichnet. Sie gehörte zu einem 1575 gegründeten, 1810 verlassenen Klarissenkloster. Der jetzt ganz verfallene Bau stammt von 1715: eine große Zentralkuppelkirche mit 4 Kreuzarmen und. oktogonal ausgeweitetem Mittelraum, der Eingangsarm in 2 Geschosse unterteilt (Nonnenchor); flache Kompositpilaster und Stuckrahmenwerk bilden die Dekoration.
Der weiter rechts aufsteigende Weg führt durch verwilderte Gärten mit mannshohem Beifuß, Kapern und wildem Fenchel zu der Kapellenruine von S. Pietro a Pantaniello, einem bemerkenswerten Bau des frühen 16. Jh. Den Grundriß bildet ein regelmäßiges Sechseck; zwischen den Eckpfeilern öffnen sich rundbogige Arkaden, die aber nach Ausweis des Mauerbefundes urspr. geschlossen waren und im Inneren flache Nischen bildeten; gegenüber dem Eingang Reste eines Altars. In die Flachkuppel greifen 6 halbrunde Lünetten ein. Der Mauerkern besteht aus rohem Bruchsteinwerk; die teilweise erhaltene Peperinverkleidung zeigt außen dorische Pilasterbündel mit verkröpftem Gebälk, innen geknickte Pilaster auf hohen Piedestalen.
Auf der Kuppe des Berges liegt der Maschio, der von 4 großen Rundtürmen eingefaßte Burgpalast, errichtet vor 1441 von Alfons I., 1809 schwer beschädigt, heute unzugänglich. Von der Dachterrasse der östlich angrenzenden Nebengebäude (im 19. Jh. als politisches Gefängnis benutzt) genießt man einen umfassenden Rundblick über den Golf.
Auf dem »Festland« der Insel, gegenüber dem Kastell, bildete sich etwa im 16. Jh. der Borgo del Celso, heute nach dem Brückendamm Ischia Ponte genannt.
Das Wachstum des Ortes läßt sich an der Baugeschichte des Aquädukts ablesen, der 1590 begonnen und 1673 weiter ausgebaut wurde; aus dieser Zeit stammen die Pfeilerarkaden (»I pilastri«) an der Strada Provinciale bei S. Antuono.
Kathedrale
Die Kirche soll im 14. Jh. von der Familie Cossa gestiftet werden sein. Sie war urspr. der Madonna della Scala geweiht; 1809 wurde mit dem Bischofssitz auch der Assunta-Titel vom Kastell hierher übertragen.
Der heute stehende Bau, dessen Kuppel und quadratischer Campanile die malerische Seeseite des Städtchens beherrschen, zeigt überall die Formen des 18. Jh., doch könnte der Grundriß auf eine got. Pfeiler). Im Querschiff links neben dem Presbyterium ein bedeutendes Holzkruzifix aus der 2. Hälfte des 13. Jh. Schräg gegenüber (Vicoletto della Terrasanta) die Pfarrkirche Spirito Santo, im 15. oder 16. Jh. erb. und im 18. teilweise erneuert, ein schöner tonnengewölbter Saalraum mit flacher Vierungskuppel. Rechts der Campanile mit noch quattrocenteskem Unterbau, links über einer hohen Freitreppe die Bruderschaftskirche von S. Maria di Costantinopoli (erb. 1613).
Im Palazzo Arcivescovile (Via del Seminario), erb. 1738-41, innen ganz modernisiert, befindet sich ein frühchristl. Sarkophag (1. Stock, Vorzimmer des Bischofs), wohl vom Ende des 4. Jh., mit Darstellungen aus den Evangelien: links die Heilung zweier Blinder und des blutflüssigen Weibes, im Zentrum die Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda (Ankunft Christi und zweier Apostel,
darunter der liegende Kranke, oben Christus und der Geheilte, der sein Bett davonträgt), rechts das Gespräch Christi mit dem Zöllner Zachäus, der im Geäst der Sykomore sitzt, und Einzug in Jerusalem. Andere Exemplare dieses Typus (»Bethesda-Gruppe«) finden sich im Lateran, in Tarragona und in Südfrankreich.
Südl. des Ortes, auf dem Wege zum Strand von Cartaromana, steht die Torre S. Anna (auch Torre di Bovino), ein quadratischer Wohnturm, wahrscheinl. um 1500 von den Conti di Guevara errichtet; das Innere des heute verwüsteten Gebäudes enthielt Freskodekorationen des 16. Jh. Oberhalb des nach N sich erstreckenden Fischerstrandes (Spiaggia dei Pescatori) liegt das kleine Franziskanerkloster S. Antonio. Die 1740 erbaute Kirche hat eine von korinthischen Kolossalpilastern gerahmte Vorhallenfassade mit doppelarmiger Treppe; rechts daneben ein hübscher Campanile; das Innere 1schiffig mit einem Paar zentral angeordneter Seitenkapellen, Querschiff und Vierungskuppel (Hängekuppel mit Diagonalgurten und großer Laterne — vgl. Astaritas S. Raffaele in Neapel).
Durch den um die Mitte des 19. Jh. angepflanzten Pinienhain der Lava d’Arso führen 2 Parallelstraßen nach Ischia Porto, dem neuen Zentrum der Insel.
Das runde, von freundlichen klassizist. Häusern umstandene Hafenbecken, für den von See Kommenden der Archetypus eines sicheren Ports, war einstmals ein Kratersee; erst 1853 ordnete Ferdinand II. den Durchstich an, um der Bäderinsel einen Hafen zu geben. Auch das Inselchen im Zentrum des Beckens bestand schon im Altertum; in einem Brief an Marc Aurel vergleicht Fronto den Kaiser mit der Insel Aenaria, die an ihren Küsten die Wogen des Ozeans bricht und die Angriffe feindlicher Flotten, Piraten, Meerungeheuer und Stürme abweist, um eine zweite, in ihrem Inneren gelegene Insel zu schützen.
Auf der Punta S. Pietro, östl. der Hafeneinfahrt, liegt weithin sichtbar der ochsenblutrote, von einer weißen Flachkuppel gekrönte Würfelbau des Sommerhauses der Zoologischen Station (s. S. 366), errichtet 1905/06 von dem Münchner Architekten Carlo Sattler.
Die Kirche am Hafenkai (Piazza del Redentore), mit hübscher ionischer Säulenvorhalle, heißt S. Maria di Portosalvo und wurde 1854 von Ferdinand II. gestiftet; das Innere ist eine geräumige, 3schiffige Pfeilerbasilika mit Querschiff und kassettierten Flachkuppeln über den Seitenschiffsjochen und der Vierung.
S. Pietro (auch Chiesa del Purgatorio; Via Roma)
Von einem unbekannten Architekten des 18. Jh. (inschriftlich dat. 1781), viell. aus dem Kreis F. Fugas.
Der Grundriß der an der Hauptstraße stehenden Kirche zeigt ein gestrecktes Oval mit 2 Nebenkapellen an jeder Längswand; daran schließt sich ein langer Chorarm mit abgeplatteter Rundapsis. Eine korinthische Pilastervorlage
läuft rings um das Innere des Hauptraums. Das Gebälk ist auch an der Chorseite nicht durchbrochen, sondern als frei tragender Architrav über die Öffnung hinweggeführt; die untergezogenen Volutenkonsolen übernehmen zugleich die Vermittlung zu dem tiefersitzenden Gebälk des Chorarms. Die Kuppelwölbung beginnt direkt über dem Hauptgesims und wird von 6 Fensterstichkappen angeschnitten. Für die Kompositionsprobleme des Ovalraums mit gerader Kapellenzahl (unbetonter Querachse — vgl. Nauclerios S. Maria di Caravaggio in Neapel) hat unser Architekt eine Lösung von klassischer Klarheit gefunden: Die Pilasterabstände verändern sich nach dem Prinzip der geometrischen Reihe, d. h. die Intervalle in Quer- und Längsachse verhalten sich wie 1 : 2, die dazwischenliegenden Abschnitte, welche die Nebenkapellen umfassen, entsprechen dem geometrischen Mittelwert. Rückliegende Halbpilaster am Anfang und Ende jeder Längswand dienen dem Ausgleich der Abstände; von besonderer Delikatesse ist die Weiterführung des Systems im Stuckdekor der Kuppel.
Auch am Außenbau ist die ovale Grundform des Inneren kenntlich gemacht. Zwischen schräg zurückgenommenen Flanken wölbt sich das Mittelstück der Fassade vor; ihr Aufbau folgt dem basilikalen Schema; die reiche aber straff disziplinierte Gliederung zeigt 2 Pilasterordnungen, verkröpfte Gebälke, Rücklagen und Rahmenwerk. Das Obergeschoß steht als Blende vor dem massiv ummauerten Kuppelfuß; an den Langseiten des Baues erscheinen geschweifte Strebebögen, darüber liegt schildkrötenartig flach die Kuppelschale, deren grün-gelbe Majolikaschuppen über den Häusern des Strandes einen weithin leuchtenden Farbfleck bilden.
In einem Seitengebäude mit Zentralkuppel auf 4 Pfeilern (ehem. Beinhaus) befindet sich das 1947 gegründete Museo dell’Isola, mit reichem geologischem und archäologischem Fundmaterial.
Das Städtchen an der N-Küste der Insel hat während der furchtbaren Erdbeben des 19. Jh. (1828, 1881 und v. a. 1883) seine Kunstdenkmäler eingebüßt.
Von den Städten der Insel blickt Lacco Ameno auf die längste Geschichte zurück. Der Name ist wahrscheinl. vom griech. lakkos (= Grube oder Zisterne) abzuleiten; erst 1863 wurde der Beiname Ameno (lat. locus amoenus = lieblicher Ort) hinzugefügt. Zur Römerzeit hieß der Ort Heraclium. Von der griech. Stadt Pythekussa auf dem nördlich vorgelagerten Monte di Vico sind keine Spuren erhalten, doch hat die von G. Buchner 1952 begonnene Ausgrabung der Nekropole in der Bucht von S. Montana westlich der Stadt wichtige Aufschlüsse gebracht. Die Gräber verteilen sich auf einen Zeitraum von nahezu 1000 Jahren. Von höchstem Interesse sind die ältesten Grabstellen des 8. Jh. v. Chr.; sie zeigen Erd- und Feuerbestattung in den von Homer geschilderten Formen; neben einheimischen Gefäßen fanden sich solche aus Euböa, Korinth, Kreta, Athen, Rhodos, auch aus Apulien und Etrurien. Der bisher kostbarste Fund ist der Nestorbecher, ein geometrisches Gefäß aus Rhodos mit einer wahrscheinl. einheimischen linksläufigen Versinschrift, die zu den ältesten Denkmälern der griech. Schrift überhaupt zählt. — In der röm. Stadt fand sich eine frühe Christengemeinde zum Kult der hl. Restituta zusammen, einer Märtyrerin aus Karthago, die dort zum Flammentod auf einem ins Meer gestoßenen Boot verurteilt worden war. Der Leichnam landete wunderbarerweise i. J. 304 am Strand von S. Montana und wurde in Lacco beigesetzt und verehrt, bis ihn die Neapolitaner an sich brachten (S. 113); am Tage der Landung (17. Mai) spielt sich alljährlich ein lautstarkes Volksfest ab.
Die der Heiligen geweihte Hauptkirche des Ortes, S. Restituta (Piazza S. Restituta), erhielt ihre heutige Gestalt im 19. Jh.; die hübsche Pilasterfassade stammt von 1910. In der 1. Kapelle rechts ein Bild der Madonna del Carmine aus dem späten 16. Jh., toskanisch beeinflußt, rechts daneben die alte Restituta-Kapelle, 1036 gegr., im 14. Jh. umgebaut und 1707 erneuert, voller Reliquiare und Exvoten; in der Nische hinter dem Altar eine vergoldete Holzfigur der Heiligen, mit einem Segelschiffchen in der Hand (16. Jh.).
In einem unter der Kapelle gelegenen Raum entdeckte man 1951 Spuren der Coemeterialkirche des 4. oder 5. Jh., offenbar in einer röm. Zisterne angelegt (zugänglich durch einen Korridor rechts, mit archäologischen Fundstücken).
Madonna delle Grazie (auch SS. Annunziata oder »Chiesa della Marina«; Via Roma)
Die Pfarrkirche ist ein interessanter Bau des 18. Jh. Weder Bauzeit noch Architekt sind überliefert; man findet vergleichbare Formen am ehesten in den Neapler Bauten G. Astaritas. Beim Erdbeben von 1883 wurde die Kirche beschädigt, war seitdem verlassen und wurde erst nach dem 2. Weltkrieg restauriert.
Die kleine Fassade hat über geschwungener Grundlinie 2 Ordnungen im basilikalen Schema, unten Doppelpilaster
und Nischen, oben 2 Paar in Kehlen eingestellte Säulen und lustig geschweifte Volutenohren; die glatten Wandflächen dürften ehemals Stuckornamente getragen haben. — Das Innere zeigt eine überraschend vielfältige Raumfolge mit lebhaften Hell-Dunkel-Kontrasten. Das Schiff ist ein längsgerichteter Saal mit je 3 untereinander verbundenen Nebenkapellen, die nach dem »Triumphbogenschema« rhythmisch geordnet sind. Über schräg in den Raum vorstoßenden Wandpfeilern entwickelt sich ein kompliziertes Muldengewölbe mit Stichkappen. Der kurvig gerahmte Mittelspiegel ist eingespannt zwischen 2 sich überkreuzende Gurtbogenpaare, eine Lösung, die in Neapel kein Gegenstück hat und. von fern an den mainfränkischen Barock erinnert. Sehr geistreich das Wandgliederungssystem mit korinthischen Pilastern und Lisenen mit Pfeifenkapitellen. Es folgen ein Querschiff mit Tambourkuppel und seitlichen Halbrundapsiden, ein Chorjoch mit böhmischer Kappe und endlich das Presbyterium mit einer Pendentifkuppel, in deren Wölbung spitzbogige Fensterkappen eingreifen. Der Verputz ist heute einheitlich weiß und gelb; wahrscheinl. sind Gewölbefresken im Laufe der Zeit zerstört worden. Das Weihwasserbecken am 1. Pfeiler rechts ruht auf einer hier gefundenen röm. Herkules-Herme.
Der Ort liegt an der W-Küste der Insel, dem offenen Meer zugewandt. Die Zufahrtstraße von Lacco Ameno durchquert die Lavamassen des Zaro-Stromes und senkt sich dann in eine weite mit Weinpflanzungen bedeckte Ebene hinab (»il Campo«, heute von häßlichen Neubauten übersät).
An der Strandbucht zur Rechten liegt der Konvent von S. Francesco di Paola (Montevergine), um 1800 erb., mit hübschem klassizist. Campanile; landeinwärts, links oberhalb der Straße, die Villa Calosirto, ein schöner Landsitz vom Anfang des 19. Jh., leider dem Verfall anheimgegeben.
Ein flaches Vorgebirge, das die Ebene nach S abschließt, trägt den Ort. Der Charakter des Stadtbildes, wie es sich von See oder von der Mole des versandeten Hafens aus darbietet, wird zu Recht oder Unrecht in dem Wort »orientalisch« zusammengefaßt; jedenfalls hat der Anblick der weißen Häusermasse zu Füßen des Epomeo, überragt
von Türmen, buntfarbenen Kuppeln und Palmenwedeln, in Italien kaum seinesgleichen. Die Umgebung ist zwar durch den Bau-Boom der letzten Jahre erbärmlich verunstaltet worden; doch bietet das Innere des Städtchens mit seinen weitläufig verzweigten Gassen und Wegen noch reizvolle Beispiele für die lokale Variante des »Inselstils« (s. S. 585). Viele Häuser sind durch schräg anlaufende Strebepfeiler und -bögen gegen Erdstöße abgesichert. Das charakteristische Baumaterial ist der graugrüne, bröckelig verwitternde Epomeo-Tuff; er kommt an den Hängen des Berges auch in großen isolierten Klippen und Blöcken vor, die zu regelrechten, mit Türen und Fenstern versehenen Höhlenwohnungen ausgebaut sind. ( Tafel S. 448.)
Forios Wahrzeichen ist der Torrione, ein kolossaler runder Wachtturm mit ausgebrochenem Zinnenkranz, der aus den Häusern des alten Zentrums hervorwächst; 1480 erb., bildet er den Mittelpunkt eines Systems von insgesamt 12 Türmen (die älteren sind rund, die neueren quadratisch), welche die Verteidigung des von keiner Mauer geschützten Städtchens gegen die türkischen und sarazenischen Seeräuber übernehmen mußten.
Von den zahlreichen Kirchen und Kapellen nennen wir die wichtigsten: S. Antonio Abate in der gleichnamigen Straße südlich Piazza Matteotti ist ein schön proportionierter Kreuzkuppelbau des frühen 19. Jh. — S. Gaetano, oberhalb der Marina, im 17. Jh. gegründet, 1857 restauriert, ragt hervor durch seine orangefarbene, laternenlose Spitzkuppel; das Schiff zeigt außen die für Forio charakteristischen schrägen Strebepfeiler; im Inneren (Saal mit Querschiff und Vierungskuppel) hübscher Stuckdekor.
Madonna di Loreto (Corso Umberto)
Die Hauptkirche des Ortes wurde im 14. Jh. von Fischern aus Ancona gegründet, wohl schon im 16. Jh. umgebaut und 1780-85 neu dekoriert.
Das Äußere ist merkwürdig durch seine 2-Turm-Fassade (19. Jh.). Innen eine flachgedeckte 3schiffige Pfeilerbasilika mit Vierungskuppel und polygonaler Apsis, in ihren Grundlinien viell. noch mit dem Trecento-Bau identisch. Über dem Chorjoch der Ansatz einer zweiten Tambourkuppel (unausgeführt). Die Dekoration in Stuck und Marmor ist die reichste der Insel; bes. schön das Apsisgewölbe und die Marmorintarsien des Hochaltars. In der Apsis rechts die holzgeschnitzte »Madonna delle Splendore«, wohl 16. Jh., der Kopf erneuert. Das Hochaltarbild (Madonna di Loreto) ist 1560 datiert und zeigt starke Ähnlichkeit mit: der Madonna del Carmine von S. Restituta in Lacco. Von dem Forianer Maler Cesare Calise (Anfang 17. Jh.) stammen das Deckenbild des Langhauses (Assunta) und der S. Nicola da Tolentino am 2. Altar links. — Rechts neben dem
Langhaus das Oratorio dell’Assunta, ein langer Saalraum mit tiefgezogener Tonnenwölbung, wohl im 16. Jh. erbaut, ebenfalls mit prächtiger Stuckdekoration des Settecento.
S. Maria del Soccorso, im 16. Jh. gegr., liegt auf einer Terrasse über dem Meer an der W-Spitze der Stadt. Eine rohe moderne Restaurierung hat dem Platz seinen Zauber genommen. Die Freitreppe — bescheidene Nachahmung von Sanfelices großer Treppenanlage vor S. Giovanni a Carbonara in Neapel — hat eine bunte Majolikadekoration (Kreuzwegstationen, arme Seelen im Fegefeuer). Das weiß verputzte Kirchlein zeigt die Formen des »Inselstils« in der gedrückten Tonnenwölbung des Schiffes, der kreuzgratgewölbten Vierung und einem überkuppelten, außen quadratisch ummantelten Presbyterium; die seitlich angesetzten Kapellen haben links noch ein großes quadratisches Kreuzgewölbe, rechts längsovale Kuppelchen. Den durch die Tonnenwölbung bestimmten Fassadenaufriß beleben ein paar Settecento-Schnörkel; das Eingangsportal gehört noch dem 16. Jh. an. Innen hübsche Heiligenfiguren und Votivschiffchen.
S. Maria Visita Poveri (rechts neben der Franziskanerkirche an der Piazza del Municipio) scheint im 17. Jh. erbaut (1647 zuerst erwähnt), im 18. Jh. verändert worden zu sein. Dem 1schiffigen Kirchenbau ist ein offenes Atrium vorgelagert. Die innere Fassade, aus der 1. Bauepoche, trägt einen von Zierobelisken flankierten Glockenstuhl mit 3 offenen Bögen; Voluten und Giebel — ein Motiv, das in anderen Forianer Fassaden mehrfach variiert wird (S. Gaetano, S. Michele del Purgatorio an der Straße Forio — Lacco, u. a.).
S. Michele (an der Piazza Cerriglio am östl. Ortseingang) ist ein einfacher Ovalbau mit rhythmisch verteilten Kompositpilastern, nach der Überlieferung 1748 errichtet, 1910 restaur., gute Altarbilder des 18. Jh.
S. Vito (am oberen Abschnitt der Via Roma, Ortsausgang nach Citara)
Die Kirche wird mit einer Gründungsnachricht aus dem 14. Jh. in Verbindung gebracht, im 17. Jh. als Pfarrkirche erwähnt. Der heutige Bau stammt von 1745/46 und wurde im 19. Jh. restauriert.
Breit gelagerte Doppelturmfassade. Das Innere eine geräumige Pfeilerbasilika mit Kuppeln über Seitenschiffen, Querschiff und Presbyterium (queroval); die Vierungskuppel herausgehoben durch steileres Profil und 4 in die Wölbung eingeschnittene Fenster (außen Scheintambour). Elegante Stuckdekoration in Weiß und Türkis. Bilder von Cesare Calise (1. Altar rechts und im linken Seitenschiff, über einer Tür) und Alfonso Spinga (Hochaltar); in der Sakristei eine Silberstatue (S. Vito) von Del Giudice nach einem Modell Sammartinos (1787).
Von Bürgerpalästen des 16.-18. Jh. haben sich v. a. im Viertel rings um den Torrione beachtliche Überreste erhalten. Zu den lokalen Spezialitäten zählen die Terrassen und Balkons über konsolengestützten Flachbögen, Freitreppen, Rundbogenportale und v. a. die souveräne Verachtung aller abendländischen Symmetriegesetze; das skurrilste Beispiel
bietet das große Treppenhaus des Palazzo Covatta (frühes 18. Jh.) in einer Biegung des Vico Torrione (von der Piazza Matteotti zum Strand).
Die Nachbarinsel Procida mit dem westlich vorgelagerten Anhängsel Vivara besteht aus den Resten von 4 halb ins Meer versunkenen Kratern. Den Rücken der Insel bildet eine flache, mit Fruchtgärten bepflanzte und dicht besiedelte Tafel; an der NO-Spitze hat sich eine steile Tuffmasse aufgetürmt, die den mittelalterl. Stadtkern trägt.
Reste einer bronzezeitlichen Kultur sind auf Vivara gefunden worden; die Griechen gaben dem Eiland seinen heutigen Namen (Prochyte, Procita), haben aber keinerlei monumentale Spuren hinterlassen. Die weitere Geschichte der Insel geht der von Ischia parallel. Die Rolle des Kastells spielte hier die von Giovanni da Procida, dem Helden der »Sizilianischen Vesper«‚ im 13. Jh. errichtete »Terra Murata« auf dem NO-Hügel.
Der erste Exodus der Bewohner führte zur Gründung der Fischersiedlung in der nach S geöffneten Strandbucht von Corricella. Von den Schiffahrtslinien unberührt, bietet sie heute noch das Bild einer neapolitan. Marina im Urzustand; kubische Häuser, Terrassen und Treppchen sind mit dem porösen, von Höhlen und Grotten zerfressenen Tuff zu einer phantastischen Höhlenstadt zusammengewachsen.
Der Haupthafen Marina Grande oder Marina di S. Cattolico liegt an der N-Küste. Der Ort ist etwa im 17. Jh. entstanden; die lange, geschlossene Häuserzeile am Kai mit ihren flachbogigen Loggien und gelb-rosa verputzten Wänden gehört zu den lieblichsten Bildern des »Inselstils«.
Schöne Fischerhäuser finden sich auch an der Chiaiolella, einer schmalen Bucht am südwestl. Ende der Insel.
An der Marina Grande steht die kleine Kuppelkirche der Madonna della Pietà, 1616 gegr. und 1760 in ihre heutige Form gebracht (die alte Kapelle dient als Sakristei), mit hübscher farbiger Stuckdekoration. — S. Maria delle Grazie liegt an der Piazza dei Martiri auf dem Rücken der Insel, oberhalb der Corricella; erb. in der 2. Hälfte des 18. Jh. anstelle einer schon im 16. Jh. nachweisbaren Kapelle. Kreuzkuppelkirche mit Halbrundapsis anstelle des Chorarms, von niedrigen, breiten Verhältnissen (gedrückte Bögen), aber mit hohem Kuppeltambour, der 8 große geschweifte Fenster enthält.
Über die Via Castello erreicht man von hier aus die Terra Murata, heute großenteils von den Bewohnern verlassen und in einem gespenstischen Zustand des Zerfalls. Der seit 1563 erbaute Baronalpalast dient als Zuchthaus. Die Hauptkirche der Insel ist S. Michele, anstelle eines seit dem 13. Jh. bezeugten kleineren Vorgängerbaus als 3schiffige Pfeilerbasilika mit Kuppel gegen Ende des 17. Jh. errichtet. In der Apsis 4 schöne Michaels-Szenen von dem Giordano-Schüler Nicola Russo, 1699; links das Eingreifen des Erzengels in eine Seeschlacht gegen sarazenische Pira-
ten, mit einer interessanten Vedute von Procida und Ischia. Das Deckenbild (der hl. Michael bekämpft Luzifer) gilt als Werk Luca Giordanos.
Auf der nach Süden vorspringenden Punta dei Monaci die Ruinen der verlassenen Benediktinerkirche S. Margherita Nuova und des dazugehörigen Konvents.
Die Stadt Pozzuoli liegt im Zentrum einer nach S geöffneten Bucht zwischen den Vorgebirgen von Posillipo und Miseno.
Griech. Siedler aus Samos, auf der Flucht vor der Tyrannei des Polykrates, gründeten 529/528 v. Chr. die Stadt und gaben ihr den programmatischen Namen Dikaiarcheia (etwa: das wahre Recht). Gemeinsam mit dem mächtigen Kyme (Cumae) verteidigten sie den Golf gegen die eindringenden Etrusker und die Samniten, denen die Stadt 421 erlag. Seit 338 (Seesieg von Antium) setzten sich die Römer in Kampanien fest; 194 gründeten sie hier eine Kolonie »und gaben ihr den neuen Namen Puteoli, von den Brunnen (putealia) oder, wie andere sagen, nach dem üblen Geruch (putor) des Wassers; denn die ganze dortige Gegend ist voll von Schwefel, Feuer und warmen Quellen« (Strabo). Während die benachbarte Neapolis den Samniten widerstanden und auch unter röm. Oberhoheit Charakter und Institutionen der griech. Polis bewahrt hatte, wurde Puteoli die wichtigste Römerstadt am Golf, ihr Hafen — »litora mundi hospita« (Statius) — der Hauptumschlagplatz des Osthandels und damit zugleich das Einfallstor orientalischer Kulte und Religionen. So traf der Apostel Paulus, als er 61 n. Chr. in Pozzuoli landete (Apg. 28, 13-15), hier bereits auf eine organisierte Christengemeinde. Die Kaiser des 1. Jh. schmückten die Stadt mit prächtigen Architekturen, legten jedoch zugleich den Keim ihrer Dekadenz durch den Ausbau des Hafens von Ostia (42 von Claudius begonnen, 100-106 von Trajan erweitert), der in der Folgezeit den Osthandel an sich zog. Die Plünderungen durch Alarich (410), Geiserich (455) und Totila (545) vollendeten den Ruin der Stadt; sie hat seitdem keine bedeutende Rolle mehr gespielt.
Die mittelalterl. Siedlung beschränkte sich auf den ins Meer vorspringenden niedrigen Tuffhügel, der ehedem die Akropolis der Dikaiarcheia trug. Die malerischen Aspekte ihrer Gassen und Winkel würdigt man am besten aus der Ferne; nur erfahrene Liebhaber des Südens werden zu genießen imstande sein, was der Schauspieler Peppino De Filippo
Pozzuoli und Umgebung
- zur Feier einer hier geborenen Kollegin — besungen hat: »Pozzuoli ... mit seinen Gerüchen von Schwefel und Würzkräutern, Minze, Basilikum, Rosmarin, seinen alten und ruhmvollen Mauern, seinen niedrigen Häusern, rosa, weiß und himmelblau, die Balkons geschmückt mit Tomaten, Melonen, Vogelbeeren, überquellend von Nelken, Geranien und jungen Mispeln ... die kurzen und engen Gassen, gepflastert mit der heißen Lava des Vesuvs, schwarz im Regen, grau unter der Sonne; die Marktstände mit ihren Fischen, fleischigen Gemüsen, die Fässer voll Vesuv-Wein und die unzähligen Pizzerien und Trattorien, aus denen die scharfen und appetitlichen Düfte der "fritti misti" aufsteigen.«
Duomo di S. Proculo
Der Dom liegt allseitig eingebaut inmitten der Altstadt; man erreicht den Haupteingang an der SO-Flanke des Baues durch eine südl. Nebengasse der Via del Duomo.
Im 11. Jh. in der Ruine eines Augustus-Tempels gegründet, wurde der Bau 1634 durchgreifend erneuert; 1964 brannte er aus und ist seitdem in Restaurierung. Die dabei eingeleiteten Grabungen haben, wie angesichts der Lage des Platzes zu erwarten war, auf Spuren früher Tempelbauten geführt; man fand ein Podium aus der Samnitenzeit (3./2. Jh. 7). Chr.), darunter Teile eines noch älteren Fundaments, viell. aus dem 5. Jh.
Aus der bröckeligen, mit Resten von Settecento-Stuck bedeckten Außenwand wachsen 6 große korinthische Tempelsäulen hervor; der Fries trägt die Stifterinschrift eines Lucius Calpurnius. Eine weitere Inschrift über dem Eingangsportal bewahrt den Namen des röm. Architekten L. Cocceius, den wir sonst v. a. als Tiefbauingenieur im Dienste der Agrippa kennenlernen (vgl. S. 451, 463, 465).
Das 1schiffige Innere, derzeit unzugänglich, enthielt bis zum Brand Werke von Lanfranco, A. Gentileschi, C. Fracanzano, Stanzione, G. Diano; außerdem das Grabmal des Komponisten G. B. Pergolesi, der 1736 im Alter von 26 Jahren in Pozzuoli starb.
Ein hübscher Spätbarockbau (1745) ist S. Raffaele am Anfang der Via Rosini, jenseits der Bahnunterführung, von Friedrich Rückert in einem Gedicht besungen (»Die Kirche zu Pozzuoli«, 1818). Reiche 2geschossige Fassade über geschwungenem Grundriß. Das Innere ein runder Zentralkuppelraum mit hübschen bunten Marmordekorationen und 2 Bildern von dem aus Pozzuoli gebürtigen Giacinto Diana.
Das Hauptinteresse beanspruchen die röm. Monumente der Stadt. Am Ufer nördl. des Hafens liegt das sog. Serapeion, in Wahrheit eine öffentliche Marktanlage
(Macellum). Den Kern bildete ein quadratischer, von Säulenportiken umgebener Hof. In seiner Mitte erhob sich ein Brunnenhaus in Form eines kreisrunden Podiums mit 16 Säulen aus »giallo antico« (heute im Schloßtheater von Caserta), die ein ringförmiges Gebälk trugen; zwischen ihnen standen Statuen, im Zentrum eine Fontäne. Hinter den Portiken zogen sich Ladenräume entlang, abwechselnd nach außen und innen geöffnet; darüber lag noch ein Obergeschoß. Als Haupteingang fungierte die offene Säulenstellung an der Seeseite.
Der gegenüberliegende Hofportikus ist in seinem Zentrum durch 4 gewaltige Cipollino-Säulen unterbrochen (eine liegt umgestürzt am Boden); dahinter öffnet sich eine Cella mit ausspringender Rundapsis. Hier fand man 1750 eine Statue des Serapis, einer ägyptischen Gottheit, welcher der Schutz dieses Marktes anvertraut war. Die beiden Eckräume der Apsisseite enthalten die größten und bestausgestatteten Latrinen, die aus dem Altertum auf uns gekommen sind.
Die Gründung des Baues wird in die flavische Zeit datiert; einem antoninischen oder severischen Umbau entstammen das Brunnenhaus und die Kolossalsäulenstellung mitsamt der dahinterliegenden Cella, welche die urspr. eher zentralisierende Anlage zum Richtungsbau umdeutete. — Ihre späteren Schicksale sind durch die eigentümliche Geologie des Ortes bestimmt. Hier ist o. a. der Bradyseismos (»langsames Erdbeben«) zu nennen, d. h. das an vulkanischen Küsten auftretende allmähliche Auf-und Absteigen des Erdbodens. Eine starke Abwärtsbewegung scheint an dieser Stelle während des 1. Jahrtausends eingesetzt zu haben; übrigens war der Bau damals auch von mehreren Schichten vulkanischer Asche bedeckt, die insgesamt eine Höhe von ca. 3,60 m erreichten. Der Tiefpunkt der Senkung dürfte etwa um die Wende des 13. Jh. eingetreten sein; damals war das Meer so weit eingedrungen, daß der Boden des Hofes ca. 5,70 m unter dem Wasserspiegel lag. Als Beweis für diese erstaunlichen Vorgänge gelten die Spuren von Bohrmuscheln (Lithodomus lithophagus), die sich in 3,60-5,70 m Höhe an den 3 großen Cipollino-Säulen finden. Im 16.-18. Jh. folgte eine Phase des Aufstiegs, die schließlich zur völligen Trockenlegung des Baues führte und seine 1750 begonnene Ausgrabung und Aufnahme ermöglichte. Zu Beginn des 19. Jh. machten sich die Symptome einer erneuten Absenkung bemerkbar, die bis heute anhält (derzeitiges Niveau des Fußbodens ca. 2,50 m unter dem Meeresspiegel). Mit dem eindringenden Meerwasser mischt sich das aus dem Boden aufsteigende Wasser mineralischer Quellen. Zu seiner Ausnutzung errichtete man 1818 im N-Flügel des Porti-
kus eine öffentliche Therme, die aber bald wieder aufgegeben wurde.
Die damals ausgebauten Räume beherbergen seit 1953 das Antiquario Flegreo, ein kleines, aber gehaltvolles Antikenmuseum mit Statuen, Reliefs, Porträtbüsten, Fußbodenfragmenten u. a. aus Pozzuoli und Umgebung.
Die ungewöhnlich große und prächtige Marktanlage ist nur das Fragment eines ausgedehnten Komplexes öffentlicher Bauten, in denen der Rang der Hafenstadt sich ausdrückte. Berühmt waren die Säulenportiken, die sich an den Kais entlangzogen (vgl. die Veduten im Neapler Archäologischen Nationalmuseum, Saal 77). Reste von Hafenbecken und Kaimauern liegen vor dem Südufer der Stadt unter dem Meer. Die große augusteische Mole wurde erst zu Beginn dieses Jahrhunderts von der modernen Mole überbaut. Mit 372 m Länge und 15-16 m Breite bildete sie eine der imponierendsten Leistungen der römischen Ingenieurkunst. 15 massive Pfeiler trugen Bögen von 10 m Spannweite (opus pilarum); auf dem Molenkopf stand ein Ehrenbogen des Antoninus Pius, der 139 n. Chr. den Bau instand gesetzt hatte. Die Pfeiler bestanden aus Gußmauerwerk (Bruchstein in Mörtelbettung); zur Herstellung eines wasserfesten Zements diente die in der Umgegend anstehende Tufferde (Puzzolane, Posillipo-Tuff), die, mit gebranntem Kalk gemischt, ein hydraulisches (d. h. unter Wasser erhärtendes) Bindemittel abgibt. Die »Wunderbaren Eigenschaften« dieses Baustoffs, der auch der römischen Wölbetechnik neue Möglichkeiten eröffnete, hat schon Vitruv beschrieben und mit gelehrter Umständlichkeit aus seiner vulkanischen Herkunft abgeleitet.
Flavisches Amphitheater (in der landeinwärts gelegenen Oberstadt; Eingang in der Via dell’Anfiteatro, die westlich von der Via Solfatara abzweigt)
Seine Erbauung fällt in die Epoche Vespasians (2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.); ein Erweiterungsbau, der n. a. die unterirdischen Anlagen betraf, läßt sich in die Zeit des Trajan oder des Hadrian datieren. In späteren Jahrhunderten legten sich dicke Aschenschichten über den Bau; was darüber aufragte, wurde von Anwohnern auf der Suche nach Baumaterial abgetragen oder wenigstens seiner Verkleidung beraubt. Erst die Grabungskampagnen von 1839-55, 1880-82 und 1928-47 haben die imposante Struktur des Gebäudes wieder zum Vorschein gebracht.
Es handelt sich um das drittgrößte Amphitheater Italiens (nach dem Kolosseum und dem Anfiteatro Campano in S. Maria di Capua Vetere). Die Durchmesser der Ellipse, von einer Außenwand zur anderen, betrugen 149 x 116 n, die Arena mißt 75 x 42 m; die in 3 Zonen geteilten Stufenringe (für Adel, Bürgertum und Plebs; der obere ist nicht erhalten) sollen 35-40000 Zuschauern Platz geboten haben.
Die fast verschwundene Außenfront bestand aus 3 Arkadengeschossen und einer Attika mit Säulengalerie. Der Eingang an der SO-Seite zeigt noch die Überreste eines Propylons mit Pfeilern und Säulen. Davor eine Nische mit einer Statue des Poseidon (kürzlich im Hafen von Baiae gefunden, mit Löchern von Bohrmuscheln); über ihr eine der Inschriften von den alten Eingangsportalen, die Errichtung des Baues aus städtischen Mitteln verkündend. Ein Abzweig des kampanischen Aquädukts (S. 457), der in der Arena mündet, zeigt an, daß diese urspr. zur Veranstaltung von Naumachien (Seeschlachten) eingerichtet war. Dieses änderte sich mit dem Einbau der unterirdischen Gewölbe (carceres). Sie dienten u. a. zur Aufnahme von Raubtierkäfigen, die mit Hilfe von Aufzügen durch quadratische Öffnungen in die Arena gehoben werden konnten, wo nun v. a. Tierhetzen (venationes) stattfanden. Diese unterirdischen Teile sind dank der frühzeitigen Verschüttung der Anlage im ganzen Umfang erhalten und bilden den sehenswertesten Teil des Gebäudes.
Eine kleine Kapelle in einem der Kellerräume erinnert an das Schicksal des hl. Januarius und seine Gefährten Sosius, Festus, Desiderius, Proculus, Eutyches und Acutius, die während der Christenverfolgung von 305 in der Arena von Pozzuoli den Raubtieren vorgeworfen werden sollten; weil diese die heiligen Männer nicht anrührten oder weil wegen der Abwesenheit des Gouverneurs das Schauspiel nicht stattfinden konnte, wurde das Urteil in Tod durch Enthauptung umgewandelt und in der Gegend der Solfatara vollstreckt (s. S. 448).
Aus augusteischer Zeit stammt das sog. kleine Amphitheater, von dem sich einige Überreste im Bereich der Bahnlinie zwischen Via Solfatara und der östl. Parallelstraße Via Vigna erhalten haben. Es handelte sich um einen 130 x 95 m messenden Bau, der etwa nord-südlich ausgerichtet war. — Südlich davon (auf einem Grundstück an der Via Vecchia di S. Gennaro) liegt die mühsam zugängliche Piscina Cardito, eine 3schiffige röm. Zisterne von 5516 m Grundfläche und 15 m Tiefe; daneben eine 2. Zisterne mit 14 länglichen Becken zur Reinigung des Wassers (Sedimentation). — Die Via dell’Anfiteatro verlängert sich nach NW im Corso Terracciano; auf dem Gelände der südlich angrenzenden Grundstücke liegen weitere Ruinen, darunter der Stylobat eines großen Tempels (»Tempio dell’Onore«) und die als »Tempio di Nettuno« bezeichneten Thermen.
An der folgenden Straßenkreuzung (Quadrivo dell’Annunziata) beginnt die Via Campana (Via Consularis Puteolis Capuam), die älteste Verkehrsader der Region, die über Quarto nach Capua führt. Ihr Anfangstrakt wird begleitet von röm. Grabmälern (Mausoleen, Columbarien, Hypogäen); sie stellen trotz ihrer sehr ungleichen Erhaltung einen der größten und wichtigsten Komplexe röm. Grabarchitektur dar, die wir kennen.
Die weitere Umgebung von Pozzuoli, Schauplatz der verschiedenartigsten vulkanischen Phänomene, trägt seit dem Altertum den Namen »Phlegräische Felder« (vom griech. phlegraios = brennend). Keine Landschaft des Westens kann sich rühmen, einen vergleichbaren Beitrag zur Bildung der griech. Sagenwelt geleistet zu haben. »Der verworrene Bau des Landes«, schrieb Heinrich Nissen, »die bewaldeten Ringwälle, die tiefen Gründe, die tödlichen Dünste, die heißen Quellen, die ausströmenden Dampfwolken, die Erschütterungen der Erde, und vollends ein Ausbruch mit all seinen Schrecken stellten an den Mut der ionischen Ansiedler die höchsten Anforderungen, regten ihre Phantasie in den innersten Tiefen auf. Daß Homer ihren Erzählungen Farben für die Ausmalung von Odysseus’ Höllenfahrt entlehnt habe, ist eine nicht zu beweisende aber wahrscheinliche Annahme ... Unter allen Umständen war eine so ungewöhnliche, rätselhafte, furchtbare Natur geeignet, den Gedanken an die Unterwelt zu erzeugen und mit ihren Erscheinungen unauslöslich zu verknüpfen«, und es ist fesselnd zu sehen, wie durch alle späteren historischen Veränderungen des Landes dieses mythische Grundmuster durchschlägt.
Bis zur Mitte des 19. Jh. gehörte die Besichtigung der Phlegräischen Felder zu den Glanzpunkten jeder Neapelreise. Mit dem Interesse an den Naturerscheinungen verband sich das Vergnügen an einem Ausflug ins Grüne; dem Gebildeten erweckte jede Ruine Reminiszenzen aus Mythologie, Geschichtsschreibung und Dichtung der Alten. »Zwischen Natur- und Völkerereignissen hin und wider getrieben« fühlte sich Goethe, nachdem er an einem der ersten Tage seines neapolitan. Aufenthaltes den klassischen Aus-
flug absolviert hatte: »Eine Wasserfahrt bis Pozzuoli, leichte Landfahrten, heitere Spaziergänge durch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Himmel der unsicherste Boden. Trümmern undenkbarer Wohlhäbigkeit, zerlästert und unerfreulich. Siedende Wasser, Schwefel aushauchende Grüfte, dem Pflanzenleben widerstrebende Schlackenberge, kahle, widerliche Räume und dann doch zuletzt eine immer üppige Vegetation, eingreifend, wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertötete erhebend, um Landseen und Bäche umher, ja, den herrlichsten Eichwald an den Wänden eines alten Kraters behauptend.« Genüsse dieser Art lassen sich heute am besten beim Betrachten von Veduten des 18. und 19. Jh. nachempfinden; in Wirklichkeit ist die Landschaft v. a. entlang der Meeresküste von modernen Verkehrs-, Industrie- und Wohnbauten entstellt (worüber zu klagen freilich auch Horaz schon Anlaß fand), und nur momentweise leuchtet der alte Zauber auf.
Noch relativ unberührt ist die landeinwärts gelegene Krater- und Hügellandschaft. Die Via Domitiana führt ein Stück östlich von Pozzuoli an der Solfatara vorbei, dem Forum Vulcani (Hephaistu agora) der Alten, von deren fabelhaftem Naturschauspiel schon Petronius eine präzise Schilderung gegeben hat.
Auf der Weiterfahrt nach Neapel passiert man nach etwa 300 m die Kapuzinerkirche S. Gennaro, erbaut 1583 am Ort der Enthauptung des Heiligen. Man zeigt hier einen Stein mit Blutflecken, die sich während des Blutwunders im Dom von Neapel hellrot verfärben; außerdem eine interessante Marmorbüste des Märtyrers vom Ende des 13. Jh.
Hinter der Hügelkette im NO öffnet sich der weite und flache Kessel von Agnano, dessen Thermalquellen wahrscheinl. schon seit vorröm. Zeit zu Heilzwecken benutzt werden. Neben den modernen Badeanlagen (Stabilimento Termale) liegen die Ruinen der großen röm. Thermen, die sich in 6 Stockwerken am Abhang des Monte Spina hinaufzogen. Sie wurden im 6. Jh. restauriert, im 10. Jh. durch Erdbeben teilweise zerstört, waren aber noch im 15. Jh. in Gebrauch; Grabungen von 1898, deren Fortsetzung geplant
ist, förderten antike Marmorskulpturen zutage, die heute im Stabilimento zu sehen sind. — Der von hier aus nordwestlich gelegene Ringkrater der Astroni soll ebenfalls eine röm. Thermenanlage enthalten haben, doch sind bis jetzt keine Spuren davon gefunden worden. Der dicht bewaldete Trichter ist auf seinem Rand von einer hohen Mauer umgeben und diente seit dem 15. Jh. als königlicher Wildpark und Jagdrevier. Alfons I. von Aragon, Kaiser Karl V. und Karl von Bourbon hielten hier berühmte Jagden ab; aus der Bourbonenzeit stammt das Casino di Caccia am Ufer des versumpften Kratersees.
Ein zweiter Kraterkomplex erhebt sich etwa 3 km westlich von Pozzuoli über dem Scheitelpunkt des Uferbogens. Der 140 m hohe Kegel des Monte Nuovo ist das Produkt einer vulkanischen Explosion, die in der Nacht vom 28. zum 29. September 1539 begann und etwa 48 Stunden dauerte.
Die Gestalt der beiden ostwärts angrenzenden Seen wurde damals erheblich verändert, mancherlei antike Ruinen verschwanden unter Lapilli-und Ascheschichten. In der Nähe des verschütteten Dorfes Tripergole lag Ciceros Villa Cumana, auch Academia genannt, in der die Niederschrift von »De re publica« begonnen wurde. Man überblickt von dort die Ufer des Lago di Lucrino, einer flachen Lagune, die sich bei den Römern des 1. Jh. v. Chr. v. a. wegen ihres Fischreichtums und der hier betriebenen Austernzucht eines besonderen Rufes erfreute. Später wurde sie in den Badebetrieb von Baiae einbezogen; nächtliche Kahnfahrten auf dem Lacus Lucrinus gehörten zu den beliebtesten Vergnügungen der Sommergäste. Die schmale Düne zwischen See und Meer bildete die kürzeste Verbindung von Baiae nach Puteoli; der offenbar schon in ältester Zeit erbaute Straßendamm der Via Herculanea galt als Werk des Herkules, der hier die Rinder des Geryones über die Sümpfe geführt haben soll.
Ein schmaler Kanal verbindet den Lucrinus mit dem nördlich benachbarten Lago d’Averno, einem kreisrunden Kratersee von ca. 1 km Durchmesser, dessen Grund 33 m unter den Meeresspiegel hinabreicht. Auch wer nicht mit der antiken Überlieferung vertraut ist, wird sich dem von wal-
digen Steilwänden eingeschlossenen, mal bleigrau, mal tiefschwarz schimmernden Wasserspiegel nicht ohne Beklommenheit nähern. (Tafel bei S. 449.)
Die griech. Siedler sahen in ihm den Eingang zur Unterwelt, wie sie im 6. Gesang der »Odyssee« geschildert wird. Hier war der Sitz des Totenorakels, hier stiegen Odysseus (und nach ihm Aeneas) ins Reich der Schatten hinab; hier hauste in unterirdischen Höhlen und Gängen das Volk der Kimmerier, die nie ein Sonnenstrahl traf. Eine am Ufer entspringende Thermalquelle galt als die Quelle des Styx; ihr Wasser wurde nicht getrunken. Der Name Avernus wurde auf das griech. »aornos« (= ohne Vögel) zurückgeführt; man glaubte, kein Vogel könne den See überfliegen, ohne von giftigen Dünsten betäubt herabzufallen. »Solches also«, schreibt Strabo zu Beginn des 1. Jh. v. Chr., »haben unsere Vorfahren gefabelt; jetzt aber, wo der Wald ringsum von Agrippa abgehauen und der Platz mit Häusern bebaut, auch ein unterirdischer Gang vom Avernus bis Cumae geführt ist, hat sich die Unwahrheit jener Sagen gezeigt.« Diese Ereignisse fallen in die Zeit der Kämpfe zwischen Oktavian und Pompeius. Oktavians Feldherr Vespasianus Agrippa erkannte die Eignung des Platzes als Flottenbasis, durchstach die Landengen zwischen Avernus, Lucrinus und dem Meer und schuf so den »Portus Julius« (37 v. Chr.). Aus den Wäldern der Kraterwände wurden Kriegsschiffe gebaut, am Ufer entstanden Magazine und Unterkünfte, ein Tunnel verband den See mit dem Strand von Cumae. Doch zeigte sich bald, daß die bradyseismischen Bewegungen ausgesetzte Lagune nur mit großer Mühe für den Schiffsverkehr offen zu halten war. Nach seiner Erhebung zum Augustus verlegte Oktavian den Kriegshafen nach Misenum und ließ an den entweihten Ufern des Kratersees den Kultus der unterweltlichen Gottheiten neu erstehen. So kehrt auch Vergil, der in den Georgica das Werk des Agrippa gepriesen hatte, mit der Aeneis zum Mythos zurück und läßt seinen Helden, geführt von der cumäischen Sibylle, »in den dämmernden Hainen des schwarzen Sees« den Eingang zum Hades finden. Bis weit in christl. Zeit blieben die alten Opferbräuche lebendig, und noch byzantin. Autoren spannen die Avernus-Sage fort. In der Folgezeit wurden die beiden Seen zu gefürchteten Malariaherden. 1770 schlug der Abbé Galiani vor, die Verbindung zum Meer wiederherzustellen; 1855 plante König Ferdinand II. die Umwandlung des Sees in einen modernen Hafen, wie ihm dies in Ischia gelungen war, doch verhinderte der Anschluß Neapels an das Königreich Italien die Ausführung des Projekts.
Die Ufer des Sees, zugänglich von der Küstenstraße (Stazione di Lucrino) wie auch von der nördlich vorbeiführenden Via Domitiana, zeigen noch beachtliche Reste röm. Bautätigkeit. An der O-Seite liegt der sog. Tempio di
Apollo, in Wahrheit eine Thermenanlage der Kaiserzeit. Sie nutzte die hier reichlich hervortretenden Thermalquellen, Vorboten der späteren Eruption des Monte Nuovo, die das Bauwerk dann zerstörte. Als ältester Teil (claudianisch) gilt der nach N gelegene Komplex; die südlich angrenzenden Ruinen werden teils in die flavische (Retikulatwerk), teils in die nachhadrianische Zeit (Backsteinmauern) datiert. Überaus imposant wirkt die teilweise aufrechtstehende Umfassungsmauer eines runden, außen oktogonal ummantelten Badesaals von enormen Dimensionen (37-38 m Durchmesser), mit Nischen im Untergeschoß und Rundbogenfenstern unter der eingestürzten Kuppel, nach dem Vorbild des »Tempio di Venere« von Baiae.
Am W-Ufer stößt man verschiedentlich auf Spuren der Tätigkeit des Agrippa. Von S kommend erreicht man zunächst, über einen links abzweigenden Seitenweg, den Eingang der sog. Grotta della Sibilla, eines etwa 200 m langen Tunnels, der zu einem System unterirdischer Gänge und Räume führt. Zweifellos handelt es sich um einen 37 v. Chr: angelegten Verbindungsgang zwischen den beiden Hafenseen; die genannten Räume waren viell. Thermalbäder. Erst von späteren Mythographen wurde der Aufenthalt der cumäischen Sibylle hierher verlegt. — Weiter westlich, auf einem ebenen Uferstreifen, findet sich ein Komplex von Backstein- und Retikulatmauerwerk, den man für einen Überrest des Navale di Agrippa, d. h. der Werft- und Dockanlagen hält. — Als Grotta del Cocceio wird der ca. 1 km lange Tunnel bezeichnet, der den Monte Grillo durchquert und das NW-Ufer des Sees mit der cumäischen Küste verbindet. Er bildet eines der erstaunlichsten Denkmäler jener »abstrakten Energie des Willens, die die Römer seit der frühesten Zeit in den Kampf mit der Erde, zu mächtigen Erdarbeiten und Bauwerken trieb« (V. Helm). Den Namen des Architekten L. Cocceius Auctus, der in Pozzuoli inschriftlich überliefert ist, entnehmen wir hier der Erdbeschreibung des Strabo; dieser fügt die Bemerkung hinzu, Cocceius habe beim Bau des Tunnels »gewissermaßen sich an die oben erwähnte Sage von den Kimmeriern gehalten und es vielleicht sogar als eine in dieser Gegend urväterliche Sitte angesehen, daß die Wege durch Erdgänge gehen«. Der praktische Zweck war die Anlage einer Schnellverbindung vom Portus Julius zum Stütz-
punkt von Cumae; die beträchtliche Breite (2 Fahrspuren) läßt darauf schließen, daß auch an den Transport von Waren und Baumaterialien gedacht war. Die westl. Einfahrt, an der Straße zwischen Cumae und dem Arco Felice, liegt etwas höher, so daß sich zum See hin ein leichtes Gefälle ergibt. An der N-Wand des Tunnels läuft eine Wasserleitung entlang, die der Frischwasserversorgung der Flotte Agrippas diente. 6 teils senkrecht, teils schräg geführte Lichtschächte sorgen für ausreichende Beleuchtung. Um die Mitte des 19. Jh. ließ Ferdinand II. den seit langem verschütteten Tunnel ausgraben; im 2. Weltkrieg diente er als Munitionsdepot und wurde durch Explosionen schwer beschädigt, seitdem ist er bis auf weiteres unzugänglich.
Die Küstenstraße von Lucrino stößt westlich auf ein flaches Vorgebirge, dessen Abhang in röm. Zeit eine der größten Thermenanlagen des Golfes trug. Die Gegend ist heute durch den Straßenbau und durch zahlreiche Puzzolangruben verwüstet. Stiche des 17. Jh. zeigen die sog. Stufe di Nerone noch als aufrecht stehendes Gebäude von mindestens 4 Stockwerken. Ihre Spezialität waren die Sudarien (Schwitzbäder), eine Universaltherapie der antiken Medizin, die hier mit Hilfe der aus dem Boden steigenden heißen Dämpfe praktiziert wurde. Plinius d. A und Celsus haben die Wirkungsweise exakt beschrieben. Zu sehen sind noch 4 gewölbte Badezellen mit seitlich in den Tuff gehöhlten Ruhebetten; ein tunnelartiger Gang führt zu den Dampf- und Wasserquellen. — Die Spitze des Vorgebirges heißt Punta dell’Epitaffio, nach einer heute verschwundenen Inschrifttafel des Vizekönigs Don Pedro Antonio von Aragon (1666-71), der den seit dem Ausbruch des Monte Nuovo darniederliegenden Badebetrieb von Baiae neu belebt hatte; sie enthielt ein von dem königlichen Leibarzt Sebastiano Bartolo ausgearbeitetes Verzeichnis aller Heilquellen der Küste und genaue Vorschriften für ihre Benutzung. Die über den Hügel verstreuten antiken Ruinen scheinen hauptsächlich von Villen zu stammen; auch der von Statius und Martial besungene Tempel der Venus Lucrina wird hier vermutet.
Der Golf von Baiae hat seine Gestalt seit dem Altertum stark verändert: Der Strand ist bis zu 10 m Tiefe abgesunken, Reste antiker Villen finden sich unter dem Meer noch in 500 m Entfernung von der heutigen Küstenlinie.
Der Hafen gehörte urspr. zum Machtbereich von Cumae; ein hier beigesetzter Gefährte des Odysseus, Baios‚ soll dem Städtchen seinen Namen gegeben haben. Als Kur-und Badeort genoß das röm. Baiae weltweiten Ruf. Mit den Wirkungen der heißen Wässer und Dämpfe, die hier in einzigartiger Fälle und Vielfalt zur Verfügung standen, mischte sich der balsamische Duft der Myrtenwälder des Hügels; das milde Klima erlaubte zu jeder Jahreszeit den Genuß einer Landschaft, die zu den schönsten des Mittelmeeres gezählt wurde. Die Thermen, eine förmliche Badestadt mit allen nur wünschbaren Räumlichkeiten für Erholung und Zerstreuung, stiegen vom Strand am Abhang empor. Sie verdankten ihre Entstehung der unermüdlichen Bautätigkeit der Kaiser von Augustus bis Alexander Severus, die das Gelände nach und nach in ihren Besitz brachten und offene und gedeckte Bäder, Fischbecken, Gärten und Wäldchen zu einer einzigen Villa zusammenfügten. Nero unternahm die Anlage einer gigantischen Piscina, die alle Wässer des Strandes sammeln sollte (in der Gegend der heutigen Werftanlagen); Caligula ließ von Puteoli nach Baiae eine Schiffsbrücke schlagen, um den Zufahrtsweg abzukürzen. Von diesen Bauten ist vieles durch bradyseismische Bewegungen untergegangen, anderes eingestürzt und im Laufe der Jahrhunderte abgetragen worden; nur ein Ruinenfeld, allerdings von grandiosem Format, gibt heute vom Glanz des alten Baiae noch einen Begriff.
Zu seiner Ergänzung hilft eine literarische und bildliche Überlieferung von seltener Reichhaltigkeit. Den Annalen des Livius ist zu entnehmen, daß schon 178 v. Chr. der Konsul Gaius Cornelius Scipio die »Aquae Cumanae« aufsuchte, um seine Arthritis zu kurieren. Im 1. Jh. v. Chr. wurde Baiae zur bevorzugten Sommerfrische der röm. Geburts- und Geldaristokratie; gegen Ende der Republik entwickelte sich ein mondänes Badeleben, was alteingesessene Villenbesitzer wie Varro und Cicero nicht wenig erboste. Seneca reiste nach eintägigem Aufenthalt wieder ab, da »der Weise einen Ort vermeiden muß, den die Üppigkeit zum Tummelplatz erwählt hat«; ein andermal hielt er länger aus, um sich und seinem Briefpartner Lucilius zu beweisen, daß der geistig Arbeitende auch von den tausend Geräuschen des Badebetriebes — die mit erbitterter Akribie geschildert werden — nicht aus der Fassung zu bringen ist: »Mag draußen alles vom Lärm widerhallen, wenn nur im Inneren Ruhe herrscht ... denn was nützte mir eine stille Umgebung, solange in mir selbst die Leidenschaften brausen?« Als Gegenstimme liest man die Verse des Dichters Properz, der seine Cynthia den
Versuchungen dieses Strandes ausgesetzt weiß und in die berühmte Verwünschung ausbricht: »A pereant Baiae, crimen amoris, aquae!« — Die ältesten Ansichten von Baiae finden sich auf Glasgefüßen des 2. oder 3. nachchr. Jh., »die ziemlich roh die Sehenswürdigkeiten der Küste vorführen; sie lehren, daß wenigstens in der späteren Kaiserzeit ein Publikum hier verkehrte, das derartige Dutzendware als Andenken mitzunehmen nicht verschmähte« (H. Nissen).
Erstaunlicherweise haben nicht einmal die Stürme der Völkerwanderung den Badebetrieb unterbrochen. In der 2. Hälfte des 5. Jh. schildert Sidonius Apollinaris das Leben in den Thermen; im 6. Jh. werden sie von Cassiodor und Gregor d. Gr., im 10. Jh. von Johannes Diaconus erwähnt. Den Besuchern des Mittelalters muß etwas von der Großartigkeit der antiken Anlage aufgegangen sein; ihre Erbauung schreibt Gervasius von Tilbury um 1190 dem »Magier« Vergil zu (vgl. S. 467), was von da an für lange Zeit zum literarischen »topos« wird. Eine ausführliche Beschreibung der Bäder mit dem Titel »Nomina et virtutes Balneorum Putheoli et Baiarum« stammt von dem staufischen Hofdichter Peter von Eboli und ist Kaiser Friedrich II. gewidmet, der 1227 als Kurgast in Baiae weilte; ihre überaus fesselnden Illustrationen werden neuerdings auf seither verschwundene antike Wandgemälde im Inneren der Thermen zurückgeführt (Tafel S. 464). Karl II. von Anjou gründete 1298 bei Tripergole am Averner See ein Hospital und stellte einen Badearzt an. Von den neuen Interessen der Humanisten zeugen Erwähnungen bei Petrarca und Boccaccio, der sich als Kenner auch der galanten Seite des Badelebens erweist; der gelehrte Jovianus Pontanus widmet den antiken Thermen eine lange Abhandlung in Gedichtform. Die Architekten der Renaissance erkannten ihre baugeschichtliche Bedeutung, vermaßen und zeichneten die damals aufrechtstehenden Überreste; ihnen folgten die Landschaftsmaler des idyllischen und sentimentalen Genres und endlich, seit dem Ausgang des 18. Jh., die Archäologen.
1936 zur »zona archeologica« erklärt und seitdem in Ausgrabung begriffen, läßt sich jetzt wenigstens der zentrale Thermenkomplex wieder in seiner ganzen Ausdehnung übersehen. Auf einer Breite von fast einem halben Kilometer entfaltete sich ein Labyrinth von Badesälen und -zellen, offenen Piscinen, Nymphäen und Exedren, Portiken, Treppen und Rampen, Terrassen, Theatern und Belvedere; der heutige Anblick wirkt doppelt verwirrend, da man z. T. in das unterirdische System der Leitungen und Zisternen hineinblickt. Von der Dekoration der Wände und Fußböden finden sich kaum Spuren; eine Ausnahme macht teilweise die in der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. entstandene, 1953 freigelegte Terma di Sosandra im SW des Grabungs-
bezirks. Ihr Kernstück ist eine zum Meer geöffnete flachbogige Exedra mit radial angeordneten Badezellen; davor liegt eine weitläufige Aussichtsterrasse, in deren Zentrum ein kreisrundes Schwimmbassin; unter ihr noch ein von tonnengewölbten Sälen umgebenes Thermalschwimmbecken. Der Name kommt von der schönen Marmorstatue der Sosandra (wahrscheinl. Aphrodite Sotera), Kopie eines Bronzeoriginals des 5. Jh. v. Chr., die hier gefunden und aufgestellt wurde.
Aus den übrigen Mauerzügen ragen 3 große, noch teilweise aufrechtstehende Rundbauten hervor; sie werden nach humanistischer Gelehrtentradition als »Tempel« bezeichnet, doch handelt es sich in Wirklichkeit um monumentale Badesäle. Für die Geschichte der Architektur sind sie von erstrangiger Bedeutung: Sie zeigen den (profanen!) Ursprung des röm. Kuppelbaus und der dafür konstitutiven Technik des »opus caementicium« — auf Holzschalung ausgeführter Zementguß aus Mörtel und kleinteiligem Bruchsteinwerk —‚ für welche die hier anstehende »Puzzolanerde« (vgl. S. 445) einen besonders geeigneten Rohstoff bot. Das älteste Monument dieser Art ist der innerhalb der Grabungszone gelegene Tempio di Mercurio: ein quadratisch ummantelter kreisrunder Kuppelraum mit 4 Diagonalnischen und runder Scheitelöffnung, der die Grundform des Pantheon vorwegnimmt (Durchmesser 21,55 m, d. h.
ziemlich genau die Hälfte des röm. Tempels). Das reine Retikulatmauerwerk, ohne Backsteinzutaten, erlaubt die Datierung ins 1. Viertel des 1. Jh. n. Chr.; die südlich angrenzenden Bauten stammen aus severischer Zeit. Die halbkugelige Kuppel ist vollständig intakt (1931 restaur.); sie war mit weißem Mosaik ausgelegt, die Zylinderwände mit Marmorplatten verkleidet. Ein altertümlicher Zug ist auch die Anordnung der Fenster in der Kuppelkalotte. Leider ist der untere Teil des Raumes heute mit Wasser und Schlamm gefüllt; Stiche des 18. Jh., d. h. aus der Aufstiegsphase des Bradyseismos (vgl. S. 444), geben ein vollständiges Bild der Architektur.
Jenseits des eingefriedeten Bezirks erhebt sich im S der Tempio di Venere aus der Zeit Hadrians (1. Drittel 2. Jh.), innen rund mit 4 diagonalen Apsiden (Durchmesser 26,3 m), außen oktogonal mit massiven Kantenpfeilern. Die Fenster bilden hier zum ersten Mal einen »Lichtgaden« in der aufgehenden Wand; sie greifen als Stichbogen in das Kuppelgewölbe ein, das sich aus sphärisch gekrümmten Segmenten zusammensetzte (Schirm-oder Melonenkuppel). So entsteht ein vertikal gegliedertes Wandsystem, dessen Leitlinien im Gewölbescheitel zusammenliefen. Ein Durchgang in der SW-Apsis führt zu einer kleinen Gruppe weiterer Kuppelräume; sie bildeten viell. das Privatbad des Kaisers Hadrian, der häufig nach Baiae zur Kur ging und i. J. 138 hier starb. 3 diagonal angeordnete Rundräume, durch Nischen miteinander verbunden, begrenzten ein zentrales Oktogon mit wellenförmig aus-und einschwingenden Wänden; darüber erhob sich wieder ein Lichtgaden und ein aus Konvex- und Konkavabschnitten zusammengesetztes Schirmgewölbe.
Die gleichen Kennzeichen der hadrianischen oder nachhadrianischen Epoche zeigt der Tempio di Diana nördlich außerhalb des Grabungsgeländes. Der Bau steht zur Hälfte aufrecht und bietet den Anblick einer kolossalen Nische; der Durchmesser des Rundraumes beträgt hier 29,5 m.
Von den privaten und kaiserlichen Villen, die in der antiken Literatur so vielfach bezeugt sind, ist heute nichts mehr zu sehen. Sie wurden überragt von dem Villenpalast, den Julius Caesar auf der Kuppe des Hügels im S der Bucht errichtet hatte — nicht als Lustvilla, sondern als festes Schloß, wie Seneca lobend hervorhebt: »Jene Männer, auf welche das Schicksal des römischen Volkes die Staatsmacht zuerst übertrug, dünkte es kriegerischer, von hoher Warte die Gegend zu über-
schauen.« Er diente in späteren Jahren als kaiserliche Residenz; auf seinen Ruinen errichtete um die Mitte des 16. Jh. Don Pedro di Toledo das Castello di Baia zur Verteidigung der phlegräischen Küste gegen die Seeräuber (im 17. und 19. Jh. umgebaut, unzugänglich).
In der südlich angrenzenden Bucht liegt das Fischerdörfchen Bacoli, lat. Bauli, z. Z. der Römer gleichfalls als Villenort berühmt.
An der Marina steht die Ruine eines kleinen Rundbaus, urspr. wohl das Odeon einer Strandvilla; die traditionelle Bezeichnung Sepolcro di Agrippina bezieht sich auf die unglückliche Mutter Neros, die in ihrer Villa am Lukriner See von Abgesandten ihres Sohnes umgebracht und dann in Bauli bestattet wurde (Tacitus).
Die Anhöhe im S trug eine der berühmtesten Villen der Küste, erbaut von dem Rhetor und passionierten Fischzüchter Quintus Hortensius. Cicero, der hier seine »Academia priora« versammelte und von der Höhe aus am anderen Ufer des Golfes sein »Pompeianum« zu erkennen glaubte, belegte den Hausherrn mit dem Ehrennamen »Triton« und sprach ihm Zaubermacht über die Fische zu. Die nächste Besitzerin war Antonia, die Gattin des Drusus, die ihre Lieblingsmuräne mit goldenen Ohrringen geschmückt haben soll. Unter Nero wurde die Villa kaiserliches Eigentum. Agrippina weilte hier wenige Tage vor ihrem Tode und entging auf der nächtlichen Überfahrt nach Lucrino mit knapper Not einem von Nero arrangierten Schiffbruch. Der Fischliebhaber unter den flavischen Kaisern war Vespasian; Martial weiß zu berichten, seine »süßen lieben Fische« hätten auf ihre Namen gehört und seien auf den Ruf ihres Gebieters herbeigeeilt, um ihm die Hand zu lecken.
Der einzige heute noch sichtbare Überrest dieser Herrlichkeit ist ein monumentales Wasserreservoir auf der O-Spitze des Hügels, die sog. Cento Camerelle (Eingang Via Cento Camerelle 165). Es wurde im 1. Jh. n. Chr. angelegt und besteht aus 4 von Pfeilerarkaden getrennten Schiffen; darunter liegt eine ältere, wohl republikanische Anlage aus rechtwinklig gekreuzten Gängen.
Die größte Zisterne des ganzen röm. Reiches war die von Augustus erbaute Piscina Mirabile am S-Ausgang des Ortes (Via della Piscina Mirabile; Kustode Via A. Greco 16). Sie diente der Frischwasserversorgung der in Misenum stationierten tyrrhenischen Flotte (s. u.). Wie die Römer eine solche Aufgabe lösten, wird einem hier großartig demonstriert. Das Wasser hat man aus den Hirpiner Bergen herangeführt, d. h. über eine Entfernung von etwa 65 km (Luftlinie); eine kurz vor dem 2. Weltkrieg auf der Hochebene Von Serino, zwischen Avellino und Benevent, gefundene Inschrift bezeichnet den Quellort und nennt gleichzeitig den Erbauer: Fontis Augustei Aquaeductus. Die Leitung lief über Brücken und durch Felsentunnel nach Neapel (s. S. 210), versorgte unterwegs durch Abzweigungen Nola und Pompei; ein Arm endete in Neapel, ein anderer
führte vom Vomero nach der Chiaia, durchtunnelte den Posillipo (s. S. 467), speiste die Thermen von Agnano, Pozzuoli, Baiae und Bauli und mündete endlich im Reservoir von Misenum. Es besteht aus einer gedeckten Grube von 7025,5 m Grundfläche und 15 m Tiefe. 2 bequeme Treppen führen ins Innere hinab; der Eindruck ist von nicht zu überbietender Phantastik. 12 Reihen von je 4 kreuzförmigen Pfeilern, durch Bögen untereinander verbunden, tragen quergerichtete Tonnengewölbe. Das Mauerwerk der Pfeiler wie auch der Wandverkleidung besteht aus Tuffretikulat mit Backsteinverstärkungen; darauf liegt eine dicke wasserfeste Putzschicht (opus signinum), überzogen Von den Kalkablagerungen des Serino-Wassers. Der Zufluß befand sich in der W-Wand; die Entnahme erfolgte wahrscheinl. durch auf dem Dach montierte Schöpfräder.
Das mittlere der 13 Querschiffe diente als Klärbecken (piscina limaria); sein Grund liegt etwas tiefer und ist leicht nach S geneigt, wo sich eine Abflußöffnung für die periodische Reinigung der Zisterne befindet. Das Fassungsvermögen wird mit 12 000 m3 angegeben.
Mit seinen Hügeln und Buchten bildet das Kap von Misenum die südlichste Kratergruppe der Küste. Das Vorgebirge hat die Form einer abgeplatteten Pyramide; den Griechen erschien es wie ein prähistorisches Heldengrab, und sie lokalisierten hier die Grabstätte von Odysseus’ Fahrtgenossen Misenos, der dann bei Vergil als Herold des Aeneas auftritt.
Das zwischen dem Kap und der Höhe von Bacoli einspringende Doppelbecken stellt den besten natürlichen Hafen Kampaniens dar. Er wurde frühzeitig von Cumae benutzt; Dionysios von Halikarnass zählt den Besitz dieses Hafens zu den Grundbedingungen der cumäischen Seemacht. Gegen Ende des I. Jh. 7). Chr. erkannte Augustus die Eignung des Platzes zum Flottenstützpunkt. Der hier stationierten Classis Misenensis war der Schutz der ganzen tyrrhenischen Küste anvertraut (ihr Gegenstück auf der adriatischen Seite bildete die Classis Ravennas). Der berühmteste ihrer Präfekten war der ältere Plinius, Autor der »Historia Naturalis«; von seiner Wohnung sah er 79 n. Chr. den großen Vesuv-Ausbruch, lief mit einem Flottenverband zur Hilfeleistung aus und fand bei den Rettungsarbeiten den Tod (vgl. S. 507).
Den Eingang des röm. Hafens schmückten 2 Molen, deren Reste heute noch unter Wasser sichtbar sind. Die äußere, vom S-Ufer ausgehend, bestand aus 2 gegeneinander versetzten Pfeilerreihen (opus pilarum, vgl.
S. 445) von etwa 180 m Länge, die innere an der N-Spitze (Punta della Pennata) war einreihig und etwa halb so lang. Im vorderen Hafenbecken waren die Liegeplätze der einsatzbereiten Schiffe, das hintere — heute Lago di Miseno oder Mare Morto genannt — enthielt die Werften und Dockanlagen. Durch den trennenden Isthmus führte ein Kanal; die Straße von Bauli nach Misenum überquerte ihn auf einer Holzbrücke. An die Kasernen, die einstmals das Ufer säumten, erinnert nur noch der heutige Name des nach S gekehrten Strandes von Miliscola (militum schola).
Das 31 v. Chr. von Augustus gegründete Städtchen lag bei der Punta Sarparella am S-Ufer des Außenhafens; man erkennt zwischen den Häusern des neuen Ortes noch die Umrisse eines Theaters, mit einem in den Hügel gegrabenen Zugang vom Wasser, südöstlich davon die Reste der Thermen. — Am Fuß des Monte Miseno öffnet sich die Grotta della Dragonara, ein weiteres Süßwasserreservoir mit kreuzförmigen Armen und 12 Pfeilern; daneben Überreste von Nymphäen. — Das Kap trug eine der ältesten röm. Villen: Sie gehörte zuerst dem Caius Marius, später dem Lucullus und ging dann in kaiserlichen Besitz über (hier starb i. J. 37 n. Chr. Tiberius, vgl. S. 574); Tuffbrüche, Puzzolangruben, Weinberge und neuerdings Ferienhäuser haben alle Spuren dieser Villa beseitigt.
Der Ausblick von der Spitze des Monte Miseno gehört zu den außerordentlichsten Kampaniens: Buchten und Vorgebirge, Land- und Meerengen, Halbinseln, Lagunen und Kraterseen entfalten Sich vor dem Horizont der weitgeschwungenen Küstenlinien der Golfe von Gaeta, Pozzuoli und Neapel und ihren Inseln Capri, Ischia und Procida.
Der alte Verkehrsweg von Misenum nach Cumae, von den Römern als Abzweigung der Via Domitiana ausgebaut, führt über das Dorf Cappella zur W-Küste des Vorgebirges. Unterhalb des Sattels von Baiae öffnet sich der Lago Fusaro, eine seichte, durch eine Sanddüne vom offenen Meer getrennte Lagune. Ihr Platz in der mythologischen Topographie der Phlegräischen Felder wird durch den latein. Namen Acherusia Palus (Acheron) bezeichnet. Röm. Ursprungs ist der 180 m lange, mit Retikulatwerk ausgemauerte Kanal, der das südl. Ende des Sees mit dem Meer verbindet. Auch hier wurde Fisch- und Austernzucht betrieben. An dem ebenso nahrhaften wie stillen Platz hatte sich Servilius Vatia eine Villa errichtet, die Seneca in einem Brief ausführlich beschreibt; ihre Überreste finden sich auf dem Hügel südlich der Kanalmündung bei Torregàveta.
Die Bourbonenkönige oblagen hier der Entenjagd; 1782 errichtete Carlo Vanvitelli, viell. angeregt durch einen Entwurf seines Vaters für Caserta (S. 609), für Ferdinand IV. das hübsche Casino Reale, einen Zwölfeck-Bau mit ausspringenden Seitenflügeln und ringsumlaufenden Terrassen. Für den runden Mittelsaal des Obergeschosses bestellte der König bei Philipp Hackert 4 große Bilder mit Darstellungen der Jahreszeiten in seinen liebsten Jagdrevieren: Frühling in S. Leucio, Sommer in S. Lucia bei Maddaloni, Herbst in Sorrent, Winter in Persano bei Eboli. Urspr. nur im Boot erreichbar, ist der Bau heute durch eine Holzbrücke mit dem Festland verbunden; er beherbergt ein Institut für Muschelzucht.
Die Landschaft von Cumae nimmt nicht am Leben der südwärts gewandten Küsten teil. Eine fruchtbare aber spärlich besiedelte Ebene, der schroffe Burgberg über dem flachen, nach N verlaufenden Strand, dunkle Steineichenwälder und der Horizont des Meeres bezeichnen den Schauplatz der Ereignisse, mit denen die Geschichte von Neapel ihren Anfang nimmt.
Wahrscheinl. waren es Leute aus Chalkis auf Euböa, die im Laufe des 8. Jh. von Pithekussa (Ischia) zum nahegelegenen Festland übersetzten und hier die erste kontinentale Niederlassung der Griechen gründeten; die Sage berichtet, daß ihre Anführer Hippodes und Megastenes sich durch den Flug einer von Apoll gesandten Taube leiten ließen. Den griech. Namen Kyme (lat. Cumae) bringt Strabo mit Kymata, Wellen, in Verbindung — »denn das Gestade ist rauh von Felsen und den Winden ausgesetzt, auch ist dort ein starker Fang von Seefischen«.
Die Anfänge der Stadt standen unter günstigen Vorzeichen. Der Besitz der phlegräischen Häfen, das Bündnis mit Dikaiarchia (Pozzuoli) und die Gründung von Neapolis sicherten ihr die Herrschaft über den Golf und die Ebenen Kampaniens. Von Kyme bezogen die Römer Korn, die Osker Tongefäße und Schmuck für Grabbeigaben. Das chalkidische Alphabet, griech. Religion und Kultur verbreiteten sich von hier aus über die Halbinsel. Aber schon das 6. Jh. sah Kyme in schwere Abwehrkämpfe gegen Etrusker und mit ihnen verbündete Bergvölker, zudem auch in Bürgerkriegswirren verwickelt; nach glänzenden Seesiegen über die Angreifer (524 und 474, das zweite Mal im Bündnis mit der Flotte Hierons von Syrakus) erlag die Stadt in der 2. Hälfte des 5. Jh. dem Ansturm der Samniten. Das Jahr 334 bezeichnet den Beginn der Römerherrschaft. Nachdem sie im 2. Punischen Krieg treu zu Rom gehalten und der Belagerung Hannibals (215) widerstanden hatten, erhielten die Cumäer das Bürgerrecht. Allein das Schwergewicht des aufblühenden Wirtschaftslebens verlagerte sich nach Puteoli, und Cumae wurde »eine bescheidene Kleinstadt, für ruheliebende Leute und arme Gelehrte ein passender Aufenthalt« (Nissen). Schon frühzeitig bildete sich eine Christengemeinde, welche die alten griech. Heiligtümer in Grab- und Kultstätten umwandelte. Nach dem Ende des Reiches setzten die Ostgoten unter Totila sich auf der Akropolis fest; Belisar (536) und Narses (552) eroberten und zerstörten die Festung. Weitere Verwüstungen brachte der Sarazeneneinfall von 915. Danach diente der Burgberg nur noch Piraten als Schlupfwinkel. 1207 räucherten die Neapolitaner das Räubernest aus; seitdem ist der Ort verlassen, die Felder versumpften und bildeten einen von allen gemiedenen Malariaherd.
Das Interesse der Archäologen wurde durch Zufallsfunde des 17. Jh. geweckt; auf die erste systematische Grabung von 1852 bis 1857 folgten weitere Kampagnen (1878-93, 1903, 1912) und endlich 1924-32 die umfassende Grabung A. Maiuris, die im großen und ganzen den heute sichtbaren Zustand herstellte.
Cumae
Die Akropolis erhebt sich über einem 80 m hohen Trachytfelsen, dessen Steilwände man stellenweise noch künstlich abgeglättet hat. An einigen Stellen erscheinen Reste der griech. Befestigungsmauern, die in das 5. Jh. v. Chr. datiert werden, z. T. überdeckt von röm. Mauerwerk. Den einzigen Zugang bildet die von S aufsteigende »Via Sacra«.
Auf halber Höhe zweigt rechts der Weg Zur unteren Tempelterrasse ab; am Eingang eine Inschrifttafel mit den Versen der Aeneis, die sich auf den Ort beziehen: Sie schildern den Bau des ältesten Apollo-Heiligtums von Italien als Werk des Dädalos, der mit Hilfe seines Flugapparates dem Kreterkönig Minos entkommen und auf der »chalkidischen Burg« gelandet war. Von dem Apollon-Tempel der Griechen (identifiziert nach einer 1912 gefundenen oskischen Inschrift) ist noch der Stufensockel (Stereobat) aus sauber geschnittenen quadratischen Tuffplatten erkennbar; er trug vermutl. einen nord-südlich ausgerichteten Peripteros. Reste eines noch älteren Vorgängerbaus finden sich an der O-Seite. Die Säulenstümpfe stammen aus einem Umbau der augusteischen Epoche; die Richtung der Anlage wurde damals um 90° gedreht, im O ein Pronaos vorgelegt. Ein letzter Umbau zur christl. Basilika (6./7. Jh.) kehrte zur alten N-S-Orientierung zurück. Vor dem Tempel Reste einer Exedra und einer Zisterne noch aus griech. Zeit.
Die Terrasse auf dem Berggipfel trug den sog. Jupiter-Tempel. Der Baubefund ist hier noch problematischer. Aus der Zeit der Griechen stam-
men nur einige Fundamentmauern an der W-Seite (frühestens 5. Jh. v. Chr.). Was von dem augusteischen Tempel erhalten ist, mischt sich auf schwer deutbare Weise mit den Resten einer christl. Basilika, die ins 5. oder 6. Jh. datiert wird. Das runde Stufenhecken im Bereich der alten Cella läßt sich am ehesten als Taufpiscina verstehen.
Ein einzigartiges Denkmal der griechischen Religionsgeschichte ist die Sibyllengrotte (Antro della Sibilla) am Fuß des Berges.
Der Ruf der cumäischen Sibylle, einer weissagenden Frau, der Apollon so viele Lebensjahre versprochen hatte, wie ein Klumpen Sand Körner enthält (Ovid, Metamorphosen, 14. Buch), erfüllte das ganze Altertum. Ihr wurden die Sibyllinischen Bücher zugeschrieben, die in Rom im Tempel des Jupiter Capitolinus aufbewahrt und nur auf Befehl des Senats von den Quindecim viri sacris faciundis konsultiert werden durften. Das Heiligtum der »begeisterten Seherin, die tief in der Felskluft Schickungen singt«‚ hat Vergil im 3. und 6. Buch der Aeneis beschrieben (vgl. die beiden Tafeln am Eingang der Höhle): »Ausgehauen ist zur Höhle die Wand des euböischen Felsens / einwärts führen der räumigen Gänge und Mündungen hundert / gleich oft hallen die Töne zurück: beim Spruch der Sibylle.« Im Laufe des J. Jh. n. Chr. kam der Kult zum Erlöschen; Reisende erfuhren »aus dem Mund des herumführenden Küsters die Bestätigung, daß die greise Seherin endlich von der Last des Lebens erlöst worden sei« (Nissen). Beschreibungen der Grotte sind noch aus dem 4. und 6. Jh. überliefert; ein letzter Hinweis findet sich im Reisebuch eines deutschen Malteserritters von 1632. Danach stürzten die Zugänge ein, und der Ort geriet in Vergessenheit, bis Maiuri bei den Grabungen von 1932 die sensationelle Wiederentdeckung gelang.
Der älteste Teil der Anlage läßt sich etwa ins 6./5. vorchr. Jh. datieren: es ist der »dromos«, ein aus dem Tuff gehauener gerader Gang von 131,5 m Länge, dessen trapezförmiger Querschnitt und präzise geglättete Oberfläche an kretisch-mykenische, etruskische und italische Monumente des 1. Jahrtausends erinnern (Tafel S. 465). Die ersten 25 m waren eingestürzt, der folgende Teil ist völlig intakt. Die Beleuchtung erfolgt von der Talseite durch 6 seitliche Stichgänge von gleichem Querschnitt, die ziemlich regelmäßig über die ganze Strecke verteilt sind. In der Mitte zweigen nach links 3 Nebenarme ab, die zu einem System von Wasserbehältern führen; in der Tunnelwand läuft der Zuleitungskanal, unterhalb der Abfluß. Diese Anlage scheint erst in röm. Zeit entstanden zu sein, nachdem das Orakel verstummt war; viell. wurde damals auch der Gang selbst um das untere, von senkrechten Wänden eingefaßte Stück ver-
tieft. Der Dromos mündet in einen Rechteck-Raum mit hoher gewölbter Decke und 3 rundbogigen Seitenöffnungen: geradeaus eine Nische, rechts wieder ein Lichtschacht (hier wurde in neuerer Zeit ein Eingang eingebrochen, den man jetzt wieder geschlossen hat), links ein Nebenraum, der mit Holztüren zu verschließen war; er bildete zweifellos das »adyton« (Allerheiligste), aus dem der Spruch der Sibylle tönte. Der runde Bogenschnitt deutet hier auf eine spätere Entstehungszeit (Erweiterung), viell. 3. oder 2. Jh. v. Chr.
Vor 1932 suchte man die Sibyllengrotte im Bereich der Cripta Romana, eines 180 m langen, mehrfach geknickten Ganges, der in östl. Richtung durch den Berg führt. In Wahrheit haben wir es hier wohl mit einem reinen Verkehrstunnel zu tun, der die Verbindung zwischen dem Burgbereich und der »Grotta del Cocceio« des Averner Sees herstellen sollte (vgl. S. 541). Die Ausgänge der beiden Tunnels liegen etwa in einer Achse, und es ist wahrscheinlich, daß auch die »Krypta« ein Werk des Agrippa und seines Architekten Cocceius darstellt; die Vollendung scheint allerdings erst in die augusteische Zeit zu fallen. Urspr. besaßen die Sibyllengrotte und die tiefergelegene »Krypta« ein gemeinsames Vestibül in Form einer ausgemauerten Felsenhöhle; sie wurde während der Belagerung von 552 von Narses zum Einsturz gebracht. Eine Stufenrampe im Inneren vermittelt zwischen den verschiedenen Niveaus; ein Treppenweg stellt die Verbindung zur »Via Sacra« der Akropolis her. Der Tunnel selbst ist in seinem 1. Abschnitt (26 m) rundbogig ausgemauert; es folgt ein geräumiger Rechtecksaal von 23 m Höhe (die Decke ist eingestürzt), links eine Futtermauer aus Tuffquaderwerk mit 4 großen Nischen; dann ein reiner Felsengang mit späteren Ausmauerungen. Etwa 60 m vor dem Ausgang öffnen sich rechts kolossale Höhlungen, die durch Wasserleitungen und Abzugskanäle wieder als unterirdisches Wasserreservoir gekennzeichnet werden. In frühchristl. Zeit wurde der Gang auch als Grabstätte benutzt.
Ein weiteres Denkmal röm. Ingenieurkunst ist der Arco Felice, ein Bogentor aus der Zeit Domitians, durch das die von Pozzuoli herkommende Via Domitiana in die Ebene von Cumae eintritt. Es handelt sich um einen ca. 20 m tiefen und 6 m breiten Einschnitt in den Rücken des gleichen
Monte Grillo, den Agrippa knapp 100 Jahre zuvor von Cocceius hatte unterminieren lassen. Die Felswände wurden mit Zement und Backstein abgemauert; der über der Öffnung geschlagene Brückenbogen trug einen Verbindungsweg zwischen den auf der Höhe des Berges liegenden Ländereien. Stiche des 17. Jh. zeigen noch große Teile des oberen Mauerwerks mit Nischen und Entlastungsbögen. Die Straße hat hier stellenweise das antike Pflaster bewahrt; ihr Lauf ist gesäumt von Überresten röm. Villen und Gräber.
In der Ebene zwischen dem Arco Felice und dem Burgberg finden sich verstreute Reste der Samniten- und Römerstadt (1938 und 1951-53 ausgegraben, aber nur teilweise zu besichtigen). Das Forum (am O-Ausgang der »Krypta«) war ein großer, von Portiken und Läden umgebener Platz; an seiner W-Seite lag der Tempel der kapitolinischen Trias, ein Podiumtempel von imponierenden Ausmaßen (57,4 x 28‚8 m), mit 3schiffiger Cella und tiefem Pronaos. Der Baubeginn wird ins 4. Jh. v. Chr. datiert, ein späterer Ausbau in die Kaiserzeit. Schon 1758 fand man hier den Kolossalkopf des Jupiter, der heute im Treppenhaus des Archäologischen Nationalmuseums in Neapel steht; neuerdings kamen die zugehörigen Köpfe der Juno und der Minerva oder Venus zum Vorschein. — Nördlich davon Reste eines großen Thermengebäudes des 1. oder 2. Jh. n. Chr., die hier gefundenen Statuen jetzt im Antiquario Flegreo zu Pozzuoli. — Der sog. Tempio dei Giganti östlich des Forums war ein großes öffentliches Gebäude; man erkennt noch Retikulatmauerwerk und Gewölbe. — Unklar ist die Bestimmung eines anderen Gewölbebaus östlich der Straße, der traditionell als Sepolcro della Sibilla bezeichnet wird. — Weiter im S an der Straße nach Baiae lag das Amphitheater aus dem 1. Jh. v. Chr. (man sieht noch Teile des äußeren Arkadenrings). — Das Gelände im N des Stadtgebiets enthält zahlreiche Überreste der Nekropole, deren Gräber von der Zeit der vorgriech. Ureinwohner (9. Jh. v. Chr.) bis in die Kaiserzeit reichen.
Die Via Domitiana führt weiter nordwärts durch die Bonifica di Licola, ein neuerdings trockengelegtes Sumpf- und Seengebiet. Streckenweise läuft das röm. Straßenpflaster aus polygonalen Basaltblöcken neben dem neuen Straßenzug her. Etwa 8 km nördlich von Cumae erreicht man den Lago di Patria, die Literna Palus der Alten. Über den Ausfluß des Sees führte eine von Domitian errichtete Straßenbrücke, deren Pfeiler noch im Wasser sichtbar sind (Ponte del Diavolo).
Zwischen der kurz zuvor abzweigenden Straße nach Giugliano und dem S-Ufer des Sees liegen die 1932-37 ausgegrabenen Ruinen von Liternum.
Das Städtchen wurde 194 v. Chr. gegründet und gehörte zu den Garnisonen, die nach dem Ende des 2. Fun. Krieges die kampanische Küste gegen neue Invasionen des Feindes sichern sollten. Einsam zwischen Dünen und Sümpfen gelegen, war es nach dem Zeugnis antiker Autoren ein wenig erfreulicher Ort (»ignobilis vicus«), dem auch die Anlage der Via Domitiana 95 n. Chr. nur
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Baiae. Balneum De Arcu. Aus einer illuminierten Handschrift des 13. Jh. (Rom, Biblioteca Angelica)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Cumae.
wenig Leben brachte. Allerdings war der Name Liternum mit der unvergeßlichen Gestalt des Scipio Africanus verknüpft, der hier im Kreise seiner Soldaten die letzten Lebensjahre verbrachte, nachdem die Anklagen Catos ihn aus Rom vertrieben hatten. Plinius d. Ä. und Seneca schildern sein Landgut als Beispiel für die einfachen Sitten der Vorväter: ein schlichter, mit Mauern und Türmen bewehrter Quaderbau, die Badeanlage bescheiden, kein Ausstattungsluxus. Erhalten hat sich davon nichts; auch das Grabmal des Scipio ist verschwunden, doch soll der im 10. Jh. zuerst erwähnte Name des Sees von seiner Inschrift abgeleitet sein: »Ingrata patria ne ossa quidem mea habeas«.
Die Grabungen haben das Forum ans Licht gebracht, einen an 3 Seiten von Säulenportiken umzogenen Rechteckplatz. An der W-Seite sieht man die Reste eines Podiumtempels aus dem 2. Jh. v. Chr.; später wurde die Basilika angebaut, ein 1schiffiger Breitbau mit großer Eingangstür und Halbsäulengliederung; noch jünger scheint das Theater, dessen bescheidene Ausmaße der geringen Bedeutung des Städtchens entsprechen.
Die Wohnviertel lagen in der Gegend des Seeufers und. sind heute unter Sanddünen begraben.
Der südwestlich von Neapel ins Meer vorspringende Bergrücken von Posillipo (griechisch Pausilypon, s. S. 468) bietet die berühmtesten Blicke auf Stadt und Vesuv und war jahrhundertelang das klassische Ausflugsziel der Neapolitaner. Heute sieht der Spaziergänger sich allenthalben vom Großstadtverkehr eingeholt, die Abhänge von chaotisch wuchernden Neubauvierteln bedeckt. Die wichtigsten neueren Baudenkmäler der Zone sind daher unter der Stadt Neapel besprochen worden (S. Maria della Consolazione, Palazzo Donn’Anna, Villa Doria d’Angri, Villa Rosebery); wir lassen hier eine Übersicht über die antiken Monumente folgen.
Für die Römer des 1. Jh. v. Chr. bildete der Posillip in erster Linie ein Verkehrshindernis, dem sie mit gewohnter Energie zu Leibe gingen. Der primäre Anlaß der großen Tunnelbauten war wohl ein strategischer. Jedenfalls wird ihre Anlage nach dem Zeugnis Strabos dem gleichen Cocceius verdankt, der 37 v. Chr. im Auftrag des Feldherrn Agrippa die Tunnel von Averno und Cumae bohren ließ.
Die alte Verbindung von Neapolis nach Puteoli, die Via Antiniana, lief nördlich am Vomero und Posillipo vorbei über Antignano, Soccavo, Agnano, Solfatara. An
ihre Stelle trat nun die Via Puteolana, die von Mergellina schräg durch den Berg nach Coroglio führte.
Die Grotta Vecchia oder Crypta Neapolitana (Strabo) ist ein Tunnel von ca. 705 m Länge, urspr. 4,25 m Breite und 4,5 bis 5,2 m Höhe. Sie wurde bis zum Ende des 19. Jh. als Durchfahrt benutzt; Alfons I. von Aragon, Pedro di Toledo und Karl von Bourbon hatten sie instand setzen, erweitern und tiefer ausschachten lassen. Über die Schrecken einer Durchfahrt im offenen Wagen hat Seneca in einem Reisebrief sich bitter beklagt; seine Empfindungen kann der moderne Reisende in einem der beiden neuen Tunnels (Grotta Nuova oder Galleria delle 4 Giornate von 1882 bis 1885, Galleria Laziale von 1925) nacherleben. Der alte Tunnel ist jetzt z. T. eingestürzt und kann nicht betreten werden; zu sehen ist nur der innerhalb des »Parco Virgiliano« liegende O-Eingang.
Das Gegenstück ist die sog. Grotta di Seiano. Sie führte von Coroglio durch die SW-Spitze des Kaps zur Villa Pausilypon und setzte sich viell. in einer Küstenstraße fort, die infolge bradyseismischer Senkung des Landes untergegangen ist. Der 800 m lange, 5 m breite und über 7 m hohe Tunnel wurde gegen Ende des 4. Jh. von Kaiser Honorius restauriert, später verschüttet und 1840 von Ferdinand II. aufs neue gangbar gemacht; er ist heute wieder einsturzgefährdet und daher versperrt. Sein Verlauf ist nicht ganz gradlinig; unterwegs zweigen mehrere ansteigende Seitenarme ab, die an Aussichtspunkten über der Felsenküste münden (der alte Eingang am Poggio Luculliano, S. 468).
Der Parco Virgiliano liegt am O-Abhang des Posillip hinter der Kirche S. Maria di Piedigrotta. Man geht durch die Eisenbahnunterführung und findet links vom Eingang der Galleria delle 4 Giornate ein verschlossenes Eisengitter; der Zutritt ist nur mit Sondererlaubnis des Denkmalamts gestattet, da die 1928-30 hergestellte und mit den Bäumen und Sträuchern der vergilischen Georgica bepflanzte Anlage sich heute wieder in einem Zustand hoffnungslosen Zerfalls befindet. 1939 wurde hier das wuchtige Monument für den Dichter Giacomo Leopardi errichtet, der 1837 im Alter von 39 Jahren in Neapel an der Cholera starb; rechts der bescheidene Grabstein, den sein Freund Antonio Ranieri 1844 in der Kirche S. Vitale a Fuorigrotta hatte an-
bringen lassen. — Daneben öffnet sich die Crypta Neapolitana (s. o.); an der Tunnelwand Reste mittelalterl. Fresken und röm. Grabstätten. Ein Treppenweg führt über dem Tunneleingang entlang; man kommt an der Öffnung des Serino-Aquädukts vorbei, der hier parallel zu dem Straßentunnel durch den Berg lief. Auf der anderen Seite liegt die sog. Tomba di Virgilio, ein Familiengrab (Columbarium) der augusteischen Zeit, 1928 restaur. Der alte Eingang öffnete sich zur Via Puteolana und zeigt das urspr. Niveau des Tunnelbodens. Der kubische, von einem zylindrischen Tambour bekrönte Bau enthält eine gewölbte Grabkammer mit 10 loculi für Aschenurnen; das Mauerwerk besteht aus Opus caementicium mit Retikulatverkleidung.
Eine Tradition, deren Anfänge sich im Dunkel des Mittelalters verlieren, hat an dieser Stelle das Grab des Vergil lokalisiert; ihr verdankt das bescheidene Monument seine Erhaltung inmitten einer durch die Jahrhunderte umgewälzten Umgebung. Im Werk des großen lateinischen Dichters nehmen die Landschaft Neapels und ihre Mythologie einen zentralen Platz ein. In seiner »villula« am Strand von Chiaia schrieb Vergil große Teile der »Aeneis« und das Gedicht vom Landbau: »Während Caesar am Euphrat Donner des Krieges erhob, willfährigen Völkern als Sieger Recht und Gesetze verlieh und die Bahn aufstieg zum Olympus, nährte mich, Vergilius, die holde Parthenope ...«; hier wollte er beigesetzt sein, als er auf einer Griechenlandreise erkrankte und sein Ende herannahen fühlte. Der Tod ereilte den ”jährigen in Brundisium (19 v. Chr.); Augustus sorgte dafür, daß sein letzter Wunsch in Erfüllung ging. Der Biograph Donatus gibt den Ort des Begräbnisses zwischen dem I. und 2. Meilenstein der Via Puteolana an; danach setzte man 1819 den Vergil-Tempel in die Villa Comunale zu Neapel. Schon bald nach Vergils Tode entwickelte sich eine Art literarischer Wallfahrt zu seinem Grabe (Statius, Plinius); sein treuester Bewunderer wurde der Dichter Silius Italicus, der das Anwesen mitsamt der Grabstätte erwarb und sein Leben dem Kultus des Verstorbenen weihte. Im Mittelalter lebte Vergils Andenken als das eines Magiers fort (S. 347, 454, 468), dem man neben anderen unerklärlichen Wunderwerken auch den Bau des Posillipo-Tunnels zuschrieb. Wahrscheinl. meinen die Beschreibungen des Grabmals von Petrarca (ltinerarium Syriacum) und Boccaccio (Genealogiae deorum) schon die jetzige »Tomba«; sie war geschmückt mit dem berühmten Distychon, das Donatus dem sterbenden Dichter selbst in den Mund legt: »Mantua hat mich gezeugt, Kalabrien dahingerafft, nun birgt mich Neapel. Ich besang Weiden, Äcker und Helden.« Die Paraphrase »qui cineres...« wurde 1554 von den Kanonikern der Piedigrotta-Kirche ange-
bracht; ein Anonymus des 16. Jh. fügte die Verse hinzu: »Ist das Grab geborsten, die Urne zersprungen, was tut’s? Hier ist der Name des großen Sängers genug.« Unter der südl. Steilwand des Vorgebirges liegen die Überreste röm. Seevillen; andere Teile sind mit den Uferbänken im Meer versunken. Der berühmteste Punkt der Küste ist die Bucht von Marechiaro (eigentlich Mare piano, im Dialekt Mare chiano) mit ihrem von Salvatore di Giacomo besungenen Blick über den Golf (la fenesta), erreichbar über die Via di Marechiaro von der Kreuzung auf der Höhe des Raps (Quadrivio del Capo).
Die Kirche des Fischerdörfchens, S. Maria del Faro, hat eine hübsche Stuckfassade in der Art Vaccaros. Am Platz rechter Hand Ruinen einer kaiserzeitlichen Villa mit einem Säulenstumpf, genannt Tempio della Fortuna. Die Küste besteht aus phantastisch übereinandergetürmten gelblichen Tuffmassen mit vom Meer ausgewaschenen Spalten und Grotten, überall durchwachsen von antikem Retikulat- und Backsteingemäuer. Etwa 70 m westlich der Marina ragen die Reste eines 3geschossigen röm. Gebäudes aus dem Wasser, vom Volksmund Palazzo degli Spiriti getauft.
Die S-Spitze des Kaps erreicht man von Marechiaro aus im Boot, oder zu Land vom Quadrivio del Capo (s. 0.) über die Discesa di Coroglio, dann links Via Lucrezio Caro, von dieser links abwärts über den Poggio Luculliano (Abzweigung rechts zum NW-Eingang der Grotta di Seiano, S. 466) nach der Marina di Gaiola. Auf einer der vorgelagerten Tuffklippen (Isola di Gaiola) stand im Altertum der Tempel der Venus Euploea, die den Schiffern günstige Fahrt gewährte. Rechts Überreste einer röm. Villa, die im Mittelalter als Zauberschule Vergils galt (Casa del Mago oder Scuola di Virgilio).
Die östl. Uferbank trug die Villa Pausilypon (Sorgenfrei), die dem Kap ihren Namen gegeben hat.
Ihr Erbauer P. Vedius Pollio hatte es als Sohn eines Freigelassenen zu sagenhaftem Reichtum und auch zur Ritterwürde gebracht; Augustus scheint ihm aus der Zeit der Kämpfe um den Primat verpflichtet gewesen zu sein und bewahrte dem menschlich unerfreulichen Manne seine Freundschaft, nahm auch nach Pollios Tod (15 n. Chr.) die Villa als Erbschaft an. Berühmt geworden ist die von Plinius d. J. geschilderte Szene, wie der Kaiser als Gast in Pausilypon seinen Gastgeber davon zurückhält, einen Sklaven, der ein Kristallgefäß zerbrochen hatte, den Muränen zum Fraß vorzuwerfen.
Grabungen des Architekten Guglielmo Bechi (1842) haben beträchtliche Gebäudereste freigelegt; wer die etwas mühselige Kletterpartie nicht scheut, erkennt ein großes Thea-
ter mit 17 Sitzreihen (49 m Durchmesser), ein Odeon mit 12 Sitzreihen, Thermen, Zisternen und weitere Räumlichkeiten m Retikulatmauerwerk.
Westlich der Punta di Gaiola springt das Ufer zurück und bildet die von steilen Tuffwänden eingefaßte Cala di Trentaremi; es folgt das Kap von Coroglio, der höchste Punkt des Vorgebirges. Auf seinem Rücken liegt der Parco di Posillipo (erreichbar vom Quadrivio del Capo über die Discesa di Coroglio und Via Tito Lucrezio Caro). Vom Belvedere am Rand der kolossalen Tuffklippe bietet sich ein weiter Blick über die Golfe von Neapel und Pozzuoli; unmittelbar zu Füßen des Kaps öffnet sich die Bucht von Bagnoli mit ihren Hüttenwerken: ein Höllenschlund, dessen Dämpfe allerdings künstlich erzeugt werden und mit dem phlegräischen Vulkanismus nichts zu tun haben.
Gegenüber liegt die Insel Nisida, von den Griechen Nesis, das Inselchen, gen., heute durch einen ca. 300 m langen Damm mit dem Festland verbunden. Sie besteht aus einem schief abgesunkenen Ringkrater; im SW ist die Wand eingestürzt, so daß das Innere einen natürlichen Hafen in der Form eines kreisrunden Amphitheaters bildet.
Im Altertum befand sich zudem eine in Opus pilarum erbaute Hafenmole an der NO-Seite. Aus dem Krater stiegen noch giftige Dämpfe auf; die Anhöhe war bewaldet und für ihren wilden Spargel berühmt (Statius). Als Gäste des Lucullus, dem die Insel gehörte, beschlossen hier Brutus und Cassius 44 v. Chr. die Ermordung Caesars; nach der Tat kehrte Brutus nach Nesis zurück, beriet sich mit Cicero und floh dann vor Caesars Rächern. Seine auf Nesis gebliebene Gattin Porcia tötete sich, als bei Philippi die Suche der Freiheit verloren war.
Die Gründung des Kastells auf dem höchsten Punkt des Kraterrandes geht in die letzte Zeit der angiovinischen Herrschaft zurück. Die Bourbonen benutzten es als Gefängnis; heute dient es als Jugendbesserungsanstalt.
Das 1582 gegründete Kamaldulenserkloster liegt auf einer Bergkuppe nordwestlich von Neapel (Zufahrt vom Vomero über Antignano oder von Capodimonte über den aussichts-
reichen Viale Colli Aminei, der westlich des Schlosses von der Via di Miano abzweigt). Besondere Kunsteindrücke werden nicht geboten, dafür zählt der Rundblick zu den größten Sehenswürdigkeiten des Golfes.
Die Kirche S. Maria Scala Coeli ist ein einfacher Saal mit tiefen Seitenkapellen und quadratischem Presbyterium. Das Abendmahlsbild an der Eingangswand stammt von Massimo Stanzione, das Deckengemälde (Gloria des hl. Romualdus) von Ang. Mozillo, 1792; an den Wänden Heilige und Selige des Kamaldulenserordens von Antiveduto Gramatica. Vom gleichen Maler die Bilder in der Apsis. 2. Seitenkapelle links: Hl. Familie in der Art des Luca Giordano; 3. Seitenkapelle links: Assunta von Cesare Fracanzano.
Ein Türchen rechts der Kirche führt in den Klosterbezirk mit der berühmten Aussichtsterrasse (Belvedere dei Camaldoli). Damen sind nicht zugelassen; als Trost bietet sich der Spaziergang zum Belvedere Pagliarella an (Fußweg rechts vor dem Eingang zum Konvent), der ziemlich das gleiche Panorama gewährt. Der Blick auf Neapel ist durch den Höhenzug von S. Elmo teilweise verdeckt; dahinter erscheinen der Vesuv und die weitgeschwungene Küstenlinie des Golfes bis nach Sorrent und Capri. Im Vordergrund der ins Meer vorspringende Rücken des Posillipo mit dem Inselchen Nisida; westlich davon das Becken von Pozzuoli, die Landenge von Baiae und das Kap Misenum, dahinter Procida und Ischia. Von besonderem Interesse ist der Blick auf die Phlegräischen Felder, deren Kraterlandschaft sich hier wie in einem Luftbild darstellt: »Alte und neue Berge, ausgebrannte und brennende Vulkane, alte und neue Städte, Elysium und die Hölle — alles dieses fassest Du mit Deinem Auge, ehe Du hier eine Zeile liesest«, schreibt der Spaziergänger J. G. Seume, der diesen Aussichtsplatz zum »vielleicht schönsten Punkt in ganz Italien« erklärte. Bei klarem Wetter erscheinen am westl. Horizont die Pontinischen Inseln, im NW die Monti Aurunci, der Golf von Gaeta und das Kap Circeo.
Wir fassen unter dieser Bezeichnung die Orte der östl.
Golfküste zwischen Neapel und Torre Annunziata zusammen. Sie bilden heute eine einzige Masse von Häusern und
Baustellen, in der sich die alten Stadtkerne kaum mehr abheben. Als eigentliche Sehenswürdigkeiten dieser Zone gelten mit Recht die wieder ans Licht gekommenen antiken Städte Pompei und Herculaneum (s. u.).
Der Beginn ihrer Ausgrabung fällt mit der zweiten Blütezeit des Küstenstrichs zusammen: Seit Anfang des 18. Jh. schuf das neapolitan. Patriziat sich hier eine »villeggiatura«, deren Paläste Gärten und Lusthäuser zu den reichsten des damaligen Europa zählten. Der bevorzugte Baugrund war das sanft abfallende Gelände zwischen der von Ort zu Ort laufenden »Via Regia« und dem Meeresstrand. An der Straße wurde ein Palast errichtet, meist ein 2geschossiger Breitbau; die dem Meer zugewandte Rückseite war in Portiken und Aussichtsterrassen geöffnet, wie sie sich ähnlich schon in antiken Bauten der Zone finden (Herculaneum, Stabiae); womöglich stiegen weitere Terrassen und Gartenparterres bis zum Wasser hinab. Wie in den gleichzeitigen neapolitan. Stadtpalästen lag ein besonderer Akzent auf der Entwicklung der Treppen: vom Zwang des Hochbaus auf engen Grundstücken befreit, verbinden sie sich hier aufs glücklichste mit geräumigen Vestibülen, Terrassen und offenen Gartenhöfen. Die dem Berg zugewandten Haus-oder Gartenmauern trugen irgendwo eine Statue oder Büste des S. Gennaro, der im Falle eines Vesuv-Ausbruchs die Lavamassen zum Stillstand zu bringen hatte. Gegen die alles überschwemmende Woge der modernen Bauspekulation ist leider kein entsprechender Beistand gefunden worden; so sind mit der weitesten, freiesten und fruchtbarsten Landschaft des Golfes auch ihre barocken Baudenkmäler verschwunden oder unwiederbringlich beschädigt worden, und man muß heute erhebliche Mühe aufwenden, um wenigstens die verfallenen Überreste aufzuspüren. 1959 hat eine Gruppe neapolitan. Architekten unter Führung Roberto Panes den »Ville Vesuviane del Settecento« eine ausführliche Studie gewidmet; wir entnehmen ihr im folgenden einige Angaben über Monumente, deren gegenwärtige Verfassung und Zugänglichkeit wir nicht in allen Fällen beurteilen können.
Die alte Via della Marinella verläßt am Ponte della Maddalena (S. 328) Neapel und durchläuft die wüste Vorstadt S. Giovanni a Teduccio (lat.
Thudicium, wahrscheinl. von Theodosius).
Ein Stück landeinwärts liegt der Ort Barra; an seinem SO-Ausgang (Via S. Nicandro 68) die Villa de Gregorio di S. Elia, noch im Besitz der Familie und leidlich erhalten, mit großem 3geschossigem Palazzo und weitläufigem Park, 1761 angelegt, 1866 restaur. — In der gleichen Gegend (Via Bisignano) die Villa Bisignano, schon im 17. Jh. für den flämischen Bankier Gaspare Roomer erbaut, nach Beschädigung durch einen Vesuv-Ausbruch 1776 von Luigi Sanseverino, Principe di Bisignano, umgebaut; großer, mit einem Aussichtsturm bekrönter Palazzo mit Loggien-
hof. — Auf dem Wege nach S. Giorgio a Cremano (Via Botteghette) die ganz heruntergekommene Villa Pignatelli di Monteleone, mit reizvollem Treppenhaus und Gartengebäuden, viell. ein Werk Sanfelices.
Der Villenbezirk setzt sich nach dem östlich angrenzenden S. Giorgio a Cremano fort. Am Largo dell’Arso 4 steht der Palast der Villa Pignatelli di Montecalvo, ehemals eine der großartigsten der Gegend, heute gänzlich ruiniert; stilistisch ohne weiteres Sanfelice zuzuweisen. Hinter der 2-geschossigen Rokoko-Fassade mit großer Pilasterordnung, Diamantquaderportal, zierlichen Gitterbalkons und auf- und abschwingenden Gesimslinien entfaltet sich ein höchst geistreiches Ineinanderspiel von Innen- und Außenraum; man betritt zunächst ein großes ovales Atrium mit seitlich abgehenden Halbtreppen und nach innen gerichteten Balkonfenstern; dann einen Portikus, unter dem große Treppenläufe aufsteigen, die sich in die Seitenflügel und Terrassen des Hofes verzweigen. Im Obergeschoß über dem Vestibül ein Ovalsaal mit Blick zum Meer und zum Vesuv.
Eine lange Reihe von Settecento-Villen, meist im 19. Jh. restaur. oder umgebaut, liegt an der Via Pessina. Zur Villa Caracciolo di Avellino (Nr. 4-8) gehörte die um die Mitte des 18. Jh. erbaute Cappella dell’Addolorata (heute Pfarrkirche); außen übel zugerichtet, das Innere ein Rechtecksaal mit abgeschrägten Ecken und hohem Muldengewölbe, etwa in der Art D. A. Vaccaros, fabelhaft reich in Holz und Stuck dekoriert. — Villa Cariati, jetzt Cerbone (Via Pessina 22) hat im Inneren eine hübsche elliptische Doppeltreppe des 18. Jh. — Ein durch 3 Stockwerke gehendes Treppenhaus a la Sanfelice (gegenläufige Rampen über leicht ausschwingendem Grundriß) hat die Villa Lignola (Via G. A. Galante 2), beg. 1742.
Etwa im Zentrum des Ortes (Corso Roma 47) liegt die Villa Aquino di Caramanico, heute Vannucchi. Kurz vor 1775 entstanden, war sie nach dem Palazzo Reale von Portici die größte Villa der vesuvianischen Küste. Der mächtige Palazzo, 3geschossig, ist etwa im Stil Fugas mit Kolossalpilastern gegliedert; innen ein Pfeilervestibül; die Hofwände haben eckig gebrochene Flügel mit Loggien und Bogenfenstern. Von der polygonalen Exedra der Hofrückwand führte ein gerader Weg zu einem großen Brunnenplatz; von dort strahlten 14 Radialwege aus, durch verschlungene Ringwege miteinander verbunden.
Weitere, z. T. sehr schöne Villen des 18. und frühen 19. Jh. an der Via Cavalli di bronzo und anderen Straßen des Viertels.
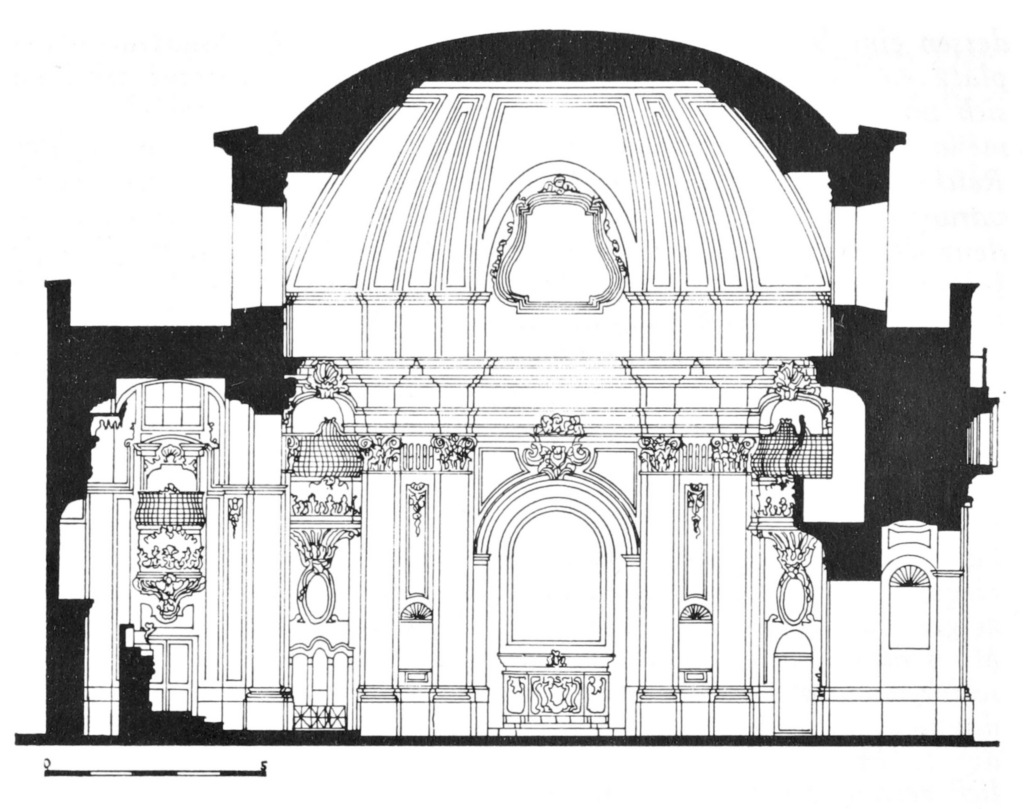 S. Giorgio a Cremano. Cappella dell’Addolorata, Schnitt (zum Text auf
S. Giorgio a Cremano. Cappella dell’Addolorata, Schnitt (zum Text auf
Das Städtchen wird 728 zuerst erwähnt. Es war ein Lehen der Caracciolo, später der Carafa. Der alte Stadtkern wurde beim Vesuv-Ausbruch von 1631 zerstört.
Die Hauptkirche an der Piazza S. Ciro ist der S. Maria della Natività geweiht; der Bau stammt von 1642, Kuppel und Innendekoration wurden 1740 hinzugefügt, 1750 die Doppelturm-Fassade (1929 erneuert). Das Hochaltarbild (Mariengeburt) stammt von Luca Giordano.
Palazzo Reale (am O-Ausgang des Ortes)
Der Palast wurde nach einem Entwurf des röm. Architekten Antonio Canevari 1738-52 errichtet. König Karl von Bourbon lernte Portici im Mai 1737 durch einen Besuch beim Fürsten Elboeuf kennen und war von dem Ort so angetan, daß er sogleich die Errichtung eines »sito reale« anordnete. Noch im selben Jahr wurde eine Anzahl von Grundstücken angekauft und ein umfangreicher Wildpark eingerichtet; das Gelände erstreckte sich bis ans Meer, so daß auch zum Fischfang Gelegenheit war. Auf die vom Vesuv her drohenden Gefahren aufmerksam gemacht, erklärte Karl sein Vertrauen auf Gott, die Maria Immacolata und S. Gennaro, holte allerdings auch ein wissenschaftliches Gutachten ein, auf Grund
dessen eine leichte Bodenerhebung am O-Rand der Stadt als Bauplatz ausgewählt wurde. Der König und sein Architekt scheinen sich nicht daran gestört zu haben, daß die von Neapel herkommende Straße nach Kalabrien — die wichtigste Fernverbindung des Reiches — mitten durch den Schloßhof führte. Der Bau ging rasch voran und gedieh in wenigen Jahren zur bestausgestatteten Residenz des Hofes. Auf die Einrichtung der Räume wurde viel Sorgfalt verwandt; ihr Glanzstück war das Porzellankabinett, das man im 19. Jh. nach Capodimonte brachte (S. 424). Mit den seit 1738 in Herculaneum ausgegrabenen Gegenständen wurde im Schloß ein Museum eingerichtet, das in der Welt nicht seinesgleichen hatte und Portici für lange Zeit zum Mekka der Antikenkenner machte. Allerdings hatten von auswärts kommende Gelehrte wie Winckelmann (1758) ziemliche Mühe, in die von eifersüchtigen neapolitan. Kollegen gehütete Festung einzudringen; Goethe fand sich 1787 »wohl empfohlen und wohl empfangen«‚ doch war auch ihm »irgendetwas aufzuzeichnen nicht erlaubt«; er mußte »dem Vorzeiger von Zimmer zu Zimmer folgen und haschte, wie es der Moment erlaubte, Ergötzung und Belehrung weg so gut es sich schicken mochte.« Nach dem Baubeginn von Caserta (1752) erfuhr das noch nicht ganz vollendete Schloß keine Förderung mehr. In der 1. Hälfte des 19. Jh. wurden die Räumlichkeiten verschiedentlich restauriert und neu ausgestattet. 1860 gelangten Palast und Park in Staatsbesitz und begannen sogleich zu verfallen; die schon beschlossene Aufteilung in Baulose wurde im letzten Augenblick durch die Stadt Neapel abgewendet, die hier die Agronomische Fakultät der Universität unterbrachte (1872).
Canevaris Architektur ist nicht kleinlich, hält aber keinen Vergleich mit der der Privatvillen aus, deren Bauherren und Architekten mit ganz anderer Liebe zu Werke gingen.
Der Straßenhof, von der Grundform eines gestreckten Rechtecks mit abgeschrägten Ecken, teilt den Bau in 2 Hälften (Palazzo superiore und inferiore). An die 3geschossigen Hauptcorps schließen sich jeweils weitläufige niedrige Flügelbauten; als Gliederungsmotive treten Risalite und sparsam verteilte Kolossalpilaster auf, die Einzelformen sind von spartanischer Nüchternheit. Durch jeden der beiden Paläste führt in der Querachse ein großes Pfeilervestibül von 3 x 3 Jochen; das südliche (dem Meer zugewandte) öffnet sich auf eine weite Aussichtsterrasse mit halbrund vortretender Exedra und in weitem Bogen ausgreifenden Flügeln, die das untere Gartenparterre umfassen; 2 halbrunde Rampen steigen von der Exedra in den Garten hinab. An den Bau einer Palastkapelle scheint man zunächst gar nicht gedacht zu haben; 1749 wurde das im
oberen Palast angelegte Theater zur Kirche umgebaut. Der mit einem großen Säulenapparat dekorierte Eingang befindet sich unter der von Portici herkommenden Straßendurchfahrt links; innen ein hübscher oktogonaler Zentralraum, als Presbyterium dient das querrechteckige ehem. Bühnenhaus.
Der ausgedehnte Park, in der oberen Hälfte von der Ferrovia Circumvesuviana durchschnitten, hat noch große Teile seines alten Baumbestandes, außerdem einige Brunnen und Gartenarchitekturen aus der 2. Hälfte des 18. Jh.; besonders hübsch ein 2geschossiger Pavillon im pompeianischen Stil, neben dem von einer Mauer eingefaßten Ballspielplatz (gioco del pallone). In der Nähe befand sich eine berühmte Menagerie mit exotischen Tieren; im unteren Garten große Fischbecken, in denen sogar Delphine gehalten wurden.
Die bekannteste der zahlreichen Privatvillen von Portici war die Villa d’Elboeuf, in der Nähe des Hafens, im 19. Jh. verschiedentlich umgebaut, aufgestockt und durch die unmittelbar neben dem Palast entlanggeführte Bahnlinie ruiniert. Der 1. Bau wurde 1711 von Sanfelice für Emanuele Maurizio di Lorena, Fürsten von Elboeuf, errichtet, der als erster auf die Ruinen von Herculaneum gestoßen war und hier seine Fundstücke versammelte. Seit 1742 bildete die Villa einen Teil des königlichen Besitzes. Von der Architektur Sanfelices sind nur noch die Portale und die rückwärts zum Strand hinablaufenden Treppenanlagen zu sehen; sehr reizvoll die Überreste des »bagno della Regina«, eines kleinen ummauerten Badeplatzes mit Bootshafen aus der Zeit Ferdinands IV., seltenes Beispiel einer maritimen Architektur der Neuzeit.
Die wichtigste Villenstraße ist der Corso Garibaldi; wir heben hervor: Nr. 125, Villa Menna, 1742 von Muzio Nauclerio für die Familie d’Amendola errichtet, ein prächtiger Breitbau mit üppig stuckiertem Vestibül und reich gegliederten Treppenhäusern; der Hof wie üblich von Aussichtsterrassen flankiert und offen zu den Gärten, die sich bis zum Strand hinabzogen; dort nochmals eine schöne Freitreppenanlage (jetzt durch die Eisenbahn und eine Badeanstalt verdorben). — Nr. 189, Villa Buono oder »La Riccia«, um 1750 für Bartolomeo di Capua, Fürsten von Riccia, erbaut. Der Palast im 19. Jh. verändert, die einstmals berühmten Gärten verschwunden; dafür hat sich (auf der gegenüberliegenden Straßenseite) die hübsche Kapelle erhalten: polygonal vortretende Außenfassade, innen ein Rechtecksaal mit Muldengewölbe und sehr feinem Stuckdekor. — Nr. 237, Villa Lauro-Lancellotti von
Pompeo Schiantarelli, eine der interessantesten Architekturen der 2. Jahrhunderthälfte, ganz unabhängig vom konventionellen Spätbarock der Fuga- und Vanvitelli-Schule.
Die Palastfassade hat 9 in Dreiergruppen zusammengefaßte Achsen mit formenreicher Rustikagliederung; ein tiefes Pfeilervestibül führt durch das ganze Erdgeschoß; der Hof ist von niedrigeren Seitenflügeln mit Terrassen und Freitreppen eingefaßt; die Tiefenachse des Gartens endet in einer weiteren Terrassen-und Treppenanlage mit offenem Belvedere.
Von der Villa Meola (Via Marconi 51), lt. Inschr. 1742 entstanden, hat sich glücklicherweise der Hof mit einem der phantasievollsten Treppenhäuser des Küstengebietes erhalten. — Eine 1754 für Giuseppe Lecce erbaute Villa (Via Gravina 12, heute Collegio Landriani) hat gleichfalls ein hübsches offenes Treppenhaus und eine wohlerhaltene Kapelle.
Unmittelbar ostwärts des Palazzo Reale von Portici beginnt Resina. Das von wimmelndem Leben erfüllte Städtchen steht auf der Lava von 79 n. Chr., über den Häusern von Herculaneum, und soll noch in antiker Zeit gegründet worden sein.
Der obere Ortsteil heißt Pugliano, nach der Kirche S. Maria a Pugliano; ihre Entstehung wird auf Petrus zurückgeführt, der auf der Flucht von Rom in Resina gelandet sein und hier eine Anzahl Heiden bekehrt haben soll, darunter einen gewissen Apellone oder Apelluna. Der heutige Bau, eine weitläufige Kuppelbasilika, wurde im 16. Jh. gegründet, im 18. und 19. Jh. erweitert und umgebaut; hübsche Sakristei von 1716.
Die wichtigsten Settecento-Villen von Resina sind: Villa Caravita (Maltese) von D. A. Vaccaro, um 1900 umgebaut; spärliche Überreste am Corso Garibaldi 112. — Villa Signorini (Cirella; Via Roma 31), aus der Mitte des 18. Jh.; hübsche 2geschossige Fassade mit Lisenengliederung, lebhaft stuckierten Fensterrahmen und geschweiften Gitterbalkons; an der Rückfront das traditionelle Terrassenmotiv und ein noch wohlerhaltener Garten, darin 2 Pavillons mit bunten Majolikakuppeln. — Villa Passaro (Via A. Consiglio 22), etwa aus der gleichen Zeit: 3geschossiger Palazzo, dahinter ein großer Hof mit flachbogigen Loggien und einer Exedra mit großer Treppenanlage, die zum Garten hinaufführt. — Gegenüber die Villa Consiglio, weitgehend umgebaut und zerstört; der Blick vom Hof zum Meer geht durch 3 große offene Bögen. — Villa Signorini (Granito di Belmonte; Corso Ercolano 11): Zwischen 2 Höfen liegt ein offenes Treppenhaus mit Durchblick zum Meer; es folgt wieder eine Exedra mit Freitreppe und Gartenanlage, alles mehr oder weniger verwüstet und durch Umbauten entstellt. — Palazzo Correale (Corso Ercolano 59): die schöne Fassade im 19. Jh. aufgestockt, der Hof leidlich erhalten. — Im Palazzo Tarascone (gegenüber) eine sehr feine Hofarchitektur über oktogonalem Grundriß, im Stil Sanfelices.
Von Resina nach Torre del Greco erstreckt sich der Miglio d’Oro (die Goldene Meile), ein etwa 2 km langes, schnurgerades Stück Küstenstraße, an der sich die berühmtesten Gärten und Lustvillen der Bourbonenzeit reihten; auch sie sind heute, soweit überhaupt noch vorhanden, von einer amorphen Masse städtischer Neubauten erstickt. Den Anfang macht Villa Aprile (Riario Sforza; Corso Ercolano 278); der jetzige Zustand wesentlich durch einen Umbau des frühen 19. Jh. bestimmt. Es folgt Villa Durante, ein Bau Sanfelices, mit hübscher Stuckfassade (im 19. Jh. aufgestockt), Kapelle und Treppenhaus.
Die beiden folgenden Bauten, nach der Mitte des 18. Jh. entstanden, repräsentieren großartig das Villenideal der »strengen« Richtung des neapolitan. Spätbarock.
Villa Campolieto
Ein Hauptwerk Luigi Vanvitellis, gegen Ende der 1760er Jahre für die Familie Casacalenda erbaut.
 Resina. Villa Campolieto. Schnitt
Resina. Villa Campolieto. Schnitt
Wie an deren etwa gleichzeitig entstandenem Stadtpalast in Neapel hatte Vanvitelli auch hier ein von Gioffredo begonnenes Unternehmen fortzuführen. An der Straße erhebt sich wie üblich ein kompakter Palastblock mit
2 Ordnungen, bekrönt von einer Attika-Balustrade. Durchlaufende horizontale Quaderfugen kennzeichnen das Untergeschoß als Sockel; die 7 Fensterachsen sind rhythmisch gruppiert, Zwillingspilaster und flache Risalitbildungen beleben die Fläche; in der Mittelachse öffnet sich unten das rahmenlose Bogenportal, darüber erscheint als eigentliches Zentralmotiv ein vertieftes Wandfeld mit einer rundbogigen Balkontür zwischen eingestellten Säulen. — Anstelle des Binnenhofes entwickelt sich im Inneren des Blocks eine reich gegliederte Vestibülarchitektur mit Pilastern, Wandsäulen und leicht gedrückten Tonnen-und Kreuzgewölben, das Ganze eine konzentrierte Fassung der großen Komposition von Caserta. Der in die Tiefe gestreckte Hauptraum wird im Zentrum von einer Querachse durchkreuzt: rechts Öffnet sich ein Austritt in den Garten, die verfallenen Reste eines Nymphäums bilden den Point de vue; zur Linken steigt die prachtvolle 3-Rampen-Treppe auf. Sie mündet im Piano nobile in einen Apsidensaal, der — wie in Caserta — dem darunterliegenden Vestibülraum entspricht; über ihm wölbt sich, als pathetischstes Motiv des Villenbaus (Palladios »Rotonda«), eine Pendentifkuppel mit 4 großen in die Kalotte geschnittenen Ovalfenstern. Die draußen angegebene dorisch-ionische Geschoßordnung setzt sich im Inneren fort; dazu kommen Putzrahmen, Nischen, Festons und Kassetten, alles würdig und monumental. — Einige Räume haben Spuren der alten Ausstattung bewahrt. Sehr reizvoll der ehem. Speisesaal, mit ausgerundeten Ecken und Nischen gegliedert; die Freskodekoration gibt das Bild einer Gartenlaube mit Ausblicken in eine weite, von Damen und Herren im Rokoko-Kostüm belebte Landschaft (Porträts des Bauherrn und des Architekten).
Die Rückfront des Baues wird durch einen gestuften Terrassentrakt vor dem Erdgeschoß etwas aufgelockert. Das zentrale Bogenmotiv der Eingangsfassade wiederholt sich; weitere Bögen auf Säulen erscheinen in den Nebenachsen des Untergeschosses, diesmal mit volutenartig eingerollten Archivolten: Vanvitelli scheint an dieser Stelle eine gewisse Verpflichtung zur Ausgelassenheit empfunden zu haben. — Das traditionelle Motiv der dem Meer zugewandten Aussichtsterrasse hat hier eine ganz neue Form gefunden: An die Stelle der vorspringenden Seitenflügel ist ein offener Portikus über hufeisenförmig aus-
schwingendem Grundriß getreten; seine luftige Bogenfolge auf Säulen (innen) und Pfeilern (außen) gewährte die vielfältigsten Durchblicke in den Garten und bot zugleich einen schattigen Wandelgang für heiße Sommertage. Der heutige Zustand des Ganzen ist allerdings bejammernswert.
Villa Favorita (heute Militärinstitut)
Von Ferdinando Fuga für Stefano Ruggiero Gravina, Fürsten von Jaci und Campofiorito, erbaut oder aus einem etwas älteren Vorgängerbau erweitert. 1768 gab der Fürst ein glanzvolles Einweihungsfest zu Ehren der Gemahlin König Ferdinands IV., Maria Karolina von Österreich, die hier einen Ersatz für das Schloß Schönbrunn finden sollte. Seit dem Tode Gravinas war die Villa königlicher Besitz.
Der zur Straße gewandte Fassadentrakt ist stark in die Breite gedehnt: 11 Achsen in vielfältig wechselndem Rhythmus, durch 2 Ordnungen von Lisenen gegliedert, bilden einen imposanten und zugleich fein bewegten Prospekt; die gerundeten Flanken, das Spiel der Rahmungen und Verkröpfungen und die schwingenden Gitterbalkons zeigen den unfehlbaren dekorativen Geschmack des Florentiners. Einen besonderen Akzent setzen die wechselnden Geschoßhöhen im Bereich der unteren Ordnung, die sich in der Disposition der Balkons zu erkennen geben. Sie mögen durch den Vorgängerbau oder auch durch die leichte Hanglage des Gebäudes bedingt sein, haben aber jedenfalls Fuga zu einer sehr geistvollen Raumfolge inspiriert. Die Mittelachse wird durch 2 prachtvolle Fensterädikulen eingenommen, hinter denen die Hauptsäle des Palastes liegen; die Portale sind in die 2. und 9. Achse hinausgerückt, über ihnen erscheinen volutengerahmte Mezzaninfenster. jede der beiden Torfahrten führt in einen geräumigen Hof. Die Rückfront des Baues zieht sich in mehreren Einsprüngen auf ein 5achsiges Mittelcorps zusammen. Davor liegen eine Terrasse und ein großes halbrundes Treppenpodest: Man fuhr hier mit der Kutsche vor, stieg die Treppe hinauf und gelangte über eine querrechteckige Antisala in den Hauptsaal, der sich in Form einer langgestreckten Ellipse durch das ganze Mittelcorps zieht (hier war der berühmte Marmorboden aus Capri verlegt, der sich heute in Capodimonte befindet). Dieser Saal entspricht etwa dem Straßenniveau, die seitlich anschließenden Räume jedoch sind etwas höher gelegen: Man steigt über breite Treppen in der
Resina.
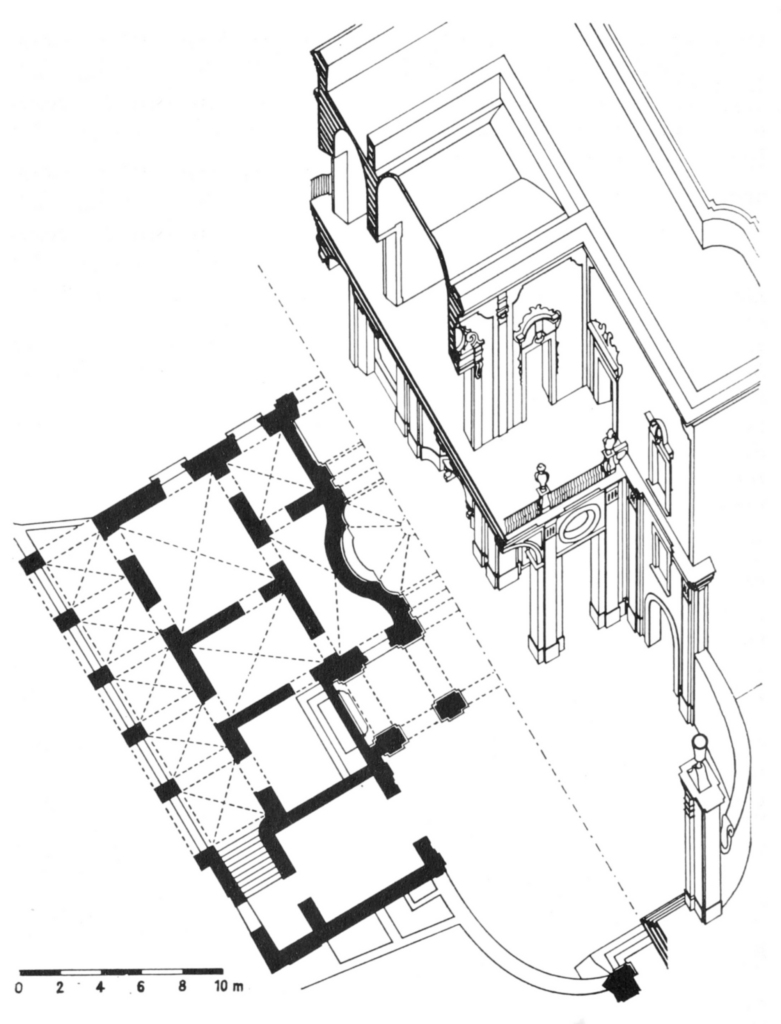 Villa Ruggiero, Schnitt (zum Text auf
Villa Ruggiero, Schnitt (zum Text auf
Querachse des Ovals (oder über Nebentreppen von der Antisala aus) in die anderen Säle hinauf. — Die ins Obergeschoß führenden Treppenhäuser sind in die Enden des Straßentraktes verlegt; das linke ist als große offene Spindeltreppe im Stil Sanfelices ausgebildet.
Ein riesiger Garten mit zahlreichen Nebengebäuden, Gästehäusern, Stallungen, Pavillons und Belvedere zog sich bis zum Strand hinab.
Ein Stück weiter östlich zweigt links vom »Miglio d’Oro« die Via A. Rosi ab; hier liegt (Nr. 26) die kleine und feine Villa Ruggiero (Petti), mit 2geschossiger Straßenfassade, großem Vestibül, Hofportikus, darüber Terrasse zwischen vorspringenden Seitenflügeln, Exedramauer mit Gartentor; das Ganze nicht weit vom Stil Fugas entfernt. — An die Hauptstraße zurückgekehrt, findet man rechts als Überrest der Villa Sorge die Cappella di S. Maria del Pilar, einen gestreckten Saalbau mit Chorkuppel und fabelhaft reichem Stuckdekor aus der Mitte des 18. Jh.
Der Ort ist seit dem 6. Jh. bekannt; Kaiser Friedrich II. erbaute hier die Turris Octava, d. h. den achten einer Reihe von Befestigungstürmen zum Schutz gegen die Sarazenen; im 14. Jh. kam der heutige Name des Städtchens auf. Wie Portici war es im Mittelalter Lehnsgut der Familien Caracciolo und Carafa, 1699 wurde es selbständig. Der Wappenspruch »post fata resurgo« deutet auf die periodischen Zerstörungen durch den Vesuv (dessen Kraterrand hier nur 6 lern von der Küste entfernt ist); vernichtend waren die Ausbrüche von 1631, 1794 und 1861.
1794 wurde die Hauptkirche S. Croce (Piazza S. Croce) bis auf den Campanile des 17. Jh. zerstört, 1797-1827 in klassizist. Formen Wiederaufgebaut.
Auch zahlreiche am Vesuv-Hang gelegene Villen des 18. Jh. wurden damals unter den Lavamassen begraben.
Links der Hauptstraße am südöstl. Ortsausgang liegt die Villa del Cardinale (Via Nazionale 122, heute Priesterseminar), 1744 für Gennaro de Laurentis erbaut, 2 Jahre später vom Kardinalerzbischof Giuseppe Spinelli gekauft und seitdem Sommersitz der neapolitan. Kirchenfürsten.
Der Gebäudetypus entspricht dem der Villa Ruggiero-Petti (s. o.), ist aber bereichert durch eine schöne symmetrische Doppeltreppe, die unter dem Hofportikus nach den Seitenflügeln aufsteigt. Reicher Stuckdekor an der 7achsigen Fassade und der Exedramauer des Hofes. — Der große Mittelsaal des Obergeschosses hat noch Freskodekorationen des 18. Jh., mit pompösen Scheinarchitekturen; im Garten Reste von Treppen, Nischen und ausgetrockneten Brunnen.
Ein ganz exquisiter Bau ist Villa Palomba (Via Nazionale 101), lt. Wappeninschrift 1742 für eine Familie del Gallo errichtet. Die Fassade ist von den Flanken zur Mitte hin stufenweise erhöht, die Fenster des Mittelcorps sind in kompliziertem Rhythmus gegeneinander versetzt (unten 3, oben 4 Achsen); die Gliederung bilden große Lisenen.
Putzrahmenfelder und Stuckornamentik von erlesener Delikatesse. — Im Inneren eines der witzigsten Treppenhäuser der Küste.
Die Villa Aurisicchio (Via Nazionale 352) lag inmitten eines bourbonischen Jagdreviers und wurde von einem Jagdaufseher erbaut, der sich schmeichelte, seinen königlichen Herrn als Gast bei sich aufnehmen zu können, wozu allerdings selbst der populäre Ferdinand IV. sich nicht herbeiließ.
Die Villen an der Seeseite liegen hier in Gärten versteckt; an der Straße stehen aufwendige Portalbauten, ein langer Weg führt auf den Palazzo zu und setzt sich hinter ihm zum Strand hin fort. Diesem Typ folgt u. a. die Villa Bruno, ehem. Prota (Via Nazionale 401); die Hauptgebäude hier um einen rechteckigen Hof gruppiert, der im 19. Jh. verbaut wurde; zum Meer hin entwickeln sich weit ausgedehnte Terrassen.
Villa Prota (Via Nazionale 521) ist aus einem Bau des 16. Jh. hervorgegangen, dessen Spuren an der Rückfront des Palastes noch zu erkennen sind. Ein singuläres Motiv bildet die Aussichtsterrasse des etwas niedrig gelegenen, daher auf 3 Geschosse gebrachten Gebäudes: Das oberste Stockwerk ist in 2 Flügel geteilt; zwischen ihnen sitzt in der Fassadenwand ein offener Ädikularahmen mit geschweiftem Kontur; von der dahinter liegenden Plattform genießt man den Ausblick aufs Meer wie auf den Vesuv.
Schon zum Bereich von Torre Annunziata gehören die bescheidene Villa Caramiella und die Villa del Salvatore, heute in kirchlichem Besitz, mit feiner Stuckfassade (Via Nazionale 543 und 798).
Der Hauptreiz dieser ausgedehnten Industriestadt besteht in ihrer landschaftlichen Position. Der Ort entstand auf den Ruinen einer antiken Stadt (viell. des aus der »Tabula Peutingeriana« bekannte Oplonti) am eine 1319 gegründete Annunziata-Kapelle; der Sarazenenturm, der ihm den Namen gab, wurde um die Mitte des 15. Jh. von Ugone de Alagno erbaut.
Auf einem Lavahügel am Fuß des Vesuv zwischen Torre del Greco und Torre Annunziata (nördl. der Bahnlinie und der Autostraße) liegt weithin sichtbar der Convento dei Camaldoli della Torre (heute Colle S. Alfonso), ein 1602 gegr. Kamaldulenserkloster, seit 1954 im Besitz der Red-
emptoristen, und von diesen gründlich restauriert. Die Kirche, von 1741, ist ein großer weiß ausstuckierter Kapellensaal mit Vierungskuppel; ein hübsches Motiv ist die konkave Ausrundung der Vierungspfeiler, der eine Konvexbewegung der Querhauskapellen antwortet. — Von der Terrasse bietet sich die klassische Golfansicht der vesuvianischen Küste: Neapel und die phlegräischen Hügel im N, die Monti Lattari im S bilden den Rahmen, Ischia und Capri liegen symmetrisch einander gegenüber; dazwischen dehnt sich der Horizont des Meeres.
Die italische Stadt Herculaneum, die von griech. Schriftstellern Herakleion genannt wird, scheint unter dem Einfluß der nur 8 km nordwestlich gelegenen, bedeutenden griech. Siedlung Neapel entstanden zu sein. Der freigelegte Teil der Stadt zeigt dasselbe Straßensystem wie Neapel. Der Sage nach soll Herculaneum vom mythischen Helden Herakles auf seiner Rückkehr von Spanien gegründet worden sein. So erklärt sich auch sein Name. Beim Schwinden des griech. Einflusses am Golf von Neapel gegen Ende des 5. Jh. v. Chr. kam Herculaneum unter die Vorherrschaft der mittelitalischen Samniten. Nach deren Niederwerfung durch die Römer im 3. Jh. v. Chr. gehörte es wie Pompei und Stabiae dem Städtebund südlich des Vesuvs an, dessen einzelne Gemeinden mit Rom Bündnisverträge hatten. Herculaneum nahm später am Bundesgenossenkrieg gegen Rom teil, wurde 89 v. Chr. von Titus Didius belagert und erobert und lebte als röm. Municipium weiter. Seine Umgebung wurde bevorzugter Villenort der stadtröm. Nobilität. Eine dieser Villen, die sog. Villa dei Papiri, wurde im 18. Jh. entdeckt und durch unterirdische Stollen erforscht. Die gefundenen Gegenstände, 7). a. die beachtlichen Bronzeskulpturen, befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel.
Die Lage der antiken Stadt beschreibt der röm. Schriftsteller Sisenna: »Eine Stadt auf hohem Hügel am Meer mit kleinen Mauern zwischen 2 Flüssen unterhalb des Vesuvs gelegen.« Auch wurde die Sicherheit seiner Häfen gelobt. Von diesen geographischen Gegebenheiten ist nach dem Vesuv-Ausbruch von 79 n. Chr. nichts übriggeblieben. Die offensichtlich ehemals zerklüftete Küste am Fuß des Vesuvs ist, durch die Ascheablagerungen und durch Lavastrom vom Ausbruch d. J. 1631 ausgeglichen, etwa 0,5 km nach W geschoben und in einen flachen Küstenstreifen verwandelt worden.
Der Untergang von Herculaneum erfolgte nicht in der gleichen
Weise wie der von Pompei und Stabiae. Während die beiden südlich gelegenen Städte durch die herabregnende Asche und die ausgeglühten Bimssteine mit einer etwa 6 m hohen Schicht bedeckt wurden, blieb Herculaneum zunächst verschont und konnte evakuiert werden. Erst nach dem eigentlichen Ausbruch setzten die Regenfälle ein, die den noch glühenden Auswurf um den Krater des Vesuvs in einen langsam fließenden Schlammstrom verwandelten, der die Stadt allmählich überdeckte. Dabei sickerte der heiße Schlamm in alle Hohlräume, entzündete zuerst die Holzteile der Häuser, schloß sie dann aber luftdicht ab und erstickte das Feuer. So blieben die Balken der Hauskonstruktionen, das hölzerne Mobiliar, verschiedene Lebensmittel und die Papyrusrollen der Bibliothek in der Villa der Pisonen, wenn auch teilweise verkohlt, erhalten. Eine Stadt wurde mitten aus ihrem Leben heraus konserviert. Die Schlammablagerungen erreichten über der Stadt schließlich eine Höhe von 16 m und bildeten, nachdem die noch glühenden Teile abgekühlt waren, einen festen Block, der den Ausgräbern große Schwierigkeiten bereitet.
Ein weiteres Hindernis für die Grabung bietet die moderne Stadt Resina (s. S. 476), die über der antiken Stadt entstanden ist und deren Häuser abgetragen werden mußten, um das Gelände freilegen zu können.
Die ersten Grabungen erfolgten durch Brunnen und Stollen. Auf diese Weise hatte der Fürst d’Elboeuf 1709-16 das Theater seiner Statuen beraubt, die schließlich in das Museum von Dresden gelangt sind, und so ließ auch Karl III. von Neapel zwischen 1738 und 1756 Teile der Stadt und die Villa der Pisonen vor der Stadt erforschen. 1738 hatte er zu diesem Zweck eine Accademia Ercolanese ins Leben gerufen. Die damals gefundenen Bilder und Statuen befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Mit offenen Grabungen wurde erst im 19. Jh. begonnen, doch konnten diese wegen der 16 m hohen, schwer zu bearbeitenden Gesteinsschicht nur langsam vorangetrieben werden und wurden häufig unterbrochen (1828-35, 1855 und 1869-75). Das meiste des heute sichtbaren Gebiets hat man erst nach 1927 freigelegt.
Am nördl. Ende gleich rechts vom heutigen Eingang liegt der Decumanus Maximus, die Hauptstraße der Stadt, die gleichzeitig deren Mittellinie ist. Parallel zu ihr läuft der Decumanus Inferior. Im rechten Winkel schneiden 3 Cardines (Cardo III-V) die Hauptstraße und teilen die Stadt in regelmäßige Rechtecke (Insulae). Die Gleichartigkeit der Insulae entspricht dem nach dem griech. Architekten Hippodamos von Milet benannten Stadtsystem, das vom 5. Jh. v. Chr. an bei der Anlage Von griech. Städten maßgeblich war — so auch bei der
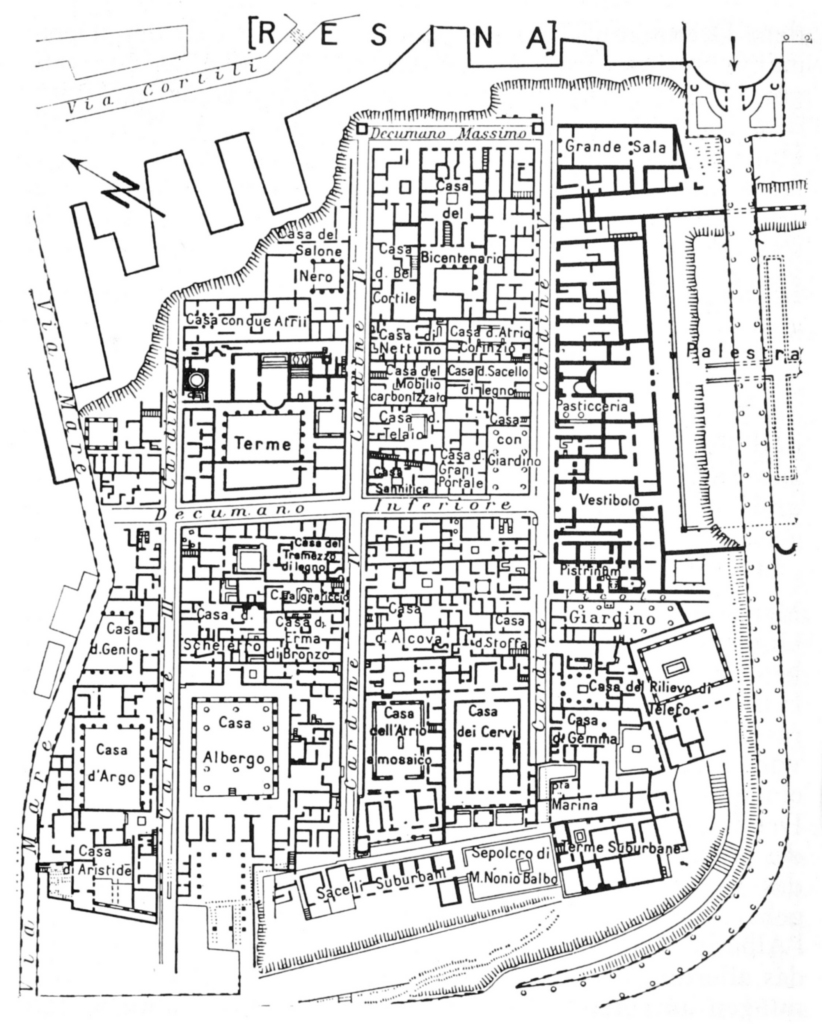 Herculaneum. Lageplan (Stand der Ausgrabungen vor 1967)
Herculaneum. Lageplan (Stand der Ausgrabungen vor 1967)
Neugründung von Neapel im selben Jahrhundert. In Anlehnung an den Stadtplan von Neapel läßt sich die Ausdehnung der nicht ausgegrabenen Teile von Herculaneum vermuten. Es wird wie jenes 3 Decumani gehabt haben.
Die Stadt hat sich also nach N noch einmal so weit erstreckt wie vom Decumanus Maximus nach S, und entsprechend
dem Decumanus Inferior ist dieser Teil durch den Decumanus Superior halbiert worden, auf dem die Küstenstraße von Neapel nach Pompei Herculaneum durchquerte. Außerdem ist die Stadt nach W hin etwa noch einmal so breit. Hinter dem Cardo III am Rande des ausgegrabenen Gebietes folgen noch Cardo II und I. Das bewohnte Rechteck war etwa 370 m lang und 320 m breit. Diese Fläche ist nur 1/5 so groß wie Pompei und bot 4000-5000 Einwohnern Platz.
In dem freigelegten Teil der Stadt liegen 2 Thermen, die große Palästra, ein heiliger Bezirk unterhalb der Stadtterrasse, v. a. aber Wohnviertel: gegen das Meer hin mit der Aussicht auf den Golf große, vornehme Anlagen, gegen die Stadtmitte hin die kleineren Häuser von Handwerkern und Kaufleuten und deren Werkstätten und Läden. Die anderen öffentlichen Gebäude — das Theater, die Basilika und der Sitz der Stadtverwaltung — sind noch nicht freigelegt. Sie liegen meist nördlich des Decumanus Maximus (Tafel bei S. 496.)
Man betritt das Grabungsgelände von der Seeseite her. Unter den Lava- und Schlammassen, die hier stehen geblieben sind, befanden sich im Altertum der Strand und die Häfen. Der Stadthügel war gegen das Meer hin durch Terrassen erweitert, deren hohe Wände ehemals den Anblick vom Meer her bestimmten. Unterhalb der Terrasse liegen ein größeres Thermengebäude und kleinere Heiligtümer.
Der Eingang in die Stadt erfolgt über die Aussichtsterrasse des größten Hauses mit Blick auf das Meer (Insula 3), das wegen seiner Ausdehnung früher für eine Herberge gehalten worden ist. Auch heute noch wird es als Casa dell’Albergo bezeichnet. Es war aber ein vornehmes Anwesen, das allerdings z. Z. des Vesuv-Ausbruchs in kleinere Wohnungen aufgeteilt wurde und sich gerade im Umbau befand. Daher ist von ihm heute nur noch eine Ruine übrig.
Gegen das Meer hin blieb der herrschaftliche Charakter erhalten. Vom Peristyl, dessen Terrasse z. T. abgestürzt ist, die sich aber ehemals noch vor die Terrassen der anderen Häuser vorschob, sind nur noch die Fundamente zu sehen.
Es folgen die Grundmauern von 3 großen Räumen, in der Mitte ein Triclinium, durch das man zu einem inneren Peristyl und dem tieferliegenden Garten gelangt. Rechts stehen noch Wände aufrecht. Ihre Dekoration stammt aus
der Blütezeit dieses Hauses (2. und 3. Stil, 1. Jh. v. Chr.), als es die Breite einer Insula eingenommen hat. — Man verläßt die »Casa dell’Albergo« nach links und gelangt auf den Cardo III, auf dessen anderer Seite die Insula 2 liegt, das älteste ausgegrabene Stück der Stadt.
Insula 2, Nr. 1, das sog. Haus des Aristides, liegt auf den Gewölben, die das Stadtgebiet gegen den Strand hin erweiterten. Das Atrium direkt hinter dem Eingang hat keine Fauces, dafür aber auf dem Gehweg ein von Säulen gehaltenes Vordach, ein sog. Prothyron. Diese Lösung findet sich bei einigen Häusern von Herculaneum. Über das röm. Haus s. S. 514.
Insula 2, Nr. 2, das sog. Haus der Argo, hat ebenfalls einen Eingang ohne Fauces, dafür ein Prothyron, das von 2 Säulen getragene Vordach, auf dem Gehweg vor der Tür. Links vom Atrium liegt ein Peristyl mit Garten, zu dem sich ein im 3. Stil rot ausgemaltes Triclinium öffnet. An der Rückseite des Gartenperistyls liegt ein Säulenhof, der nur z. T. ausgegraben wurde und an dem die Spuren der früheren Grabungen zu sehen sind. Im 18. Jh. hat man nicht das Gelände freigelegt, sondern ist durch unterirdische Stollen in die Häuser eingedrungen.
Insula 2, Nr. 3. Auch in das sog. Haus des Genius erfolgt der Eintritt durch ein Prothyron direkt in den Garten, dessen größter Teil noch unter der Lava liegt.
Insula 3, Nr. 3. Schräg gegenüber ist der Eingang zu einem kleinen und dennoch reich ausgestatteten Haus: dem sog. Haus des Skeletts, das seinen Namen nach einem Skelett trägt, das bei den Grabungen 1830/31 im Obergeschoß gefunden wurde. Wegen des engen Raumes gibt es weder einen Garten noch ein Atrium, sondern nur kleine Höfe und Lichtkanäle. Links vom atriumartigen Mittelraum (es fehlen die Dachöffnung und das Wasserbecken) liegt ein Triclinium mit dem Blick auf ein kleines, reich ausgestattetes Nymphäum mit 2 Wasserbecken. Hinter dem Tablinum befindet sich ein Apsissaal, der sein Licht ebenfalls von einem kleinen Nymphäum aus erhält. Hier ist eine Nische das wichtigste Dekorationsstück. Rechts vom Mittelraum führt ein schmaler Gang zu einer Reihe von Räumen, dessen hinterster ein schwarz ausgemaltes Cubiculum ist. Die
Dekoration dieses Hauses erfolgte im 4. Stil (Mitte des 1. Jh. n. Chr.).
An der Straßenkreuzung liegt linker Hand ein Thermopolium (Insula 2, Nr. 6), ein Laden zum Verkauf von kalten und warmen Getränken, die in den eingemauerten Tongefäßen im »Ladentisch« aufbewahrt wurden. Gegenüber nimmt ein Laden die Ecke ein (Insula 3, Nr. 6), der von dem dahinterliegenden herrschaftlichen Haus (Insula 3, Nr. 11) aus vermietet wurde. Hier schneidet der Decumanus Inferior den Cardo III, der nach N zwischen Insula 7 und Insula 6 hindurchführt. Insula 7 ist schon im letzten Jahrhundert freigelegt worden. An der Ecke befindet sich das sog. Haus des Galba, nach der Silberbüste dieses Kaisers (69 n. Chr.) benannt, die heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel aufbewahrt wird.
Den unteren Teil von Insula 6 nimmt eine Thermenanlage ein. Der Eingang in den Teil für die Männer liegt am Cardo III (Nr. 1). Er führt an einer Latrine vorbei in das Peristyl. Links öffnet sich die Tür zu den Baderäumen: dem Auskleideraum (Apodyterium), an den sich auf der einen Seite ein runder Kuppelraum mit dem Kaltwasserbecken (Frigidarium), auf der anderen das mäßig erwärmte Tepidarium mit einem schwarz-weißen Bodenmosaik (ein Meer-Kentaur umgeben von Delphinen) anschließen. Im Caldarium mit dem Heißwasserbecken ist das Gewölbe eingestürzt. — Der Eingang zu dem kleineren Bad der Frauen liegt am Cardo IV (Nr. 8). Dort befindet sich auch ein 2. Zugang zum Peristyl (Nr. 7) und einer zu den Heizräumen hinter dem Bad (Nr. 10).
Am oberen Teil von Cardo IV sind die Obergeschosse der Häuser um die Breite der Gehwege nach vorne gezogen. Z. T. werden sie am Rand des Gehwegs durch Säulen gehalten, z. T. ruhen sie auf Balken. So entsteht ein regengeschützter Laubengang zu beiden Seiten der Straße.
Insula 5, Nr. 6/7: Casa del Nettuno e Anfitrite. Die Vorderfront des von Balken getragenen Obergeschosses dieses Hauses ist heruntergestürzt. Man sieht in die ausgemalten Cubicula. Neben der Haustür befindet sich eine Ladenöffnung (Nr. 6), deren wohlausgerüstetes, gut erhaltenes Innere einen Eindruck von der Tätigkeit des letzten
Tages vermittelt. Auf dem Ladentisch liegen noch die Waren, auf dem hölzernen Zwischenboden stehen geordnet die Weinkrüge. Der Eingang Nr. 7 führt in ein Atrium. Der Hof hinter dem Tablinum ist als ein reich ausgestattetes Sommer-Triclinium eingerichtet. Am Boden stehen die 3 Liegebänke, die Unterlagen für die Polster, flach aufgemauert, die Rückwand wird von 3 stuckierten Nischen gebildet, deren Fronten mit Mosaik verziert sind (Jagdszenen). Darüber sind 3 Masken in die Wand eingelassen. Auf der angrenzenden Wand sitzt ein Mosaikbild, dem das Haus seinen heutigen Namen verdankt: In einem reichen Rahmenwerk erscheinen Neptun und seine Gemahlin Amphitrite.
Insula 5, Nr. 5: Casa del Mobile Carbonizzato. Mit seinem 2geschossigen Atrium repräsentiert dieses Haus einen besonderen Typ. Über dem Tablinum steht eine offene Säulenstellung, und mit einer Halbsäulenordnung sind die 3 anderen, geschlossenen Seiten verkleidet. 2geschossigen Anlagen im 1. Innenhof begegnet man bei hellenistischen Häusern auf Delos im 2. Jh. v. Chr. Auch in Herculaneum kann es sich um einen Einfluß aus dem östl. Mittelmeer handeln. Dieses vornehme Haus ist bei einer Restaurierung um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. im 4. Stil ausgemalt worden.
In die Dekoration wurden kleine Bilder und Stilleben eingefügt. Hervorzuheben sind das Tablinum, ein Triclinium links vom Atrium und ein Innenraum hinter dem Tablinum, der sich mit 3 Fenstern zu einem kleinen Hof hin öffnet. An der Rückwand des Hofes ist eine Nische so angelegt, daß man sie durch das Fenster im Tablinum vom Hauseingang aus sehen kann.
Insula 5, Nr. 1. An der Straßenecke steht das am besten erhaltene Haus dieser älteren Art. Die italien. Ausgräber haben es als Reverenz für den mittelitalischen Stamm der Samniten Casa Sannitica genannt. Dieses Volk hatte im 4. Jh. die politische Oberherrschaft über Herculaneum. Das Haus stammt aber erst aus dem 2. Jh. v. Chr. Der Gehweg vor ihm hat einen feineren Belag als sonst diese Wege — ein Zeichen für die Wohlhabenheit des Besitzers. Den Eingang flankieren 2 korinthische Pflaster, und an den Wänden der Fauces ziehen sich gemauerte Sitzbänke hin. Der obere Wandteil trägt noch die Quaderstuckierung des 1. Stils aus
dem 2. Jh. v. Chr. Im weiträumigen, wiederhergestellten Atrium ist die Gliederung des Obergeschosses gut erhalten.
Feine ionische Säulen tragen das obere Gesims. Zwischen den Säulen ist ein Geländer eingefügt, das nur an der offenen Seite über dem Tablinum seine Funktion erfüllt, an den 3 geschlossenen Seiten aber, wie auch die Halbsäulen, die Wand dekorativ gliedert. (Tafel bei S. 497.) Zum Obergeschoß führen 2 Treppen hinauf, eine von außen (Eingang Nr. 2) und eine links vom Atrium. Die Räume im Erdgeschoß wurden im 4. Stil um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. ausgemalt und haben einen einheitlichen, rot-weißen Fußboden. Über die Stile in der röm. Malerei s. S. 515-517.
Insula 3, Nr. 11: Casa del Tramezzo di legno. Unterhalb des Decumanus Inferior ist am Cardo IV eine Hausfassade bis in die Höhe des Obergeschosses mit 2 Türen und 5 verschieden großen, verschieden hoch sitzenden Fenstern erhalten. Das Mauerwerk hat seinen hellen Verputz bewahrt, an dessen oberem Abschluß ein Gesims mit einem Eierstab, einem sog. ionischen Kyma, entlangläuft. Darüber sind noch die verkohlten Balken des vorgezogenen 2. Stockwerkes sichtbar. Diese Front steht vor einem Haus, das sich rückwärts über die ganze Breite der Insula hinzieht und von dem auch der Laden an der Straßenecke des Cardo III betreten werden kann. Nur ein schmaler Streifen am Decumanus Inferior gehört nicht zu diesem Anwesen. So wie der Verputz an der Fassade, hat auch im Inneren vieles den Ausbruch überdauert, was den Einblick in ein bewohntes röm. Haus vermittelt. Im hohen tuskanischen Atrium (die Balkenkonstruktion läßt in der Mitte eine Öffnung, wodurch der Raum Licht erhält) und in den angrenzenden Zimmern sind hölzerne Einrichtungsgegenstände zwar verkohlt, aber noch vorhanden. So schließt eine aufklappbare Zwischenwand das Tablinum vom Atrium ab. Nach dieser Wand wird das Haus heute genannt (Casa del Tramezzo di legno). In einem Raum links davon steht noch ein hölzernes, bronzebeschlagenes Bettgestell. An marmornen Möbeln sind zu nennen: der Tisch am Impluvium im Atrium und eine Konsole in dem Raum rechts neben dem Eingang.
Eine Vitrine enthält Geschirr aus Bronze, Ton und Glas, Bronzeglocken und marmorne Hermenköpfe aus dem Garten. Die Wände sind im 3. Stil bemalt. Hinter dem Tabli-
num liegt ein Garten, zu dem sich andere Wohn-und Aufenthaltsräume öffnen und an dessen einer Seite eine halbhohe Loggia entlangläuft. Der Aufgang zum Obergeschoß des Hauses erfolgt über eine Treppe mit eigenem Eingang von der Straße aus (Nr. 12).
Insula 3, Nr. 13-15. Auf das herrschaftliche Anwesen folgt ein einfaches Haus aus Fachwerk (opus graticium) für 2 Familien. Das Obergeschoß ist vorgezogen und wird in ungleichem Abstand von 3 Säulen getragen. Der Eingang zu ihm erfolgt durch die Tür Nr. 13, hinter der die Treppe sogleich beginnt. Nr. 14 führt in die untere Wohnung und Nr. 15 in einen Laden, der von Nr. 14 aus betrieben worden ist. Die untere Wohnung erhält ihr Licht von einem Innenhof, in dem auch ein Brunnen steht. Zum hinteren Teil des Obergeschosses, das zur unteren Wohnung gehört, geht eine 2. Treppe hinter dem Hof hinauf. Das lebhafte Rot der Wandbemalung zeigt, daß auch in bescheidenen Verhältnissen die gleichen Vorstellungen von der Innenausstattung von Räumen existierten wie in den großen Häusern und den Villen. Auch die Wände des kleinen Gartens, des letzten Teils dieses Anwesens, sind lebhaft rot bemalt. In den Räumen des Obergeschosses stehen noch Reste der hölzernen Einrichtung an ihrem Platz.
Insula 3, Nr. 16: Casa dell’Erma di bronzo, ein kleines Haus, dessen Tuffquadern am Eingang zeigen, daß es im 2. Jh. v. Chr. erbaut worden ist. Im Atrium steht eine Bronzeherme mit dem Bildnis eines der Besitzer, im Tablinum ein schlanker Bronzekandelaber. Trotz seines engen Grundrisses hat dieses Haus die Züge eines herrschaftlichen Anwesens — es ist ebenso groß wie das angrenzende Fachwerkhaus. Hinter dem Tablinum bietet sich noch Platz für einen Garten. Die Schlaf- und Wirtschaftsräume lagen im Obergeschoß, zu dem eine Holztreppe von einem Seitenraum hinaufführt. Unter der Treppe befindet sich ein Brunnen.
Es folgen auf der gleichen Straßenseite weitere kleine Häuser und Nr. 19 der Rückeingang zur großen Casa dell’Albergo, in der meist der Besuch der Grabungen beginnt. Von dieser Seite betritt man das Bad und die Küche des Hauses.
Insula 4, Nr. 2. Auf der anderen Seite des Cardo liegt
ein villenartiges Gebäude, das wie die Casa dell’Albergo am S-Rand der Stadt die Stützmauer als Terrasse benutzt und einen weiten Blick über den Golf bietet. Durch die Fauces gelangt man in ein Atrium, dessen schwarz-weißer, durch Erdbeben verzogener Mosaikfußboden dem Haus seinen heutigen Namen gab — Casa dell’Atrio a mosaico. Hinter dem Atrium liegt das Tablinum. Es hat die Form einer Basilika. An diesen 1. Teil des Hauses schließt sich der langgestreckte Garten als 2. Teil an. Die Zwischenräume des umlaufenden Peristyls sind nachträglich zugemauert worden. Die verkohlten Reste der hölzernen Fensterrahmen zeigen, daß der Gang fest verschlossen werden konnte. An ihm liegen eine Reihe von Wohn- und Schlafräumen; in der Mitte ein blau ausgemaltes Triclinium. Die in die Dekoration eingefügten Bilder zeigen die Bestrafung der Dirke und die des Aktäon. An der S-Seite des Peristyls folgt ein 3. Teil des Hauses, der die repräsentativen Räume über der Terrasse mit dem Blick auf das Meer enthält: ein mittleres Triclinium und Nebenräume. Die Terrasse flankieren 2 Zimmer.
Nach O schließt sich an die Casa dell’Atrio a mosaico ein ähnliches, herrschaftliches Anwesen an, während die Insula 4 gegen die Stadt hin ausschließlich aus kleinen Häusern, Handwerksbetrieben und Läden besteht. Oft ist das Obergeschoß durch einen eigenen Eingang von der Straße her zu erreichen. Die Häuser wurden also von verschiedenen Familien bewohnt. An den Ecken befinden sich Läden.
Insula 4, Nr. 10, am Decumanus Inferior: Hier wurde in den großen, eingemauerten Tonkrügen verkohltes Getreide gefunden. Verkohlte Reste von Getreide und getrockneten Nahrungsmitteln enthielten auch die Tonkrüge an der anderen Straßenecke (Insula 4, Nr. 15/16). Dieser Laden gehörte zu den am besten ausgerüsteten der Stadt. Er ist Teil eines größeren Besitzes, der bei Nr. 12 beginnt und das Gelände an der Straßenecke einnimmt. An der Ecke steht ein Brunnen. Aus dem Mund einer bärtigen Maske fließt das Wasser, das wohl ehemals eine Reihe dieser kleinen Wohnungen versorgte. D auch in diesen bescheidenen Verhältnissen prächtig ausgemalte Innenräume geschätzt waren, zeigt der Blick in das Innere einer der nächsten Häuser mit seiner rot-weißen Dekoration im 3. Stil. Nach-
träglich — wohl nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. — ist eine Querwand in ihm eingezogen worden. In Nr. 19 sind verkohlte Tuchreste gefunden worden, danach Casa della Stoffa genannt. Der Ofen und die Amphoren zeigen, daß in diesem Haus ein Handwerksbetrieb untergebracht war. Im hinteren Teil liegen die Wohnräume, von deren sanitären Einrichtungen noch die Latrine erhalten ist. Die Wohnung im Obergeschoß hatte einen eigenen Eingang zur Straße hin, hinter dem die Treppe beginnt (Nr. 20). Eine kleinere Treppe im Inneren des Hauses führt in ein Zwischengeschoß.
Insula 6, Nr. 21. Auch an diesem, am weitesten nach O hinausgeschobenen Cardo liegen am unteren Ende gegen das Meer hin die großen villenartigen Gebäude mit der Terrasse oberhalb der Strandvorstadt. Die rechte Seite der Straße nimmt das sog. Haus der Hirsche, Casa dei Cervi, ein. Wie das nach W angrenzende Haus mit dem Mosaikfußboden im Atrium ist auch hier der Grundriß in 3 Teile gegliedert: die Wirtschaftsräume, den Garten und die Terrasse. Man betritt das Anwesen durch einen mit Marmor belegten Eingang und gelangt, anstatt in ein offenes Atrium, in einen überdeckten Vorraum. Von diesem führen mehrere Türen und Gänge in die verschiedenen Teile des Hauses: die Treppe zum Obergeschoß, ein Gang hinter dem Triclinium vorbei zur Küche, eine Tür zum Triclinium und eine in den Garten. Dieses Triclinium nimmt die Mitte des vorderen Gebäudeteiles ein. Es ist ein Festsaal, dessen Wände vom Sockel bis zur Decke hinauf im 4. Stil (nach 63 n. Chr.) schwarz dekoriert worden sind. Rote Streifen und zierliche Architekturen unterbrechen den einfarbigen Grund. Hier sind die beiden marmornen Hirschgruppen aufgestellt, nach denen das Haus heute genannt wird. Sie standen ehemals im Garten. — Hinter dem Triclinium befinden sich mehrere ausgemalte Cubicula und in einem von ihnen, mit den roten Wänden, die Marmorstatuette eines jungen Fauns. Auch sie wurde im Garten gefunden. An die Cubicula schließen sich die Küche, eine Vorratskammer und die Latrine an.
Dieser schmalen 1. Abteilung des Hauses folgt nach S der Garten, der den größten Raum einnimmt. Die Zwischenräume der Säulenstellung, die ihn umgibt, sind später
zugemauert und in einen von Fenstern unterbrochenen Gang verwandelt worden, dessen Verzierungen an den Wänden und auf dem Boden auf die Fensteröffnungen abgestimmt sind. Die meisten der kleinen Bilder an den Wänden mit den Spielen von Liebesgöttern hat man bei einer früheren Grabung herausgeschnitten; sie befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel.
Von S her ist ein großer Saal tempelartig in den Garten hineingezogen, der sich sowohl zu diesem als auch auf die Terrasse zum Meer hin öffnet. Er ist von 2 kleineren Räumen flankiert, auf denen ein Obergeschoß aufsitzt. 2 Treppen an den Seiten führten nach oben. Vor dem Festsaal steht eine Pergola auf der Terrasse, seitlich liegen kleinere Zimmer mit Fenstern zum Meer hinaus. In einem ist die Statuette eines trunkenen Herkules aus dem Garten untergebracht.
Dieses Anwesen mit seinem reichen Schmuck an Wandbildern und marmorner Gartenplastik gehört zu den am reichsten ausgestatteten Häusern von Herculaneum. Nur die Casa dell’Albergo nimmt ein größeres Terrain ein. Was den Schmuck anbelangt, so wird das Anwesen nur von den großen Villen außerhalb der Stadt übertroffen.
Dem Haus der Hirsche gegenüber am unteren Ende des Cardo V liegen 2 weitere Häuser mit dem Blick auf das Meer. Sie nutzen ihre Lage am SO-Ende des Stadthügels und fügen sich nicht mehr wie die anderen Häuser in die N-S-Richtung der Stadtplanung ein, sondern sind ein wenig gegen O hin orientiert:
Nr. 1 wird wegen des Fundes einer Gemme mit dem Profilbild einer Frau Casa della Gemma genannt. Als einziges der Häuser mit dem Blick auf das Meer hat es das für ein röm. Haus typische Atrium. Durch den langgestreckten Eingang, die Fauces, gelangt man in diesen rot und schwarz dekorierten Raum. In der Mitte befindet sich das Wasserbecken, das Impluvium. An den Wänden sind zur Verstärkung Pilaster angebracht; auf ihnen ruhten die Balken der Dachkonstruktion auf. Dem Eingang gegenüber stehen 2 Säulen vor dem Zugang zum Tablinum und einem kleinen Garten. Rechts vom Eingang führt ein gekrümmter Gang zur gut erhaltenen Küche und zu einer Latrine, in deren Wand eine respektlose Hand den Namen ihres be-
rühmtesten Benutzers eingraviert hat: »Apollinaris medicus Titi imperatoris hic cacavit bene« — ein Arzt des Kaisers Titus (79-81), unter dessen Regierung die Städte um den Vesuv durch den Ausbruch zerstört worden sind. Zu den Räumen auf der Terrasse führt ein schmaler Gang. Hier sind v. a. die sorgfältig gearbeiteten Fußbodenmosaiken noch in gutem Zustand.
Das nächste Haus mit den Eingängen Nr. 2 und Nr. 3 wird wegen eines Reliefs, das in ihm gefunden wurde, Casa del Rilievo di Telefo genannt. Es erstreckt sich auf einem unregelmäßigen Grundriß nördlich und östlich der Casa della Gemma. Das Terrain fällt gegen O hin ab. Nach S führt ein langer Gang zu einem Aussichtssaal, der über die Front der übrigen Häuser hinaus zur Seeseite hin vorgeschoben ist. Doch ist von diesem Hause am Rande der Stadt nur wenig übriggeblieben. Die Schlammassen haben viel von dem aufgehenden Mauerwerk fortgetragen. Das Atrium hat man bis in die Höhe des Frieses über den Säulen rekonstruiert. Die Ziegelsäulen sind mit einem roten Verputz überzogen, von dem ein Drittel glatt und der obere Teil kanneliert ist. Vom Architrav hängen marmorne Oscilla herab, runde Marmorscheiben, die auf beiden Seiten mit einem flachen Relief versehen sind. Links vom Eingang führt eine Tür zu einem Pferdestall, der durch Nr. 3 einen eigenen Ausgang zur Straße hat. An der Rückwand des Atriums befindet sich die große Öffnung zum Tablinum, links davon der Durchgang zum Garten, der aus 2 Teilen besteht: ein Nutzgarten, der erst in der letzten Zeit der Bewohnung zu dem Haus hinzugekommen ist und in dem noch die Spuren einer früheren Bebauung zu sehen sind, liegt nördlich vom Atrium; nach () schließt sich ein Peristylgarten mit Wasserbecken in der Mitte an. Eine halbhohe Ummauerung zwischen den Säulen trennt den Umgang vom Garten, der nicht mehr völlig auf dem gewachsenen Grund liegt, sondern z. T. über den Gewölben, mit denen die gesamte S-Front von Herculaneum gegen das Meer hin vorgeschoben ist. Es handelt sich also um einen hängenden Garten. Diese Gewölbe tragen auch die Aufenthaltsräume an der S-Seite des Gartens, an denen vorbei der Gang zu den besonders prächtig ausgestatteten Aussichtsräumen über dem Strand geht. In diesen, v. a. im
letzten, taucht eine neue Möglichkeit der antiken Wandgestaltung auf, die den Schmuck der reicheren Häuser der späteren Zeit bestimmt: Marmor wird nicht mehr imitiert, sondern in dünn geschliffenen Platten vor die Wand gelegt, wobei die Wahl verschiedener Sorten für die Farbigkeit sorgte. In der Verwendung dieses teureren Materials auch für den Schmuck von Bürgerhäusern — und nicht allein für die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom, von denen die meisten gerade in dieser Zeit errichtet worden sind — spiegelt sich die wirtschaftliche Konsolidierung des unter der röm. Herrschaft zusammengefaßten Mittelmeergebietes.
Den Boden bildet ein geometrisches System von klein geschnittenen Marmorplatten. Größere Stücke sitzen an dem noch erhaltenen unteren Wandteil, der durch gedreht kannelierte Pilaster mit korinthischen Kapitellen gegliedert wird. Dieses Zimmer gehört zum Obergeschoß eines Bauteils, dessen untere, ebenfalls dekorierte Räume noch zum größten Teil von dem getrockneten Schlamm des Vesuv-Ausbruchs angefüllt sind. Das Haus war auch reich mit Reliefs ausgestattet, die bei einer früheren Grabung herausgeholt wurden und heute in verschiedenen Museen aufbewahrt werden. Eines hat seinen Weg in das Archäologische Nationalmuseum von Neapel gefunden; ein Abguß ist in einem Nebenraum ausgestellt: eine Szene aus dem Leben des mythischen Helden Telephos — seine wunderbare Heilung durch den Rost einer Lanzenspitze, die ihm Achill reicht. Nach diesem Relief trägt das Haus seinen heutigen Namen.
Der Aussichtsraum der Casa del Rilievo di Telefo ist vor die Terrassen der übrigen Häuser am Strand vorgezogen und läßt einen Blick von der Seite auf die Anlagen unterhalb der Terrassenmauer zu. Diese war früher die Befestigungsmauer der Stadt, wie das Mauerwerk dort zu erkennen gibt, wo der Verputz abgesprungen ist. Erst später wurde das Gelände hinter ihr durch Gewölbekonstruktionen angehoben und der Platz für die Villen am Stadtrand geschaffen. Vor der Mauer verläuft das Pomerium, die rituelle Stadtgrenze, außerhalb welcher die Gräber liegen. Stollengrabungen haben gezeigt, daß hier Grabbauten stehen, wie sie in Pompei vor allen Toren gefunden worden sind. Das Gelände am Strand von Herculaneum hat aber
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Herculaneum. Decumanus Maximus
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Herculaneum. Atrium des sog. samnitischen Hauses
hauptsächlich den Bedürfnissen eines Hafens gedient. Bevor die Schlamm- und Lavamassen den heutigen, fast geradlinigen Küstenverlauf hergestellt hatten, betrug vor dem Stadthügel der Abstand zum Meere etwa 400 m und zu dessen Seiten vor der Mündung der beiden Gebirgsbäche 150-200 m. Die Grabungen in diesem Gebiet werden durch 2 Faktoren erschwert: Einmal sind die Ablagerungen in dieser untersten Schicht wesentlich fester zusammengewachsen als in der Höhe der Stadt; sie bilden fast eine Felsbank. Zum anderen hat sich das Gelände aufgrund vulkanischer Veränderungen um etwa 1,5 m gesenkt, so daß die Gebäude vor der Stadtmauer im Grundwasser stehen; im Altertum lag der Boden höher.
Das Gebiet war besiedelt und muß von nicht wenigen Menschen bewohnt gewesen sein. Denn unter den Gebäuden im schmalen, vor der Mauer freigelegten Streifen befindet sich ein öffentliches Bad, das nur um weniges kleiner ist als die Thermen in der Stadt. Die Vorstadtthermen sind nicht lange vor dem Vesuv-Ausbruch errichtet worden. Sie werden über ein freies Gelände betreten, auf dem ein Altar und die Basis für eine Statue stehen. Inschriften besagen, daß mit diesen Weihungen der Prokonsul Marcus Nonius Balbus geehrt werden sollte, dem die Stadt auch eine Reiterstatue aufgestellt hat (heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel). Das Bad ist in einem fast quadratischen Gebäude zusammengefaßt und besteht nur aus einer Abteilung für Männer. Im kleinen Vorraum mit seinem Lichtschacht in der Mitte steht eine Herme an einem runden Wasserbecken. Von diesem Vorraum führen verschiedene Türen und Gänge in die einzelnen Räume des Bades: den Heizraum, das Kalt-, Warm- und Heißbad, den Schwitzraum und in Nebenräume für das Personal. Die Wände der Baderäume sind mit Marmorplatten und Stuckreliefs geschmückt. Jenseits des Vorplatzes mit dem Altar für Marcus Nonius Balbus erstreckt sich ein geweihtes Gelände mit 2 kleinen Heiligtümern.
Cardo V, die Straße mit den 3 herrschaftlichen Anwesen an ihrem unteren Ende, führt oberhalb einer kleinen Querstraße nördlich der Casa del Rilievo di Telefo an der 80 m langen Front eines einheitlich geplanten Gebäudes entlang. Hinter der Straßenfront mit kleinen Läden und
Handwerksbetrieben befindet sich das großzügig gestaltete Gelände einer Palästra, eines Sport- und Übungsplatzes zur Erziehung der Jugend. Nach dem Mauerwerk, einem unregelmäßigen Opus reticulatum, zu urteilen, ist das Gebäude im 1. Jh. entstanden. Sein Haupteingang liegt in einer Achse mit dem Decumanus Inferior, von dem aus gesehen das Tor wie eine Tempelfront am Ende der Straße steht, mit 2 Säulen in der Vorhalle und dahinter einem langgestreckten Vestibül. Den 77,8 m langen Innenraum umgibt ein Peristyl. Die Säulen sind aufgemauert und mit weißem Stuck überzogen. In der Mitte der westl. Langseite liegt ein Festsaal hinter dem Säulengang. Sein Fußboden und der untere Teil der Wände sind mit Marmor verkleidet. Die Rückwand bildet eine Apsis. In der Mitte steht ein Marmortisch. Der Raum war wohl ehemals prächtig ausgestattet. Man kann sich denken, daß er für feierliche Handlungen benutzt wurde, die zu dem. Leben in einer Palästra gehörten. Am N-Ende wird der Platz von einem Kryptoportikus abgeschlossen, einem gewölbten Gang, auf dem eine obere Säulenstellung stand. Das Gelände der Palästra ruht z. T. noch unausgegraben unter dem Schutt des Vesuv-Ausbruchs. Durch Stollen wurde nur die Kreuzform des mittleren Wasserbeckens ermittelt, in dessen Mitte eine Bronzeschlange mit 7 Köpfen als Wasserspeier diente.
Die lange Straßenfront des Gebäudes ist im Erdgeschoß durch die Öffnungen für Läden und Betriebe aufgelöst. Im Obergeschoß lagen Mietwohnungen.
Nr. 1: ein größerer Laden mit Hinterzimmer. — Nr. 2: der Eingang zu einer Wohnung, die mit einer Bäckerei in der schmalen Seitengasse in Zusammenhang steht. — Nr. 3: ein schmaler, langgestreckter Laden. — Nr. 5: ein Betrieb, wahrscheinl. eine Färberei, mit einem Ofen an der Rückwand und dem Zugang zu dem Zwischengeschoß und der Wohnung im Obergeschoß. — Nr. 6: ein Laden mit gemauertem Verkaufstisch; im hinteren Raum wurde eine größere Anzahl von Vorratsamphoren aufbewahrt, auf einer von ihnen ist ein Name eingeritzt: M. Elvi Alcimi Herclani. — Nr. 7: Eingang zu den Mietswohnungen im Obergeschoß. — Nr. 8: eine Bäckerei, die in 4 Räumen untergebracht ist: Im Vorraum stehen 2 Mühlen aus Lavastein, im hinteren Raum wurden 25 Bronzeformen für Gebäck gefunden, in der Wandvitrine ist das Siegel eines Sextus Patulcus Felix
aufbewahrt — wahrscheinl. das des Besitzers. Im Nebenraum steht ein gut erhaltener Ofen. Die phallischen Embleme haben magischen Wert. — Nr. 9: eine Kneipe mit einer Feuerstelle neben der Tür; an die Wand ist ein Lararium gemalt (Herkules zwischen Dionysos und Merkur). Im lebhaft ausgemalten Hinterzimmer stehen die Reste eines Holzbettes. — Nr. 10: hier wurde in den hinteren Zimmern eine Anzahl von z. T. ausgeführten, z. T. halbfertigen Gemmen gefunden. Es handelt sich also um die Werkstatt eines Gemmenschneiders. Im kleinen Nebenraum stehen ein Handwebegerät, ein intarsiertes Bett, auf dem das Skelett eines Kindes liegt, und ein Marmortisch mit verschiedenen Fundstücken aus den Zimmern im Erd- und Obergeschoß. — Nr. 11: die Werkstatt eines Färbers. Im vorderen Raum steht der Ofen. — Nr. 12: ein Eingangsraum, der die Verbindung zwischen Nr. 11 und Nr. 13 herstellt. — Nr. 13: ein Laden, in dem Gemüse, Getreide und Mehl verkauft wurde. Hier wurden auch einige Silberringe und ein Siegel mit dem Namen A[uli] Fuferi gefunden. — Nr. 14-16: verschiedene Werkstätten. — Nr. 17: Eingang und Treppe zu den Wohnungen im Obergeschoß. — Nr. 18: wahrscheinl. eine Färberei mit einem Ofen zwischen 2 Arbeitstischen. — Nr. 19: durch eine von 2 Säulen getragene Vorhalle führt ein Eingang in einen ehemals reich dekorierten Saal, der durch 2 Säulen und 2 Pilaster in einen vorderen und einen hinteren Teil geschieden wird. Seitlich verbindet ein Gang den Saal mit der nördl. Säulenhalle der Palästra. Weitere Räume des Traktes, der den N-Flügel der Palästra bildet, sind noch nicht ausgegraben. So ist es auch noch nicht deutlich, wie weit das Gebäude nach N über den Decumanus Maximus hinausreicht.
Mit seiner 2-Säulen-Vorhalle richtet sich das Gebäude gegen den Decumanus Maximus und bildet dessen eine Stirnseite. Es ist für diese Stelle geplant, denn die größere mittlere Öffnung entspricht der Breite des Decumanus, die schmaleren Seitendurchgänge haben die Breite der seitlichen Gehwege. Dieser Decumanus ist breiter als alle anderen bislang freigelegten Straßen von Herculaneum (etwa 12 m; hinzu kommen die 2,5-2,8 m breiten Gehwege). Wegen seiner Weiträumigkeit wird er auch als Forum angesehen.
Der nördl. Gehweg ist durch Säulen und Pfeiler vor den Fassaden der Häuser zu einem Laubengang ausgebaut. An
der S-Seite sind die Obergeschosse der Häuser nach vorne gezogen und bieten dadurch den Passanten Schutz vor der Witterung. Einige der Balken blieben gut erhalten. Reste der sie verzierenden Schnitzereien sind noch zu sehen. Im Gegensatz zu allen anderen Straßen ist der Decumanus Maximus nicht mit den großen, unregelmäßig geschnittenen Platten aus dunkler Lava gepflastert. (Tafel bei S. 496.)
Die Häuser der Insula 5, die gegen den Cardo V und gegen den Decumanus Maximus liegen, dienen meist als Läden. Am Cardo V führen nur 2 Eingänge in kleinere herrschaftliche Häuser älterer Art:
Nr 31, Casa del Sacello di legno — das Haus mit dem hölzernen Heiligtum, ein Haus mit Atrium. In einem Nebenraum steht ein noch gut erhaltenes hölzernes Möbel, dessen oberer Aufsatz wie eine Tempelfront mit 2 Säulen gestaltet ist. Im Obergeschoß wurden wächserne Schreibtäfelchen gefunden, die aber zu sehr gelitten haben, als daß man sie noch entziffern könnte.
Nr. 30, Casa dell’Atrio corinzio, das Haus mit dem korinthischen Atrium. Das Compluvium im Atrium wird von 6 korinthischen Säulen getragen. In den Räumen ist z. T. noch die Stuckdecke vorhanden.
Das größte Haus der Insula 5 liegt am Decumanus Maximus. Seine Straßenfront ist in Läden aufgelöst (die Eingänge Nr. 13-18). Nr. 14-16 stehen mit dem Inneren des Hauses in Verbindung. Die Grabungen an diesem Haus wurden i. J. 1938 abgeschlossen — also 200 Jahre nach Beginn der Grabungen in Herculaneum; daher wird das Anwesen Casa del Bicentenario — Haus der Zweihundertjahrfeier — genannt. In Nr. 16 sieht man im Obergeschoß (die Decke ist heruntergebrochen) auf ein an die Wand gemaltes Lararium mit den dafür typischen Schlangen. Der Haupteingang mit Ostium und Fauces führt durch Nr. 15 in das Atrium. Sein schwarz-weißes Bodenmosaik, das marmorne Impluvium in der Mitte und der rote Verputz sind noch gut erhalten. Im rechten Flügel der Alae befindet sich ein hölzerner Verschlag mit nur wenig angekohlten Türen. Viell. handelt es sich um den Schrein zur Aufbewahrung der wächsernen Ahnenbilder der patrizischen Familie, die dieses Haus bewohnte. — Das Tablinum hat einen prächti-
gen Marmorfußboden, der wie ein farbiger Teppich in die Mitte gebreitet ist, und an den Wänden Bilder, Medaillons sowie einen gemalten Fries. Die Bilder zeigen auf der einen Seite den Mythos von Dädalus und Pasiphae, auf der anderen Seite Mars und Venus, die Medaillons Brustbilder von Satyrn, Silenen und Mänaden und der Fries Amoretten. Dieser herrschaftliche Teil des Hauses scheint in der letzten Zeit vor dem Vesuv-Ausbruch unbewohnt gewesen zu sein. In ihm sind keinerlei Reste von Einrichtung gefunden worden. Anders verhält es sich mit dem hinter dem Tablinum gelegenen Garten. Die an ihn angrenzenden Räume waren offenbar vermietet. Die Besonderheit dieser Wohnung besteht darin, daß einer ihrer Räume zu weitreichenden Vermutungen Anlaß gegeben hat. Im Obergeschoß befindet sich ein kleines Zimmer (3 x 2,7 m), an dessen Rückwand ein kreuzförmiges Zeichen aus Holz von 43 cm Höhe in die Wand eingelassen war. Offensichtlich konnte es auch wie ein heiliges Zeichen verborgen werden. In der Wand haben sich eiserne Haken erhalten. Unterhalb des Kreuzes steht eine hölzerne Truhe. Man hat in diesem kleinen Raum eine christl. Hauskapelle sehen wollen. Wenn dem so wäre, so würde es sich um die älteste nachweisbare Einrichtung dieser Art handeln. Die Verehrung des Kreuzes war erst seit Konstantin d. Gr. (313-337) verbreitet und ist aus dem 3. und dem 2. Jh. nur spärlich belegt.
Die Casa del Bicentenario scheint urspr. bis an die Straßenecke gereicht zu haben. Doch wurde ein Stück später abgeteilt und in 2 kleinere Häuser umgestaltet. In der Trennwand befinden sich zugemauerte Türen. Das Haus, das aus der vorderen Hälfte herausgeschnitten worden ist, hat seine Hauptfront gegen den Decumanus Maximus. Nr. 12 ist ein Laden, der mit dem Haus in Verbindung steht, Nr. 11 der Eingang in das Atrium. Das Bodenmosaik im Tablinum ist dem im Tablinum der Casa del Bicentenario nicht unähnlich. In die Wanddekoration aus großen gelben Flächen sind einzelne Bilder eingefügt: an der Rückwand ein Leier spielender Apollon, der mit Lorbeer gekrönt ist, eine Nymphe und auf der Seite ein Eros mit dem schweren Köcher des Apollon. Den Raum an der Straßenecke nimmt ein großer Laden ein (Nr. 10), der auch vom Cardo IV her betreten werden konnte (Nr. 9). Hier wurde Getreide und trockenes Gemüse verkauft. Die großen ein-
gemauerten Tongefäße dienten wie kleine Silos als Vorratsbehälter für die Waren. Auch die Galerie im Obergeschoß über der Seitenstraße (Cardo IV) ist als Vorratsraum verwendet worden. Hier hat man Getreide gefunden.
Das dahinter liegende Haus hat seinen Eingang am Cardo IV (Nr. 8). Bei dem schmalen Grundriß fehlte der Raum für ein Atrium. Anstelle des Eingangs, der Fauces, gelangt man in eine breite, niedrige Vorhalle und von dieser in die Räume des Erdgeschosses. Ein Hof mit Mosaikboden und ohne Impluvium versorgt die Räume mit Licht. Hinter dem Hof führt eine Treppe, unter der sich die Öffnung der Zisterne befindet, zum Obergeschoß. An die Wand ist schattiges Weinlaub gemalt und vermittelt den Eindruck einer offenen Pergola.
An der Mündung des Cardo IV in den Decumanus Maximus steht quer zur Breite des Cardo ein öffentlicher Brunnen mit 2 Ausgüssen. Den einen schmückt das Reliefbild einer musch elhaltenden Venus, den anderen eine Gorgonen-Maske. Neben dem Brunnen erhebt sich noch ein Teil eines Wasserpfeilers. Auf ihn sind Inschriften aufgemalt, eine gibt Polizeivorschriften wieder. Wahrscheinl. handelt es sich um ein Edikt der Ädile.
Die Häuser der Insula 6 am Decumanus Maximus, erst vor wenigen Jahren freigelegt, sind diejenigen der ausgegrabenen Gebäude, die der Stadtmitte am nächsten liegen. In der hier noch anstehenden Lava müssen die öffentlichen Gebäude und die Tempel der Stadt verborgen sein. Denn bis auf die kleinen Heiligtümer in der Vorstadt am Strand, wurden bisher keine Tempel für die großen Götter freigelegt, wie sie für eine antike Stadt unerläßlich sind. Dieser Befund zeigt, daß sich die Grabungen bis heute nur in den Randbezirken der Stadt bewegt haben.
An der Ecke von Cardo IV und Decumanus Maximus liegt die Casa del Salone Nero, ein größeres patrizisches Haus, dessen Front gegen den Cardo mit einer Säulenstellung versehen ist. Von dort führt auch ein Nebeneingang in die hinteren Räume (Nr. 11). Der Haupteingang liegt aber am Decumanus (Nr. 13). Er ist, wie bei allen Häusern an dieser wichtigen Straße, von Läden flankiert, die vermietet werden konnten. Das Haus ist als einziges der bislang aus-
gegrabenen Gebäude von Herculaneum auf dem für ein röm. Haus jener Zeit typischen, beinahe symmetrischen Grundriß errichtet, wie er in Pompei für ein patrizisches Anwesen fast die Regel bildet: Ostium und Fauces des Eingangs, das Atrium mit dem Impluvium in der Mitte und den Alae als seitlichen Verlängerungen, im Hintergrund das Tablinum, an ihm vorbei ein Gang zum Peristyl, dem säulenumstellten Garten, an dem die herrschaftlichen Wohnräume liegen. Nach dem großen Saal hat das Haus seinen heutigen Namen erhalten. Seine Wände sind schwarz dekoriert. Die Flächen werden nur durch schmale Pilaster und Kandelaber in Weiß, Rot und Blau unterbrochen. Auch die noch erhaltene Decke ist schwarz bemalt. Nach diesem düsteren Saal wird das Haus Casa del Salone Nero (Haus mit dem schwarzen Salon) genannt. Die 2 Cubicula an der S-Seite des Peristyls haben ebenfalls noch ihre Decken; sie sind mit einfachen ornamentalen Motiven ausgemalt.
Das Haus der Augustalen an der Ecke von Cardo III und Decumanus Maximus diente einer Körperschaft als Sitz, der in der Mehrzahl wohlhabende Freigelassene angehörten; sie war Träger des munizipalen Kaiserkultes. Ihre Mitglieder waren zudem verpflichtet, öffentliche Spiele auszurichten. Auf diese Weise konnte eine in der Kaiserzeit aufstrebende Schicht, die wegen ihrer Herkunft aus dem Sklavenstand von den hohen Munizipalämtern ausgeschlossen war, durch Ehrenzeichen und öffentliches Ansehen an die Interessen des Staates gebunden und ihr Reichtum für die Gemeinden nutzbar gemacht werden. Das Gebäude besteht aus einem 13,5 x 15,7 m großen Saal, dessen Decke von 4 bemalten Säulen getragen wird. Von der Rückwand sind 2 Querwände bis zu den hinteren Säulen gezogen. So entsteht eine Nische, deren Fußboden gegenüber dem übrigen Raum angehoben ist. Die Wände sind reich im 4. Stil (nach 63 n. Chr.) ausgemalt. Ein architektonisches Rahmenwerk gibt den Durchblick auf zierliche phantastische Gebäude frei, dazwischen sitzen 2 Bildfelder mit je 3 Figuren: Herkules, Juno und Minerva auf der einen, Neptun, Amymone und Amphitrite auf der anderen Seite. An der Rückwand wölbt sich ein Bogen über einem Altar. Anläßlich seiner Einweihung gab es ein Festmahl, dessen Erinnerung eine Inschrift festhält; durch sie
ist die Bestimmung des Gebäudes heute noch bekannt. In einem Nebenraum steht ein Bett, auf dem ein Skelett gefunden worden ist. Die Statuen und viele Teile der marmornen Wandverkleidung des Gebäudes sind schon bei den Stollengrabungen von Herculaneum im 18. Jh. entfernt worden.
Zwischen der Casa del Salone Nero und dem Augustalen-Kollegium überspannt ein Bogen mit 4 Öffnungen den Decumanus Maximus. Teile seines Stuckverputzes sind noch erhalten. Auf ihm stand wahrscheinl. eine bronzene Quadriga, deren Reste sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel befinden. Solche Ehrenbögen sind typisch für die röm. Stadtgestaltung. Sie begegnen in der Nähe der munizipalen Zentren und heben Plätze, Straßenabschnitte und Gebäude hervor. In Herculaneum flankiert dieses Tetrapylon die Vorhalle der Basilika, die noch unter dem Schutt des Vesuv-Ausbruchs vergraben liegt. Von hier stammen viele der marmornen und bronzenen Ehrenstatuen im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel, so etwa die Reiterbildnisse von Marcus Nonius Balbus, Vater und Sohn, und die Statuen der Familienangehörigen. Die Hufe verglühter bronzener Reiterstandbilder sind noch auf den hohen Sockeln an der Eingangsfront der Basilika zu sehen. Außer diesem plastischen Schmuck war das Gebäude aber auch mit bedeutenden Wandgemälden versehen: der Kentaur Chiron mit seinem Schüler Achill, Pan mit seinem Schüler Olympos, das große Bild mit der Nymphe Arcadia und der Auffindung des Telephos durch Herakles und die Erlegung des Minotauros durch Theseus (alle im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel).
Wie das Augustalen-Kollegium, der Ehrenbogen über dem Decumanus Maximus und die Reste von Reiterstatuen zeigen, beginnt an diesem äußersten Winkel des ausgegrabenen Geländes der Stadtmittelpunkt von Herculaneum. Die wichtigsten Repräsentativgebäude der Stadt, die Tempel, das Theater und der Sitz der Stadtverwaltung, liegen noch in der Lavabank vergraben, auf der die moderne Stadt Resina (s. S. 476) gebaut worden ist.
Geschichte
Über die Gründung von Pompei und den Beginn seiner Geschichte gibt es keine schriftlichen Nachrichten. Die Stadt war zu unbedeutend, als daß sich die Geschichtsschreiber mit ihr befaßt hätten. So können nur die Ergebnisse der Ausgrabungen Licht in ihre Anfänge bringen. Zu den ältesten Funden gehören die Scherben griech. schwarzfiguriger Vasen aus dem Gebiet des Apollon-Tempels am Forum. Sie stammen aus Opfergruben und zeigen, daß sich auf diesem Gelände schon im 6. Jh. v. Chr. ein Heiligtum befand. Zu dieser Zeit ist auch der dorische Tempel erbaut worden, der östlich vom Forum auf einem Geländevorsprung liegt. Mit diesen beiden Heiligtümern aus dem 6. Jh. wird der Platz der ältesten Ansiedlung angegeben. Sie liegen auf der höchsten Erhebung eines alten Lavastromes, der in vorgeschichtlicher Zeit vom Vesuv oder einem Nebenkrater kommend an dieser Stelle den Strand erreicht hat und 40 m über dem Meeresspiegel ein nach 3 Seiten steil abfallendes günstiges Siedlungsgelände bot. Hier werden nicht lange vor dem Bau der Heiligtümer, also im 8. oder 7. Jh., italische Osker der Umgebung sich niedergelassen haben. Der Name Pompei läßt sich sowohl aus dem Oskischen als auch aus dem Griechischen ableiten. Wie diese Funde zeigen, ist die Stadt sehr bald unter griech. Einfluß gelangt.
Von Cumae, ihrer ältesten Gründung auf italischem Boden, aus hatten die Griechen im 6. Jh. den gesamten Golf von Neapel unter ihre Kontrolle gebracht und verletzten dabei die Interessen der damals in Mittelitalien vorherrschenden Etrusker, die im 6. Jh. auch Kampanien in Besitz genommen hatten. Nach einer für die Etrusker siegreichen Seeschlacht mußten die Griechen von der Küste des Golfes weichen, und für Pompei begann die kurze Zeit der etruskischen Vorherrschaft, die 50 Jahre später nach dem griech. Seesieg vor Cumae (474 v. Chr.) von der 2. griech. Epoche abgelöst wurde. Etwa 425 kam die Stadt dann unter den Einfluß des in Mittelitalien mächtigen italischen Stammes der Samniten. Während des samnitisch-röm. Krieges wurden die Küstenstädte am Golf von Neapel i. J. 310 v. Chr. von einer röm. Flotte heimgesucht, und nach dem Sieg der Römer mußte sich Pompei dem röm. Bündnissystem anschließen, behielt aber seine innere Autonomie und seine eigene Sprache.
Von nun an macht sich der hellenistische Kultureinfluß bemerkbar, der bei den italischen Stämmen ein eigenes Gepräge erhielt. Es beginnt die erste Blütezeit der Stadt, von der noch heute die Reste von Privathäusern und öffentlichen Gebäuden zeugen. Wichtige Monumente wie die Basilika, der Apollon- und der Jupiter-Tempel, die Stabianer Thermen, das Haus des Faun, des Pansa und des Sallust stammen aus der Phase, die mit dem sog. Bundesgenossenkrieg am Anfang des 1. Jh. v. Chr. endete. Pompei und
mit ihm viele andere, mit Rom ähnlich verbundene italische Gemeinden erhoben sich gegen die Hauptstadt, um für ihre Bürger die gleichen Rechte zu erzwingen, wie sie die Stadtrömer besaßen. Denn inzwischen war aus dem Bündnissystem ein italisch-röm. Staatsgebiet geworden, ohne daß sich die Rechtsverhältnisse geändert hätten. 89 v. Chr. eroberte Cornelius Sulla zuerst Stabiae und dann Pompei. Daraufhin verlor die Stadt ihre Selbständigkeit und wurde i. J. 80 als röm. Veteranenkolonie unter dem Namen Colonia Cornelia Venera neu gegründet. P. Sulla, ein Neffe des Diktators, war mit der Neuordnung betraut. Die Schwierigkeiten, die sich zwischen den neuen und den alteingesessenen Bürgern ergaben und dieser nicht bewältigen konnte, führten zu seiner Anklage in Rom. Ciceros Verteidigungsrede »pro Sulla« gibt ein Bild der Gegensätze und Konflikte dieser ersten Zeit des röm. Pompei. Doch die Assimilation erfolgte rasch. Bald bot die Stadt den Anblick einer von vielen röm. Provinzstädten, aus deren Leben nur wenige Ereignisse überliefert sind. 59 n. Chr. kam es im Amphitheater, wohl wegen unterschiedlicher Beurteilung der Gladiatorenspiele, zu einem Gemetzel, das die Bürger von Pompei unter ihren Gästen aus dem nahe gelegenen Nocera anrichteten. Der Vorfall erregte allgemeine Aufmerksamkeit und wurde auch vor dem Senat in Rom verhandelt, der die Höchststrafe für solche Fälle erkannte: das Amphitheater von Pompei wurde für 10 Jahre geschlossen.
Der Vesuv-Ausbruch
Bald darauf folgte die Katastrophe, die den Ruhm der Stadt begründete: 62 n. Chr. wurde sie von einem Erdbeben erschüttert, und noch bevor der Wiederaufbau völlig abgeschlossen werden konnte, begann am 24. August 79 der Vesuv, der seit Menschengedenken erloschen war, wieder seine Tätigkeit. Bei dem ersten, länger andauernden Ausbruch ergoß sich über seine Abhänge Lava und kochender Schlamm, die weiter entfernten Gegenden wurden unter einem Regen von Asche und kleinen Bimssteinen begraben. Über Pompei senkte sich eine Schicht von 6-7 m Asche und Steinen. Unter ihrem Gewicht stürzten die Decken der Häuser ein. Wie viele Menschen sich aus der Katastrophe retten konnten, ist ungewiß. Pompei hatte etwa 20 000 Einwohner. Ein nicht geringer Teil davon scheint sich bald nach Beginn des Ausbruchs aufgemacht zu haben. Da der Untergang der Stadt mehrere Tage in Anspruch genommen hat, mögen die ersten noch davon gekommen sein, andere wurden auf der Flucht von den vom Vesuv herabregnenden Steinen erschlagen, wieder andere hofften auf ein Ende des Ausbruchs, blieben in den Häusern und fanden dort den Tod. Ihre Leichen wurden von der Asche eingeschlossen, und als die Körper zerfallen waren, entstanden Hohlräume, die bei den neueren Ausgrabungen mit Gips ausgefüllt werden. Die Abdrücke zeigen die Menschen in ihren letzten verzweifelten Minuten, von niederfallender Asche und ausströmendem Gas bedrängt.
Als Bericht eines Mannes, der fast als Augenzeuge gelten kann, liest sich ein Brief des jüngeren Plinius an den Geschichtsschreiber Tacitus. Sein Onkel, der Naturforscher Plinius d. A., war z. Z. des Vesuv-Ausbruchs Kommandant der im Hafen von Misenum stationierten röm. Flotte; beim Beginn der Naturkatastrophe ist er mit einem Schiff zu der betroffenen Küste aufgebrochen und kam dabei ums Leben. Der Neffe berichtet davon: »Mein Onkel befand sich gerade in Misenum, wo er persönlich das Kommando über die Flotte führte. Am 23. August ungefähr um ein Uhr nachmittags berichtete ihm meine Mutter, es zeige sich eine Wolke von ungewöhnlicher Größe und Gestalt. Er ... stieg auf eine Anhöhe, von wo aus man die wunderbare Erscheinung am besten betrachten konnte. Die Wolke stieg auf — für Zuschauer aus der Ferne war es nicht zu unterscheiden, von welchem Berge, daß es der Vesuv war, erfuhr man erst später — sie sah ihrer ganzen Gestalt nach nicht anders aus wie ein Baum, und zwar wie eine Pinie. Sie hob sich nämlich wie auf einem sehr hohen Stamm empor und teilte sich dann in mehrere Äste. Wohl deshalb zerfloß sie in die Breite, weil sie durch den frischen Luftstoß zunächst zwar in die Höhe getrieben, dann aber, als dieser nachließ, durch ihr eigenes Gewicht wieder herabgedrückt wurde. Zuweilen erschien sie glänzend weiß, dann wieder schmutzig und fleckig, je nachdem sie Erde oder Asche mit sich führte. Einem so bedeutenden Naturforscher wie meinem Onkel schien das Ereignis wichtig und einer näheren Betrachtung wert. Er ließ ein kleines Fahrzeug segelfertig machen. ... Er trat eben aus dem Haus, da erhielt er ein Briefchen von Rectina, ... die infolge der drohenden Gefahr um ihren Mann besorgt war — denn ihr Haus lag am Fuße des Berges, und einen Fluchtweg gab es nur zu Schiffe. Sie bat ihn, er möchte sie doch aus der bedenklichen Lage in Sicherheit bringen. Da ändert er seinen Plan und ... läßt Vierruderer ausfahren und begibt sich selbst an Bord, nicht Rectinas wegen allein, sondern um vielen anderen noch Hilfe zu bringen — denn die Küste war wegen ihrer Schönheit gut bewohnt... . Schon fiel die Asche auf die Schiffe, und je näher sie kamen, um so wärmer wurde sie und fiel dichter, schon auch Bimssteine und schwarzes, ausgebranntes und infolge der Hitze zerbröckeltes Gestein. Schon stieg eine Untiefe auf, und der Schutt vom Berge her machte das Gestade unzugänglich. Er zögerte eine Weile, ob er nicht doch umkehren sollte. Bald sagte er aber dem Steuermann, der ihm dazu riet: "Frisch gewagt, ist halb gewonnen. Nimm Kurs zu Pomponianus hin." Dieser lag in Stabiae auf der entgegengesetzten Seite des Golfes... Obgleich hier noch keine unmittelbare Gefahr bestand, merkte man sie trotzdem schon, und wenn sie zunahm, war sie auch hier ganz nahe. Pomponianus hatte seine Habseligkeiten bereits auf ein Schiff bringen lassen, fest entschlossen zur Flucht, wenn der widrige Wind sich gelegt hätte. Mein Onkel fuhr mit gleichem Winde, der für ihn günstig war, dem Pomponianus entgegen, umarmte den Zitternden, tröstete und
beruhigte ihn und ließ sich selbst ins Bad bringen, um dessen Angst durch seine eigene Ruhe zu vertreiben. Nach dem Bade legte er sich zu Tisch, aß heiter oder, was ebenso großartig ist, scheinbar heiter. Indessen leuchteten vom Vesuv her an mehreren Stellen weite Flammenflächen und mächtige Feuersäulen, deren strahlender Glanz im Dunkel der Nacht noch heller wirkte. Um die Leute zu beruhigen, erklärte mein Onkel, dies seien die Bauernhöfe, die die Landleute in ihrer Angst verlassen hätten, und die Villen, die ohne Obhut seien und jetzt brennten. Darauf legte er sich zur Ruhe und schlief einen tiefen Schlaf... Aber der Hofraum, von dem aus der Zugang zum Zimmer führte, lag bereits so hoch voll Asche, daß ein Herauskommen nicht mehr möglich gewesen wäre, wenn er sich noch länger darin aufgehalten hätte. Man weckte ihn. Er trat heraus und begab sich zu Pomponianus und den anderen, die noch geblieben waren. Gemeinsam berieten sie, ob sie im Hause bleiben oder im Freien auf und ab gehen sollten. Denn von vielen heftigen Erdstößen wankten die Häuser, gleichsam als seien sie aus dem Boden gerissen, und man hatte den Eindruck, als neigten sie sich hin und her. Unter freiem Himmel fürchtete man allerdings das Herabfallen der freilich leichten und ausgebrannten Bimssteine. Indes beim Vergleichen der Gefahren entschied man sich doch für das zweite ... Sie legten sich Kissen auf den Kopf und banden sie mit Tüchern fest. Das war ein Schutz gegen den Steinregen. Schon war anderswo Tag, dort aber Nacht, dichter und schwärzer als alle Nächte bisher. Doch erhellten diese Nacht viele Fackeln und allerlei Lichterscheinungen. Man entschloß sich, zum Gestade zu gehen, um aus der Nähe zu sehen, ob man sich schon auf das Meer hinauswagen könne ... Es blieb aber immer noch wild und ungestüm. Dort legte er sich über ein hingebreitetes Tuch, verlangte wiederholt frisches Wasser und trank. Nun trieben Flammen und Schwefelgeruch, die Vorboten des Feuers, die anderen in die Flucht und veranlaßten ihn aufzustehen‘. Gestützt auf 2 Sklaven erhob er sich, brach aber sofort wieder zusammen. Ich vermute, der dichte Qualm hat seinen Atem gehemmt und die Kehle zugeschnürt, die bei ihm ohnehin schwach und eng und häufig entzündet war. Als es wieder Tag wurde — es war der dritte Tag, seit seinem Hingange — fand man seinen Körper unversehrt, ohne Verletzung und in derselben Kleidung, die er zuletzt getragen hatte.« Die Ascheneinöde hat sich nur sehr langsam wieder mit einer Vegetation überzogen. Es entstand eine neue Siedlung, die jedoch, offenbar wegen der Erdbeben, bald verlassen worden ist. Die Gegend um Pompei blieb dann bis in die neueste Zeit hinein Ackerland.
Geschichte der Ausgrabungen
Am Ende des 16. Jh. stieß der Architekt Domenico Fontana beim Bau eines Kanals zum ersten Mal auf die Trümmer von Pompei,
das damals mit Stabiae verwechselt worden ist. Denn eine Erinnerung daran, daß hier einmal eine Stadt gelegen hat, ist im Namen der Gegend erhalten geblieben: Der Hügel von Pompei hieß »civita«, also Stadt. Trotz der Funde von Inschriften und einiger Gebäude mit bemalten Wänden dauerte es noch eineinhalb Jahrhunderte, bis die Grabungen begannen. Ihren Anfang verdanken sie den Interessen des Königs Karl III. von Neapel, der auch den Anstoß zur Ausgrabung von Herculaneum gab, eine »Accademia Ercolanese« zur Erforschung der neugefundenen Städte ins Leben rief und das Museum im Schloß von Capodimonte in Neapel einrichten ließ. Während der ersten Zeit erfolgten die Grabungen ohne Plan. Das Interesse richtete sich fast ausschließlich auf die Kunstwerke, die Bilder, die aus den Wänden herausgeschnitten worden sind, die Mosaiken und auf die Gegenstände der Einrichtung. Nur dort, wo das Haus, aller als kostbar erachteten Gegenstände beraubt, wieder zugeschüttet worden ist, blieb das Übrige für eine zweite Ausgrabung in unserem Jahrhundert erhalten (z. B. Haus der Julia Felix). Die nicht wieder zugedeckten Häuser dagegen verkamen. Die bemalten Wände verblaßten, das Mauerwerk stürzte zusammen. Diese Grabungsmethode herrschte bis zum Ende des Königreiches von Neapel im Jahre 1860 vor. In dieser Zeit wurden das Forum, das Forum triangulare und das Stadtgebiet von der Via Stabiana bis zur Porta Ercolano freigelegt.
In der 2. Hälfte des vergangenen Jahrhunderts änderte sich die Einstellung den Überbleibseln des Altertums gegenüber. Nicht mehr den Kunstwerken allein galt die Aufmerksamkeit, sondern der gesamten antiken Kultur und den Formen des Lebens. Diesen erweiterten Interessen entsprachen die neuen Methoden, mit denen die Grabungen nach 1860 unter der Leitung von Guiseppe Fiorelli fortgesetzt wurden. Das Streben ging dahin, alles an dem Ort zu lassen, an dem es gefunden wurde. Außerdem begann man nun die Hohlräume im Schutt mit Gips auszugießen und fand dabei nicht nur die Körper der beim Vesuv-Ausbruch umgekommenen Einwohner, sondern es wurden auch Abdrücke von hölzernen Gegenständen gemacht. Türen, Läden und Balken wurden ebenso wie die Baumwurzeln in den Gärten und auf öffentlichen Plätzen ausgegossen. So entstand allmählich das Bild einer mitten aus dem Leben gerissenen Stadt, und damit wurde eine Vorstellung vom Alltag in der röm. Antike gewonnen. Beispiele für diese Art der Grabungen sind das Vettier-Haus, die Mysterienvilla und schließlich ein ganzer Straßenzug, die Via dell’Abbondanza in ihrem östl. Teil. Im Verlauf der sich nun schon über 200 Jahre erstreckenden Ausgrabungen wurden bisher 3/5 des Stadtgebietes freigelegt. Die noch unerforschten Viertel liegen im N und NO der Stadt.
Stadtplan und Straßenbild (Tafel rechts)
Für die 1. Ansiedlung hatte ein 40 m hoher Vorsprung gedient, der nach W zum Meer und nach S zur Niederung des Flusses Sarno abfiel und dessen vorderste Spitze eine natürliche Festung bot. Auch nach O senkt sich das Gelände, und nur nach NW behält es die gleiche Höhe. Noch auf dem Plan der ausgegrabenen Stadt hebt sich das älteste Stadtgebiet von den neueren Teilen ab. Vom Venus-Tempel an der SW-Ecke zum N-Rand des Forums und von dort in einem weiten Bogen zum Forum triangulare und den Resten des dorischen Tempels läßt sich der Kern der Besiedlung am unregelmäßigen Verlauf der Straßen erkennen. Hier liegen auf engem Raum alle wichtigen Heiligtümer und die öffentlichen Gebäude der Stadt beieinander. Wegen der Geländebedingungen konnte die Stadt aber nicht nach allen Seiten gleichmäßig wachsen, sondern dehnte sich nach N und NO aus, so daß das Zentrum allmählich an den Rand zu liegen kam. In 2 Etappen scheint die Stadt durch die Anlage gerader Straßen erweitert worden zu sein: zuerst entsprechend der Richtung des Forums nach NW bis zur Via Stabiana im 0, dann östlich dieser Straße und im rechten Winkel zu ihr. So entstand ein fast regelmäßiges Straßennetz, wie es seit dem Ende des 6. Jh. v. Chr. sowohl bei den Etruskern als auch bei den Griechen bekannt war. In welcher Zeit die Vergrößerungen durchgeführt wurden, ist unbekannt.
Man kann zwischen den bis zu 10 m breiten Hauptstraßen und den Nebenstraßen unterscheiden. Die Hauptstraßen unterteilen das Stadtgebiet in fast gleich große Viertel. Sie entsprechen von N nach S den Cardines einer röm. Stadt (V. a. die Via Stabiana zwischen der Porta Vesuvio und der Porta Stabiana) und von W nach O den Decumani (die Via di Nola und die Via dell’Abbondanza). Die Straßen sind mit großen polygonalen Platten aus Vesuvstein gepflastert, an den Hauswänden ziehen sich Fußgängerwege entlang, und in Abständen erleichtern Trittsteine das Hinüberwechseln von einer Straßenseite zur anderen.
Zur Orientierung haben die Ausgräber das Stadtgebiet in 9 Regionen eingeteilt und die von 4 Straßen eingegrenzten Häuserkomplexe als Insulae (Inseln) bezeichnet, innerhalb welcher jedes Haus seine Nummer hat. Gegen die Straßen
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Pompei. Luftaufnahme
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Pompei. Haus des Loreius Tiburtinus
öffnen sich die Häuser meist nur mit ihren Eingangstüren und den Läden. Im allgemeinen bestimmen die hohen Abschlußwände und die fast fensterlosen Fassaden das Bild. Bisweilen ist der Verputz noch erhalten. Dann zeigt sich, daß nicht die graue Einfarbigkeit des Mauerwerkes zu sehen war, sondern Bilder von Göttern und den als Hausgeistern geltenden Schlangen auf die hellen Flächen aufgemalt waren. Dazwischen hatte man jeden freien Platz für Inschriften genutzt. Es muß einen Beruf von Wändebeschreibern gegeben haben, die auf Bestellung in kapitalen, meist roten Buchstaben Ankündigungen an die Häuser malten. Hauptsächlich sind es Wahlvorschläge und Aufforderungen zur Stimmenabgabe für einen bestimmten Kandidaten, für den sich der Hausbesitzer einsetzte. Daneben gibt es auch unzählige Graffiti, kursiv eingekratzte Inschriften privater Natur. Das Schreiben an die Wände war allgemein verbreitet. Im Theater, dem Amphitheater und an der Basilika hat man denselben Vers eingekratzt gefunden, der diese Sitte kommentiert: »Admiror, paries, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum fastidia sustineas« (Ich bewundere dich, Wand, daß du noch nicht eingestürzt bist, obwohl du die Schmähungen so vieler Schreiber tragen mußt).
Dort, wo der Verputz der Häuser fehlt, tritt verschiedenartiges Mauerwerk hervor. Der Bau, Neubau und Umbau der Häuser hat sich über Jahrhunderte hin erstreckt, und man hat immer, soweit es möglich war, schon Bestehendes wiederverwendet. So kommt es, daß an ein und derselben Wand der Stein und die Bearbeitung wechseln können — je nachdem, wann eine Mauer gebaut worden ist. Die verschiedenen Epochen lassen sich im allgemeinen durch Technik und Material voneinander unterscheiden. Am häufigsten wechseln die großen, sorgfältig behauenen Sandstein- und Tuffblöcke an den Fassaden, die aus der hellenistisch beeinflußten Periode vor 80 v. Chr. stammen, mit dem Bruchsteinmauerwerk der frühen röm. Epoche. Eine besondere Bauform der späten Republik und der beginnenden Kaiserzeit ist das Opus reticulatum: Kleine quadratische Steine werden zu einem netzförmigen Mauerwerk zusammengefügt, wobei durch die Wahl verschiedener Steinsorten ein farbiges Muster entstehen kann. Vom groben Bruch bis zu dieser verfeinerten Technik gibt es viele Stufen des Übergangs. In den letzten Jahrzehnten beginnt dann auch
in Pompei der für die röm. Bauweise typische Ziegelstein zu herrschen.
Abgesehen von einigen Beispielen samnitischer Häuser mit der offenen Loggia im Obergeschoß an der Via dell’Abbondanza folgen die Häuser in Pompei der in der Antike weitverbreiteten Form des nach außen festungshaft abgeschlossenen Hauses. Den einfachsten Typ stellt das sog. Haus des Chirurgen dar: Gegen die Straße öffnet es sich nur durch
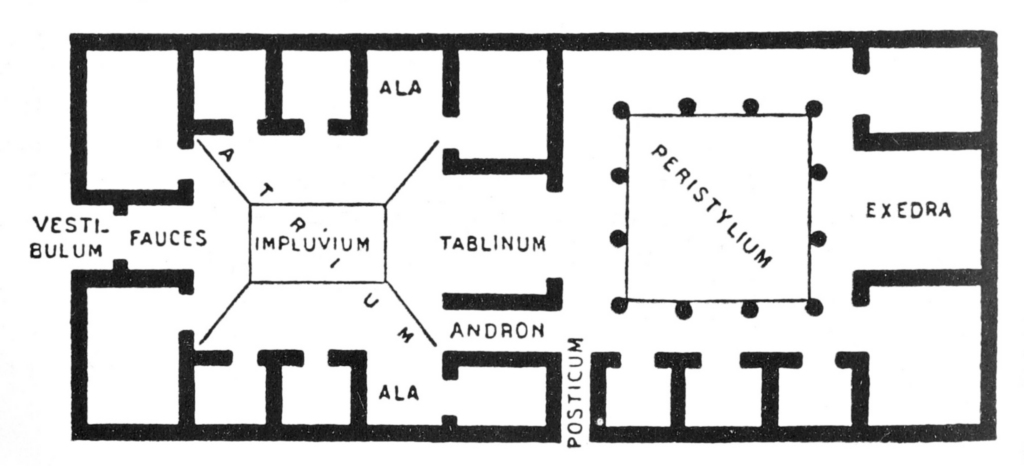 Das typische römische Haus. Grundriß
Das typische römische Haus. Grundriß
den hohen, mit Pilastern geschmückten Eingang und den schmalen Korridor (Ostium und Fauces); dieser führt zum Atrium, bei dessen tuskanischer Form eine Balkenkonstruktion das Dach trägt und in der Mitte eine Öffnung für das Licht frei läßt (Compluvium); ihr Rand ist mit Wasserspeiern aus Terrakotta versehen, durch die das gesammelte Regenwasser vom Dach in das viereckige Wasserbecken unter der Öffnung geleitet wird (Impluvium). Bei dem sog. korinthischen Atrium tragen korinthische Säulen das Dach. Vom Atrium aus erhalten die kleineren Wohnräume (Cubicula) ihr Licht. Dem Eingang gegenüber öffnet sich ein größerer Raum mit seiner ganzen Breite gegen das Atrium, das Tablinum, der Hauptraum des Hauses. Ihm zu seiten liegen, ebenfalls mit ihrer ganzen Breite zum Atrium hin offen, die Alae. Am Tablinum vorbei führt ein Gang in den von Säulen umstandenen Garten, an dem auch kleinere Cubicula und ein größerer Oecus liegen können. Zu seiten des Eingangs ist an der Straße der Raum für
Läden genutzt, die meist keine Verbindung mit dem übrigen Hause haben, die also vermietet worden sind.
Dieser einfachere Typus ist im 2. Jh. v. Chr. durch den Einfluß des griech. Hauses um einen weiteren Hof vergrößert worden. Zwischen Atrium und Garten konnte außerdem noch ein Säulenhof eingefügt werden, das Peristyl. Vom griech. Haus wurde auch der Festraum übernommen, in dem die Liegestätten (Klinen) für das Gelage aufgestellt waren (meist 3 in U-Form, daher: Triclinium). Bei diesen reicher ausgestatteten Anlagen werden dann auch die Küche und die Wirtschaftsräume von den herrschaftlichen Teilen getrennt und liegen oft um einen eigenen Hof herum. Über den niedrigen Teilen des Hauses, den Wirtschaftsräumen und den kleinen Cubicula des Atriums, werden gegen Ende der röm. Republik und in der Kaiserzeit Obergeschosse aufgestockt, zu denen schmale Treppen aus den Nebenräumen hinaufführen. Durch diese Veränderung wurde für die Dienerschaft oder auch für eine zahlreiche Familie Raum geschaffen. Mehrgeschossige Mietshäuser mit eigenen Eingängen für die verschiedenen Stockwerke wie in Rom und Ostia gab es in Pompei noch nicht.
Unter dem Schutz der 6 m hohen Aschenschicht ist in Pompei die Innenausstattung vieler Häuser erhalten geblieben und gewährt Einblick in die Wohnkultur einer röm. Landstadt der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit.
Ein wesentlicher Zug dieser röm. Wohnkultur ist die Ausstattung der Innenräume mit Malerei. Die Wände — und wo erhalten auch die Decke — der Zimmer sind von einem farbigen Dekorationssystem überzogen, das den Raum als Einheit faßt. In der neueren Kunstentwicklung hat nur das 18. Jh. eine ähnliche Raumdekoration gekannt. In Pompei dagegen läßt sie sich für die 3 letzten Jahrhunderte seines Bestehens nachweisen. Entsprechend dem sich ändernden Zeitgeschmack hat auch diese Dekoration eine Entwicklung durchgemacht, die man seit A. Mau, dem ersten Erforscher der Wände von Pompei, die 4 pompejanischen Stile nennt.
Funde in Rom, Ostia und in Städten des östl. Mittelmeeres haben gezeigt, daß es sich bei dieser Dekoration nicht um ein auf Pompei oder die Vesuv-Städte beschränktes Phänomen handelt, sondern daß sie den Wohnbedürfnissen in
der hellenisierten Welt des Mittelmeergebietes entsprach. Die Malerei von Pompei als einer Landstadt ist dabei abhängig von der Entwicklung der antiken Kunstzentren. Vor 80 v. Chr., also vor der völligen Eingliederung der Stadt in den röm. Staat, orientiert es sich nach dem griech. Osten, nach 80 v. Chr. wird die Hauptstadt Rom zum Vorbild.
Das Dekorationssystem vor 80 v. Chr. wird als der 1. Stil bezeichnet. Vergleichbare Wände sind auf Sizilien, in Griechenland, Kleinasien, Syrien und Ägypten sowie Südrußland gefunden worden. Man kann dieses System als Strukturalen oder Inkrustationsstil bezeichnen. Auf der Wand wird ein Quaderwerk aus Stuck vorgetäuscht: Über einem durchlaufenden hohen Sockel kommt eine Schicht hoher Platten (Orthostaten), über diesen ein Band und dann das eigentliche Mauerwerk. Den Abschluß bildet ein Gesims.
In der röm. Epoche ändern sich Material und Auffassung. Es wird nicht mehr ein wirklicher Wandabschluß aus Stuck dargestellt, sondern eine Architektur aufgemalt. Der nun beginnende 2. Stil, der in Pompei von 80 bis etwa 20 v. Chr. die Wandmalerei bestimmt, macht mehrere Phasen durch. Zuerst werden die Elemente des 1. Stils aufgemalt und durch perspektivisch gezeichnete Säulen und vorspringende Gesimse wird räumliche Tiefe vorgetäuscht. Über dem Gesims fügt man später den Durchblick auf einen blauen Streifen, der den Himmel meint, hinzu. Baumwipfel werden auf das Blau aufgemalt und deuten den Blick über eine Landschaft an. Die Durchblicke können an den Seiten bis zum Sockel herunterreichen. In diesem Dekorationssystem finden nun die Kopien nach griech. Gemälden Platz, und zwar an mehreren Stellen: 1. als vorgetäuschte Klappbilder, die auf dem Gesims stehen und deren geöffnete Flügel perspektivisch gemalt sind; 2. als Friese und 3. als Bilder inmitten der großen Farbflächen. Der 2. Stil führt zu einer Auflösung der Wand in ein architektonisches Gebilde, dessen Räumlichkeit aber immer nachvollzogen werden kann.
Der 3. Stil bestimmt die Dekoration in den letzten Jahrzehnten des 1. Jh. v. Chr. und in den ersten Jahrzehnten des 1. Jh. n. Chr. Er entwickelt sich aus dem 2. Stil, löst sich aber von dessen Illusionismus und faßt die Wand als Orna-
mentfläche. Die Architekturglieder werden fein und überlängt und verlieren ihren architektonischen Charakter. Die Säulen stehen nicht mehr auf ihren Basen, sondern auf Spitzen und wirken nur noch als Zierleisten. Die eingesetzten Gemäldekopien behalten ihren Platz, bekommen aber eine durchsichtigere Farbigkeit. Neu sind die Landschaftsbilder auf weißem Grund mit kulissenhaften, perspektivisch nicht miteinander verbundenen Raumschichten. Die Einzelheiten sind mit miniaturhafter Genauigkeit gemalt. Der Betrachter kann bis nahe an die Wand herantreten.
Gegen Mitte des 1. Jh. n. Chr. entwickelt sich der sog. 4. Stil und bestimmt den Geschmack der Zeit, so daß nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. die Wiederherstellung der erschütterten Wände nach seinen Regeln erfolgte. Daher sind in Pompei die meisten Häuser in diesem Stil ausgemalt. Vom 3. Stil werden die großen, einfarbigen Wandflächen übernommen, deren Mitte Kopien nach griech. Gemälden oder schwebende Figuren einnehmen können. Doch sitzen diese durch Ornamentbänder eingefaßten Flächen nicht mehr aneinander, sondern sind so angeordnet, daß in den Zwischenräumen der Durchblick auf phantasievolle Architekturen freigegeben wird. Auch oberhalb der großen Farbflächen ist meist auf weißen Grund eine Scheinarchitektur aufgemalt. Dabei werden wie im 2. Stil die Mittel der Perspektive angewendet, die Raumwirkung aber widersinnigerweise durchbrochen. In den Ädikulen und zwischen den Säulen der oberen Zone können Figuren aufgemalt sein. Diesem üppigen Aufbau entspricht auch die Pinselführung. Sie ist nicht miniaturistisch fein wie im 3. Stil, sondern locker und impressionistisch. Der Betrachter soll nicht mehr nahe an die Wand herantreten, sondern aus einiger Entfernung das gesamte phantastische Spiel überschauen.
Der Haupteingang zum Grabungsgelände ist die »Porta Marina«‚ durch die eine steile Straße vom Hafen zum Forum führt. Wegen ihrer Steigung war sie für Wagen unbenutzbar. Sie überwindet in kurzem Abstand den Höhenunterschied zwischen dem Strand und der höchsten Stelle der Lavabank, auf der Pompei liegt. Ein Teil der
Straße ist in röm. Zeit von einem Tonnengewölbe überdeckt worden.
Rechts von dieser Tonne liegt das Gebiet des Tempels der Venus Pompeiana, Pompeis Schutzgöttin. Der urspr. Bau hat offenbar das Erdbeben von 62 n. Chr. nicht überstanden, und der Neubau wurde nicht mehr fertig. Bei den Grabungen hat man nur die Reste des alten Gebäudes und noch unfertige Bauteile des neuen, in Marmor geplanten Tempels gefunden. Oben an der Straße, links vor dem Forum, liegt das Gelände des Apollon-Tempels. Das rechteckige Areal ist an seinen 4 Seiten von einer Säulenreihe umgeben. Die schlanken Tuffsäulen waren urspr. von einer Schicht weißen Marmorstuckes umgeben und wurden bei der Instandsetzung nach dem Erdbeben von 62 mit einem dicken Verputz überzogen, der im unteren Drittel rot eingefärbt ist. Vor den Säulen und im Säulenhof verteilt stehen die Sockel für verschiedene Standbilder, links und rechts vor der jeweils 2. Säule der Längsseiten des Hofes sind Statuen des bogenschießenden Apollo und seiner Schwester Diana aufgestellt — Bronzenachgüsse der hier gefundenen Statuen, die sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel befinden. Der Bau selbst erhebt sich nach der Art der italisch-etruskischen Tempel auf einem Podium, das an der Vorderseite über eine Freitreppe erreicht werden kann. Unten an der Treppe steht der Opferaltar. Die Front hat 6 korinthische Säulen, an denen noch Reste des Marmorstuckes zu sehen sind. Beachtlich tief ist die Vorhalle vor der einfachen Cella für das Götterbild, dessen Sockel erhalten blieb. Links Vom Eingang steht ein Omphalos. Das Gelände war seit der griech. Zeit Pompeis im 6. Jh. v. Chr. Apollon geweiht. Tempel und Säulenhalle stammen aus dem 2. Jh. v. Chr.
Der Apollon-Tempel grenzt an das langgestreckte Forum, das auf der höchsten Stelle der Stadt liegt und den Platz der ältesten Ansiedlung einnimmt. Es war als weiträumiger Säulenhof gestaltet. An der SO-Ecke stehen noch Tuffsäulen aus der vorröm. Epoche aufrecht; an den übrigen Seiten röm. Travertinsäulen in 2 Geschossen übereinander. Die Erneuerung der Anlage war 79 n. Chr. noch nicht abgeschlossen.
An der N-Seite des Forums erhebt sich auf einem Podium der Jupiter-Tempel, der in röm. Zeit wahrscheinl. dem Kult der für den Staat wichtigen kapitolinischen Trias — Jupiter, Juno, Minerva — gedient hat. Die Freitreppe nimmt die ganze Breite der Front ein und führt zu den 6 korinthischen Tuffsäulen hinauf. Die Vorhalle ist 4 Säulenstellungen tief. In der Cella hinter ihr wurde ein kolossaler Jupiter-Kopf gefunden, der heute im Archäologischen Museum von Neapel aufbewahrt wird. Der Tempel ist etwa 150 v. Chr. erbaut worden.
An die Säulenhallen um das Forum schließen sich weitere Tempel und Gebäude an, die dem Handel und der öffentlichen Verwaltung dienten: links vom Jupiter-Tempel neben dem Ehrenbogen ein Speicher, links davon in einem kleinen Raum ein marmorner Meßstock zur Kontrolle der Gewichte. — Rechts vom Tempel befindet sich hinter einer Flucht von korinthischen Marmorsäulen (sie standen auf Podesten, 3 von ihnen sind vor den Podesten wieder aufgerichtet) das Macellum, der Markt für Fleisch, Fisch und Geflügel. Die Vorderfront nimmt eine Reihe von Läden ein, zwischen denen 2 Türen in das Innere führen. Der rechteckige Innenhof ist an 3 Seiten von Säulenhallen umgeben, hinter denen auf der rechten Seite wiederum Läden liegen. Die Mitte des Hofes wird, wie für ein Macellum typisch, von einer runden Säulenhalle eingenommen. An der Rückfront öffnet sich ein Sacellum, eine Cella für ein Götterbild. An den Wänden Reste von Bemalung aus dem 4. Stil.
Rechts vom Macellum folgt als weite Nische wahrscheinl. das Heiligtum für die Laren, die Schutzgötter der Gemeinde. Es stammt aus den letzten Jahren von Pompei. In der Mitte der Sockel für einen Altar.
Das rechts angrenzende Heiligtum für den vergöttlichten Kaiser Vespasian diente dem Kaiserkult. Der Altar in der Mitte zeigt auf der Vorderseite eine Opferszene. Ein Opferdiener führt den Stier heran. Der Priester vollzieht die Weinspende.
Rechts folgt das Gebäude der Eumachia. Es ist, wie die Inschrift über dem Eingang an der rechts beginnenden Via dell’Abbondanza lehrt, von der Priesterin Eumachia erbaut
worden, war der Concordia Augusta und der Pietas (der Einigkeit und Frömmigkeit des Kaiserhauses) geweiht und diente der mächtigen Innung der Fullones als Sitz, in der die Gewerbe der Tuchhersteller und Tuchfärber vereinigt waren; sie spielten bei den letzten in Pompei abgehaltenen Wahlen eine wichtige Rolle. Das Gebäude bestand aus einem großen, von einer 2geschossigen Säulenreihe umgebenen Hof, an dessen Rückseite sich 3 Apsiden befinden. In der mittleren stand die Statue der Kaiserin Livia, der Frau des Augustus. Hinter den seitlichen Säulenreihen und den Apsiden verläuft ein überwölbter Korridor. Dort wurde auch die gut erhaltene Statue der Eumachia gefunden, die sich wie die der Livia, im Archäologischen Nationalmuseum zu Neapel befindet. Man nimmt an, daß die Korridore als Stapelraum für die Stoffrollen gedient haben und daß der Verkauf im Hofe stattfand. — Als besonders gutes Beispiel für röm. Architekturornamente sei die Marmoreinfassung des Haupttores erwähnt, auf der in feinem Relief Ranken und dazwischen die verschiedenen Tiere eingemeißelt sind.
Das S-Ende des Forums ist von den Gebäuden für die öffentliche Verwaltung umgeben: Rechts vom Bau der Eumachia, auf der anderen Seite der Via dell’Abbondanza, steht das Comitium, in dem die Wahlen für die städtischen Ämter abgehalten wurden. An der Spitze der Gemeinde standen die Duumvirn, ein Zweimänner-Kollegium. Für die öffentliche Ordnung, die Sauberkeit der Straßen und die Circusspiele waren die beiden Ädilen zuständig. Als beratende Körperschaft gab es die Dekurionen, die sich aus den vormaligen Duumvirn zusammensetzten. Die Ämter wurden jährlich erneuert. Diese Verwaltung war in den 3 Räumen an der S-Seite des Forums untergebracht.
Für Gerichtsverhandlungen und für börsenähnliche Geschäfte diente die Basilika rechts daneben. Sie gehört zu den ältesten erhaltenen Gebäuden dieser Art und entstand etwa 120 v. Chr. Der langgestreckte Innenraum ist in 3 Schiffe eingeteilt. 28 hohe, aus Ziegeln aufgemauerte Säulen trugen den Dachstuhl; sie waren ehemals mit weißem Stuck überzogen. Nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. sind sie bis auf Stümpfe abgetragen worden. Die Basilika muß z. Z. des Vesuv-Ausbruchs von 79 n. Chr. eine Ruine ge-
wesen sein. Die Wände waren durch schlankere Halbsäulen in 2 Stockwerke unterteilt, deren untere ionische, deren obere korinthische Kapitelle tragen. Zwischen den Halbsäulen imitiert die Stuckinkrustation einen Wandaufbau im Sinne des 1. Stils: Über den größeren Platten der unteren Zone liegt ein roter Streifen, darüber das eigentliche Quaderwerk der Wand. An der Rückseite des Innenraumes ist die 2geschossige Tribuna wiederhergestellt worden.
Ein anderes Zentrum von öffentlichen und sakralen Gebäuden befindet sich östlich vom Forum beim sog. Forum triangulare. Dort stand auf einem Lavavorsprung, der an 2 Seiten steil abfällt, das älteste Bauwerk von Pompei, ein archaisch-griech. Tempel. Über einem Stufenunterbau erhob sich die Säulenhalle, von der noch 4 Kapitelle erhalten sind. Der weitausladende, flache Echinos ist mit griech. Tempeln auf Sizilien aus dem 6. Jh. v. Chr. vergleichbar. So wird auch dieser Tempel aus der Zeit der 1. griech. Vorherrschaft in Pompei vor 525 entstanden sein.
Etwa 350 Jahre später wurde das Gelände an 2 Seiten von Säulenhallen eingefaßt. In dieser Zeit entstanden auch das runde Brunnenhaus östlich vom Tempel und die kleinen Altäre. Der Kultraum zwischen dem Brunnen und dem Tempel stammt aus der letzten Zeit Pompeis und diente wahrscheinl. demselben Kult wie der 600 Jahre früher erbaute Tempel. Die Funde Von Votivgaben haben gezeigt, daß auf diesem südöstl. Vorsprung des ältesten Stadtgebietes Herakles, der mythische Gründer von Pompei, verehrt worden ist. Später kam noch der Kult der Athena hinzu.
Südlich vom dorischen Tempel fällt das Gelände schroff gegen die antike Küste ab. Den östl. Abhang nimmt der Zuschauerraum des Theaters ein. Seine Lage am Hang und die hufeisenförmige Orchestra sind Merkmale des griech.-hellenistischen Theaters (200-150 v. Chr.). Durch den Duumvirn Marcus Holconius Rufus, für den in der Mitte an einer der unteren Sitzreihen eine Statue aufgestellt war, wurde das Gebäude zu Beginn der röm. Kaiserzeit der Form des röm. Theaters angepaßt. Durch die oben hinzugefügte Galerie und die Tribunalia über den Seiteneingängen schuf man neuen Raum für Zuschauer (etwa 5000). Die wichtigste Veränderung erfuhr die Bühne: Die Rampe wurde nach vorne verlegt und die Rückwand mit den
3 Apsiden errichtet. Grabungen haben aber noch die Reste der gradlinigen griech. Bühne mit den seitlichen Vorsprüngen des Bühnenhauses, den Paraskenien, ans Licht gebracht.
Unter der Orchestra befinden sich Becken, um das Wasser wieder aufzunehmen, mit dem die Orchestra zeitweilig gefüllt werden konnte. An das Bühnenhaus schließt sich ein weiter quadratischer Säulenhof an, die sog. Porticus post scaenam, ein Versammlungsplatz für die Zuschauer vor und während der Aufführung, der kurz vor dem Vesuv-Ausbruch in eine Gladiatorenkaserne umgewandelt worden ist. In den engen Räumen, die an der SO-Ecke wiederhergestellt wurden, konnten während der Spiele die familiae gladiatorum untergebracht werden.
In den Jahren 80-75 v. Chr. erbaute man neben dem. großen Theater noch ein kleineres überdecktes Odeum. Es faßte etwa 800-1000 Zuschauer. Die Stufen der Sitzreihen sind fast völlig erhalten. Sie werden unten an den Seiteneingängen von 2 knienden Telamonen aus Tuffstein flankiert.
An der Rückseite des Theaters liegen 3 öffentliche Gebäude.
Neben dem Eingang zum Forum triangulare diente ein kleiner Säulenhof als Palästra. Hier wurde im 2. und 1. Jh. v. Chr. die vornehme Jugend erzogen. In der Mitte steht ein Altar, und zwischen 2 Säulen wurde zu ebener Erde die Kopie des Doryphoros, der berühmten griech. Statue aus dem 5. Jh. v. Chr. von der Hand des Bildhauers Polyklet von Argos, gefunden. Sie zeigt den mythischen Helden Achill, den man in der späteren Antike als Vorbild für die Jugend in Palästren aufstellte. Die Figur befindet sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel.
Nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. hat die Palästra nach links Platz abgegeben für den Anbau des Isis-Tempels. Die Inschrift über der Tür berichtet, daß der zerstörte ältere Tempel auf Kosten des N. Popidius Celsinus wiederaufgebaut worden ist, worauf die Dekurionen ihn aus Dank für seine Freigebigkeit in ihren Stand aufnahmen, obwohl er damals erst 6 Jahre alt war. — In einem von Säulen umstandenen Hof erhebt sich der kleine Kultraum auf hohem Podium, zu dem eine mittlere Treppe hinaufführt. Unter ihr steht der Altar und neben diesem in der SO-Ecke des
Hofes ein kleiner, mit feinem Stuckrelief verzierter Bau, in dem die Treppe zu einem unterirdischen Bassin führt. Dort wurde das für die Einweihungszeremonien wichtige Nil-Wasser aufbewahrt. An der einen Seite des Tempels ist eine von vorne nicht sichtbare Treppe zum Podium hinauf angebracht. Hinter dem Tempel diente ein größerer Raum für Versammlungen, und seitlich schließen sich die kleinen Zellen an, in denen die Priester wohnten. Dieser Neubau war reich mit Malerei versehen, die sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel befindet. — Der Kult der ägyptischen Göttin Isis hatte sich in den letzten beiden Jahrhunderten v. Chr. in verschiedene Teile des röm. Reiches ausgedehnt. In Pompei war er schon zur Zeit der röm. Republik heimisch. Die durch den Vesuv-Ausbruch konservierte Anlage ist das am besten erhaltene Iseum in Italien.
Links an den Isis-Tempel, und von der Via di Stabia zugänglich, schließt sich das kleine Heiligtum des griech.-sizilischen Gottes Zeus Meilichios an. Der Bau hat offenbar nach dem Erdbeben die Bilder der kapitolischen Trias aus dem Jupiter-Tempel vom Forum beherbergen müssen, denn in ihm sind große Terrakottabilder des Jupiter und der Juno sowie eine Büste der Minerva gefunden worden (heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel).
Die beiden Ansammlungen öffentlicher und sakraler Gebäude befinden sich im SW des Stadtgebiets. Sie nehmen die Stelle der ältesten Ansiedlung ein. Von hier aus ist die Erweiterung der Stadt geplant und regelmäßig durchgeführt worden. Nach N hin wird die Richtung des Forums fortgesetzt. Nach O hin ist der Verlauf der wichtigsten Querstraße, der Via di Stabia, maßgebend. Sie wird fast rechtwinklig von den beiden Hauptstraßen, den Decumani, geschnitten.
Der Rundgang beginnt mit der südlichen Hauptstraße, der sog. Via dell’Abbondanza. Sie geht vom Forum zwischen dem Comitium und dem Gebäude der Eumachia aus und hat ihren heutigen Namen nach dem 1. Brunnen erhalten, der sich vor dem Seiteneingang des Gebäudes der Eumachia befindet: Als Wasserspeier dient ein weiblicher Kopf mit einem Füllhorn, einer Allegorie des Überflusses (it. Abbondanza). Die Straße führt leicht abwärts durch die
Ruinen der älteren Grabungen hindurch, wird nach einer Krümmung vor den 4 Pfeilern eines Tetrapylons etwas breiter und hier von der Via di Stabia geschnitten.
An der Kreuzung stehen die sog. Stabianer Thermen, öffentliche Bäder, die nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. wiederhergestellt wurden. Diese ältesten Thermen von Pompei sind mehrmals erneuert worden. In der ersten, noch vorröm. Zeit umstanden schlanke Tuffsteinsäulen den Hof. Die Wand hinter ihnen ist in der frühen Kaiserzeit im 3. Stil ausgemalt worden, während die dicke Stuckverkleidung der Säulen und die üppige Dekoration der Gebäude links dem 4. Stil kurz vor der Zerstörung entspricht. Der durch diese Stuckierung geschmückte Teil war für eine Neuerung im antiken Badebetrieb bestimmt: Zwischen 2 durch weite Bögen geöffneten Räumen befindet sich ein Schwimmbecken, die Natatio, unter freiem Himmel.
Die Bäder selbst liegen hinter der östl. Säulenfront, mit getrennten Eingängen zu den Anlagen für Männer und für Frauen. Dazwischen befinden sich die Heizräume. In beiden Teilen wird die gleiche Raumfolge wiederholt, die in allen röm. Bädern typisch ist: Hinter dem Eingang liegt der Raum für die Kleiderablage mit eingelassenen Kästen an der Wand, das Apodyterium; links vom Eingang des Männerteils in einem kleinen Kuppelraum das runde Becken für das Kaltbad, das Frigidarium. Hinter einem 2. mäßig erwärmten Raum, dem Tepidarium, folgt der heiße Raum, das Calidarium, mit dem Becken für heißes Wasser (Alveus) auf der einen, dem Brunnen mit kühlem Wasser (Labrum) in einer Apsis auf der anderen Seite. Im Teil der Männer sind in den heizbaren Räumen die Gewölbe und die Fußböden eingestürzt. Man sieht in die für die heiße Luft bestimmten Zwischenräume unter dem Boden und hinter der vorderen Wandschicht.
Der Teil für die Frauen wurde durch lange Gänge von den Seitenstraßen her betreten. Im Tepidarium ist noch die weiße und im Calidarium die rote, durch gelbe Pflaster unterteilte Wandbemalung erhalten. — An der Rückseite des Säulenhofes befinden sich die Latrine und in einem Gang Kabinen für Einzelbäder.
Hinter der Kreuzung mit der Via Stabiana wird die Via dell’Abbondanza schmaler und führt durch ein Viertel, in
dem die Läden an der Straßenseite mit den dahinter liegenden Häusern verbunden sind. Hier wohnte eine aufstrebende Schicht von Handwerkern, die ihren Verdienst schon in der Ausmalung der Häuser anlegten. Von der 1. Querstraße an beginnen die sog. Scavi Nuovi, die neuen Grabungen, bei denen versucht worden ist zu konservieren, was sich erhalten hat, wie etwa den Verputz der Häuser mit den rot aufgemalten Wahlvorschlägen und den Fassadenmalereien. Die durch das zerfallene Holz entstandenen Hohlräume sind mit Zement ausgefüllt worden. So konnten viele Bretter von geschlossenen Läden und auch einige mit Bronzenägeln verzierte Haustüren erhalten werden.
Unter den Schutzdächern links Reste der Fassadenmalerei: zwischen 2 Türen auf einem Elefantengespann die Venus Pompeiana, die Schutzgöttin der Stadt. Sie trägt ein blaues Gewand und eine goldene Krone und stützt sich mit ihrer Linken auf ein Schiffruder, ein Zeichen dafür, daß auch die Schiffahrt der Handel treibenden Stadt ihren Schutz genoß. Links neben ihr steht in einem gelben Gewand der zu ihr gehörige Amor, der einen Spiegel hoch hält. Links neben dem Elefantengespann erscheint der Genius des Hauses und der Familie, rechts eine Abbondanza. Das Bildfeld darunter zeigt, daß in diesem Hause Tuch verarbeitet wurde. Es folgt eine größere Ladenöffnung, über der auf gelben Feldern zwischen dem Bild des Sonnengottes und der Mondgöttin Jupiter und Merkur gemalt sind. Am Pfeiler links steht die Venus Pompeiana mit einem grün gekleideten Amor. Auf diesem Bild sind die seitlich fliegenden Putten besser erhalten als bei der Venus auf dem Elefantenwagen.
Dieser Fassade gegenüber liegt der Eingang zu 2 Häusern mit Resten von Malerei: Rechts die Casa del Larario di Achille (Nr. 4), mit einem rückwärtigen Saal. Er ist im 2. Stil ausgemalt, die Farbe jedoch stark verblichen. Der großfigurige Fries zeigt u. a. 2 Elefanten. — Links davon die Casa del Criptoportico (Nr. 2), ein mehrfach überbautes Gebäude. In der Zeit vor der Zerstörung waren hier kleinere Wohnungen eingerichtet, doch aus einer reicheren, frühen Phase zeugt im hinteren Teil ein Kryptoportikus, der wegen des immer höher gelegten Fußbodens schließlich zum Keller wurde. Hier sind die Körper vieler Flüchtlinge gefunden und ausgegossen worden. Aus der Zeit, als der Gang zum Keller geworden war, stammen auch die Zwischenwände. Der Portikus ist im 2. Stil (vor der Mitte des 1. Jh. v. Chr.) ausgemalt.
Die rote Wand unterteilen gelbe Hermenpilaster. Zwischen ihnen hängt eine Girlande aus Früchten, Blättern und Ähren, die nur noch an wenigen Stellen erhalten blieb. Über einem Fries aus farbigen
Quadraten erscheinen die Hermenköpfe und dazwischen einzelne Bilder. Den Sockel bildet ein roter Mäander auf schwarzem Grund. Das Tonnengewölbe war mit einem Stuckrelief geschmückt. Am Ende des linken Korridors befindet sich ein tonnengewölbter Festsaal. Über dem schwarzen Sockel ist hier eine gelbe Wand von roten Pilasterhermen unterteilt. Die auf dem Fries stehenden Bilder imitieren Tafelgemälde. Die perspektivisch gemalten Läden konnten bei den wirklichen Bildern zugeklappt werden. Über der Bilderzone folgt ein 2. Fries und darüber eine perspektivische Rosettendecke, die von roten Hermenpilastern getragen wird. Darüber sind die Reste eines Stuckfrieses erhalten, geflügelte Stiere und der Ansatz der fruchtgeschmückten Stuckrippen des Tonnengewölbes. 2 kleinere Cubicula, ebenfalls im 2. Stil ausgemalt, schließen sich links an. Die Perspektive der aufgemalten Architektur sowohl im Gang wie im hinteren Raum nimmt auf den Betrachter Rücksicht, und zwar so, daß sie sich auf einen bestimmten Standort richte — im hinteren Raum nahe dem Eingang; im Gang lösen sich eine Reihe von Blickpunkten ab, so daß der Betrachter von der Treppe her den Gang quasi entlanggeführt wird.
An der Rückseite der Insula mit den Häusern des Larario di Achille und des Criptoportico steht noch die guterhaltene Fassade des Hauses des Lucius Caius Secundus (Region 1, Insula 6, Nr. 15). Durch den Stuck wird ein Quaderwerk imitiert. An 3 Seiten des kleinen Gartens stellen die Bilder ägyptische Szenen und eine Tiergruppe dar. Die Dekoration der Räume ist im 3. Stil ausgeführt. Im Atrium mit dem kleinen Marmorbrunnen führt die Treppe zum nachträglich aufgestockten Obergeschoß.
Gegenüber liegt das größte Anwesen dieser Gegend, das sog. Haus des Menander (Region 1, Insula 10, Nr. 4). Mit seinem unregelmäßigen Grundriß nimmt es fast die ganze Insula ein. Es gehörte einem Quintus Poppaeus. Hier ist ein reicher Silberschatz gefunden worden, der heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel aufbewahrt wird. Die Ausmalung im 4. Stil ist teilweise erhalten und gut konserviert. Durch den schwarzen Eingang mit den fliegenden Schwänen inmitten der Felder betritt man das rot-gelb gehaltene tuskanische Atrium mit dem Laren-Heiligtum rechts, daneben führt eine Treppe ins obere Geschoß. In der Mitte der roten Bildfelder sind Theatermasken angebracht, darüber ein Fries von Landschaftsdarstellungen. In dem Zimmer links schweben in den roten Bildfeldern Putten. Vor den weiß gemalten Prospekten zwischen den roten Feldern stellen Bilder Szenen aus der Eroberung von Troja dar: 1. Der Seher Laokoon, der vor dem unheilbringenden Pferd warnt, wird mit seinen 2 Söhnen von den Schlangen des Poseidon getötet; 2. der feierliche Einzug des Trojanischen Pferdes durch die Bresche in der Stadtmauer; 3. Aias ergreift die zum Palladion geflüchtete Kassandra. — Die Wände des Tablinums sind wie die des Atriums mit roten und gelben Fel-
dem geschmückt. An ihm vorbei führt ein im unteren Teil schwarz gehaltener Gang in den Garten, auf dessen Seiten sich eine Reihe von Räumen öffnet. Auch hier herrschen die Farben Schwarz, Rot und Gelb vor. In der Mitte der Farbflächen sind schwebende Figuren oder kleine Landschaftsbilder aufgemalt. — Unter dem großen Saal wurden Reste eines älteren Hauses mit Mosaik und Wandbekleidung aus dem 2. Stil aufgedeckt. — An der SO-Ecke befindet sich der Zugang zu den Ställen, daneben ein kleiner Raum mit 2 bronzebeschlagenen Bettgestellen. Nach der Bemalung der gelben Nische in der Mitte der Rückseite, die von der Vorliebe des Besitzers für die griech. Komödie zeugt, trägt das Haus seinen Namen. An der Rückwand liegen auf 2 dreibeinigen Tischen Theatermasken, links und rechts ist je ein sitzender Dichter dargestellt; den besser erhaltenen auf der rechten Seite bezeichnet eine heute kaum mehr sichtbare Inschrift als Menander, dessen Stücke auch für die latein. Komödiendichter als Vorbild gedient „haben. In der SW-Ecke steht ein Altar für den Ahnenkult. Die Wachsbildnisse der Ahnen sind von der heißen Asche übel zugerichtet und verbrannt worden. Die entstandenen Hohlräume wurden bei der Ausgrabung mit Gips ausgefüllt.
An der W-Seite des Gartens liegen die Räume für das Bad. Daneben führt ein Gang zur Küche und zum Küchengarten. Die NW-Ecke nimmt ein Raum mit grünen Wänden ein. In ihm steht ein bronzenes Kohlenbecken.
Die Via dell’Abbondanza führt weiter an verschiedenartigen Läden und Hauseingängen vorbei (in einem das Mosaik des vor der Tür angeketteten Hundes). Zu den ältesten Gebäuden gehören die beiden nebeneinander stehenden Fassaden samnitischer Häuser mit der offenen Loggia im Obergeschoß.
In einem Thermopolium auf der rechten Seite (Region 1, Insula 9, Nr. 8), ist in die Rückwand ein Larenaltar gemalt, der opfernde Genius der Familie in der Mitte zwischen den beiden Laren mit dem Trinkhorn in der einen Hand. Rechts steht Dionysos mit dem Panther, links Merkur. — Gegenüber (Region 9, Insula 13, Nr. 1-2) ist eine 2geschossige Fassade wiederhergestellt worden. Zwischen den beiden Haustüren liegt ein Laden. Im Atrium Nr. 2 eine Scheintür.
Links an der Ecke zu einer Seitenstraße, die nach rechts zur Porta di Nocera hinunterführt, öffnet sich ein eigenartiges Gebäude mit seiner ganzen Front zur Straße hin (Region 3, Insula 3, Nr. 6). Die gesamte Dekoration hat einen militärischen Charakter: Die Außenwände zeigen
Waffentrophäen auf gelbem Grund; zwischen den Pilastern innen schweben auf rotem Grund Victorien mit Waffen im Arm, Adler und Globus mit Strahlen. Man nimmt deswegen an, daß der Saal einer militärischen Gesellschaft als Versammlungsraum gedient hat und daß die Holzregale über den Pilastern, von denen sich noch Reste fanden, zum Aufbewahren von Waffen benutzt wurden. Gegen die Straße konnte der Saal durch einen Laden geschlossen werden, Von dem Aschenreste erhalten blieben.
Die Seitenstraße links führt zu dem kleinen Haus des Pinarius Cerealis (Casa di Ifigenia). Wegen des Fundes von 114 Gemmen, Kameen und Glaspasten, z. T. bearbeitet und mit Figuren versehen, z. T. noch im Rohzustand, hat man angenommen, daß hier ein Gemmenschneider wohnte. An einen kleinen Garten schließen sich 3 Räume an, von denen der eine, ein Cubiculum, mit einer der schönsten Dekorationen des 4. Stils ausgemalt ist. An 3 Seiten erscheinen Szenen, die offenbar Theateraufführungen wiedergeben. Auf rotem Grund stellt jede der Wände eine »scenae frons«, eine Theaterrückwand, dar. Auf der erhaltenen Wand tritt Iphigenie durch die mittlere Tür; links stehen ihr Bruder Orest und sein Freund Pylades, die nach Tauris gekommen sind, um sie zu entführen. Ihr Plan wird entdeckt; links sitzt der König Thoas über sie zu Gericht.
Das Haus des Loreius Tiburtinus (Region 2, Insula 2, Nr. 5) nimmt die Insula völlig ein. Der Eingang zwischen 2 Läden liegt etwas zurück, an seinen Seitenwänden sind Bänke für die Klientel angebracht. Die großen Türflügel des Portals verzieren vorstehende Bronzenägel. Im Atrium fehlt der Verputz an den Wänden; die Restaurierung nach dem Erdbeben von 62 war noch nicht zu Ende gediehen. Die angrenzenden Zimmer sind im 4. Stil ausgemalt. Nach O liegt ein Raum, über dessen schwarzem Sockel gelbe Felder mit weißen Prospekten abwechseln. Auf den gelben Feldern sitzen kleine Landschaftsbilder. An der SW-Ecke schräg gegenüber erscheinen über einem gelben Sockel rote Felder zwischen schwarzen Prospekten, von einem schwarzen Fries und einer oberen roten Zone bekrönt. Auf den roten Feldern sind einzelne Figuren aus der griech. Mythologie angebracht. — Der anschließende Garten besteht aus einem oberen kleinen und einem tiefer gelegenen großen Teil. Um den kleinen Garten liegen Räume, die überaus reich im 4. Stil dekoriert sind. Teile der Decken konnten restauriert werden. Weiß über schwarzem Sockel und Gelb sind die Farben in den 3 Zimmern rechts. In den letzten ist das System der Dekoration am besten erhalten mit weißen, rot gerahmten Feldern, die auf Grund der Perspektive hinter den tiefen schwarzen Prospekten liegen müßten. Darüber zieht sich ein mit Ädiku-
len, Girlanden und Figuren durchsetzter, heiterer weißer Fries hin. In der Mitte des weißen Feldes rechts vom Fenster steht ein Isis-Priester, mit kahlgeschorenem Kopf, weißem Gewand und Fransen, mit der Metallrassel, dem Sistrum in der rechten Hand. Die Inschrift unter seinen Füßen — »altus alumnus Tiburs« — besagt viell., daß es sich um ein Porträt handelt. — Im größeren Raum links vom oberen Garten sind über dem hohen, marmorierten Sockel 2 Bildfriese angebracht, dessen oberer die Taten des Herakles erzählt. — Durch eine weite Öffnung tritt man in eine Säulenhalle hinter einem Wasserkanal, über den eine Brücke in eine Pergola und einen kleinen 4säuligen Tempel führt. Auf der roten Rückwand sind zwischen Hermen Tierjagden aufgemalt. Am Ende des Kanals steht eine Brunnennische an einem Sommertriclinium. Seitlich der Nische: Narziß sowie Pyramos und Thisbe. — Mehrere Stufen unterhalb der Säulenhalle liegt der große Garten. Auch ihn durchzieht ein Wasserkanal, der durch Becken mit Wasserspielen und Podesten für Statuen unterteilt wird. Bei den Grabungen wurden die verkohlten Stümpfe großer Bäume gefunden. Sie standen zu beiden Seiten des Kanals in regelmäßigen Abständen mehrere Reihen tief. (Tafel bei S. 513.)
Nach dem Bild in der Gartenwand wird das Haus Region 2, Insula 3, Nr. 3 Casa di Venere genannt. Von den Räumen um das Atrium ist rechts ein schwarzes Cubiculum gut erhalten. Der Sockel, die Felder und die Prospekte haben die gleiche Farbe. Rot und Grün ist für die Rahmen verwendet. In den schwarzen Prospekten sieht man auf rote, schräg in den Raum gestellte Wände mit grünen Balkons. Sie werden von vergoldeten Schiffsschnäbeln getragen. Über den schwarzen Feldern stehen Bilder mit Stilleben. — Vom Atrium führt eine weite Öffnung in den Garten. Er ist von weiß und gelb stuckierten Säulen umstanden, die Wände sind in rote und gelbe Felder unterteilt, auf deren Mitte schmale Bilder Villenlandschaften zeigen. — Links im gelben Zimmer sind in den weißen Prospekten Mädchengestalten zu sehen, im blauen Zimmer schweben Putten in den Feldern. Im großen Saal rechts blieb nur der weiße Mosaikfußboden erhalten. Dem Saal schließt sich eine Flucht kleinerer Zimmer an. Die Rückwand des Gartens und das vor die Säulen geschobene Zimmer links mit dem Fenster sind einheitlich dekoriert. Am Sockel ist ein Zaun aus quergestellten Latten angegeben. Man sieht über ihn in einen gemalten Garten mit Pflanzen und Vögeln. Auf den Sockeln vor dem Zaun stehen Marmorvasen als Springbrunnen und die Statue eines Kriegers, viell. Mars. Das Mittelfeld der Rückwand schmückt ein großes Gemälde: Venus auf einer Muschel, vor ihr reitet Amor auf einem Delphin.
Region2, Insula 4 an der rechten Straßenseite gehörte zuletzt einer Julia Felix, die ihr großes Anwesen in verschiedener Weise nutzte. Sie vermietete für größere Festlichkeiten einen
Ziergarten. Man gelangte zu ihm durch ein rotes Atrium ohne Nebenräume von der Via dell’Abbondanza aus und kam in eine Halle, deren Dach von feinen Marmorpfeilern getragen wird. Zu ihrer Mitte öffnen sich die Festräume: ein Triclinium mit einer Wassertreppe an der Rückwand und zwei seitlichen Cubicula. Die Malerei wurde im 4. Stil ausgeführt. Im Triclinium sind Reste einer Nil-Landschaft zu sehen. Neben und hinter den 3 Festräumen liegen Räume und Gänge für Vorbereitung und Dienerschaft. Vom Triclinium aus geht der Blick durch 2 höhere, weiter auseinandergestellte Pfeiler in den Garten und über den Wasserkanal, den sog. Euripus, zu einer Nischenfront hinter einer Pergola aus grünen Stuckpfeilern. — Am Ende der Halle befindet sich der Eingang zur Wohnung der Julia Felix, die ein 2. Atrium mit Tablinum und Nebenräume umfaßt. Sie sind im 4. Stil dekoriert. Die Bilder wurden bei der 1. Grabung in diesem Haus, 1755, herausgeschnitten und befinden sich heute im Louvre. Die östl. Räume haben Fenster zu dem Obstgarten, der den größten Teil des Anwesens einnimmt. — Außer der Vermietung des Festgartens und dem Ertrag aus der Obstpflanzung brachte auch eine Thermenanlage Einkünfte. Sie konnte ebenfalls vermietet werden. Der Eingang erfolgte durch eine andere Tür von der Via dell’Abbondanza aus in einen Säulenhof, an den sich in 3 tonnengewölbten Räumen die für Thermen übliche Folge anschloß: der Ankleideraum, das Apodyterium, mit dem Becken für kaltes Wasser; rechts (eingestürzt) das Tepidarium und das Calidarium, die erhitzten Räume. Links war ein Zugang zum Festgarten und zu einer Latrine. Von der Vorhalle aus führt eine 2. Tür an der Ecke zur Natatio, dem Schwimmbecken, das man auch von einer Kneipe aus betreten konnte, einer weiteren Geldquelle für Julia Felix. Im 1. Raum die Marmorbank mit den eingelassenen Gefäßen für die Getränke, im 2. ein Triclinium und Bänke mit Tischen. Dazwischen liegt eine Küche.
Die letzte Insula an der rechten Seite der Via dell’Abbondanza vor der Porta di Sarno (Region 2, Insula 5) ist unbebaut geblieben. Dort befand sich ein großer Weingarten. Etwa 2000 Weinstöcke sind in regelmäßigen Abständen von fast 1 m (= 4 röm. Fuß) eingepflanzt gewesen. Ihre Wurzeln konnten bei den sorgfältig durchgeführten Grabungen festgestellt werden. Außerdem standen in dem Garten, v. a. der Mauer entlang, z. T. hohe Bäume. 2 Wege teilten das Gelände; sie kreuzten sich etwa in der Mitte; der eine kommt von einem Triclinium neben dem S-Eingang am Platz vor dem Amphitheater, der andere führt zu einem kleinen Haus an der W-Wand. Hier befanden sich die Weinpresse und 10 große, in den Boden eingelassene Tongefäße
zum Aufbewahren des Weines. Neben diesem Haus liegt ein 2. Triclinium, wo ebenso wie gleich am Eingang vom Amphitheater her der Wein ausgeschenkt werden konnte.
Dieser Garten am O-Ende der Stadt, aber noch innerhalb der vorröm. Stadtmauer, lehrt zusammen mit anderen Gärten in dieser Gegend (etwa dem der Julia Felix und einem neben der Palästra), daß Pompei in einer anderen Richtung gewachsen ist, als es bei der Anlage der Mauern geplant war. Nachdem die Befestigung im Rahmen der Pax Romana, des Friedens innerhalb des röm. Reiches, überflüssig geworden war und sich gleichzeitig ein Sinn für landschaftliche Schönheit entwickelt hatte, gewannen die W-Seite der Stadt mit ihrem Blick über den Golf von Neapel und die Hänge des Vesuvs an Bedeutung, während die von diesen Ausblicken abgewendete Seite zum Sarno-Tal hin einen fast ländlichen Charakter bewahren konnte.
In dieser nur locker besiedelten SO-Ecke der Stadt war auch genügend Raum für ein so ausgedehntes Gebäude wie das Amphitheater. Mit seinem Oval grenzt es im N und W an einen großen, baumbestandenen Platz. Die S- und O-Seite sind an die Stadtmauer angebaut, so daß der Zutritt von hier nicht möglich ist. Die Plätze auf dieser Seite erreichte man über einen langen Gang durch das Gebäude hindurch. Eine Bauinschrift nennt als Bauherren dieselben Beamten, die auch den Bau des kleinen Theaters bezahlt haben. Das Amphitheater ist um 80 v. Chr. errichtet worden und somit das älteste heute noch bekannte Bauwerk dieses für die röm. Architektur so kennzeichnenden Typus. Die frühe Entstehung erklärt auch die Unterschiede, die es zu den anderen noch erhaltenen Amphitheatern aufweist. Es fehlen die unterirdischen Gelasse für die wilden Tiere, die Installationen für Wasserspiele und für die getrennten Zugänge zu den verschiedenen Rängen von Sitzreihen. In Pompei mußten die Zuschauer bis zu der obersten Reihe emporsteigen und konnten sich erst von dort über die Sitzreihen verteilen. Die Arena liegt tiefer als der Platz um das Amphitheater. Diese einfache Konstruktion zeigt, daß z. Z. der Erbauung dieser Gebäudetyp noch am Anfang seiner Entwicklung stand und daß es noch nicht die später so beliebten Schaustellungen der Tierkämpfe und die Seeschlachten gab.
Wäre Pompei nicht verschüttet worden, so hätte man sehr bald mit dem Abbruch und dem Neubau des Amphitheaters beginnen müssen. In Rom entstand damals gerade mit dem Kolosseum die klassische Ausführung dieses Gebäudetyps. — Der Platz vor dem Amphitheater war von hohen Platanen beschattet, deren Wurzeln von den Ausgräbern mit Zement ausgegossen worden sind. Ein im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel aufbewahrtes Wandbild aus Pompei zeigt eine Ansicht des Amphitheaters während jenes schon erwähnten Gemetzels, bei dem die Pompejaner ihre Zuschauergäste aus Nocera wegen gegenteiliger Beurteilung der Gladiatorenkämpfe niedergemacht haben. Wie Tacitus berichtet, wurde das Amphitheater daraufhin vom Senat für 10 Jahre geschlossen (59 n. Chr.).
Am Platze vor dem Amphitheater liegt auch die große Palästra, ein Gebäude für die sportliche Erziehung der Jugend. Das 140 x 130 m messende Gelände ist von einer hohen Mauer umgeben, an der sich an 3 Seiten die für diese Einrichtung typischen Säulenhallen entlangziehen. Auch hier standen vor den Säulenhallen hohe Platanen. In der Mitte des Platzes befindet sich ein Schwimmbecken, an der S-Seite eine Latrine, in die sich beim Vesuv-Ausbruch Menschen geflüchtet haben. Die gegen den Vesuv gelegene N-Wand ist durch die Last der von dort anfliegenden Asche umgelegt worden (die heutige Wand neu). An dem noch stehenden Stück sind Reste der Dekoration des 4. Stils zu sehen.
In einem Garten westlich der Palästra befindet sich ein Triclinium: eine 3seitige gemauerte Liegebank um einen ebenfalls gemauerten Tisch, davor 2 Brunnen mit mosaizierten Nischen. 4 Säulen trugen ehemals ein Holzgebälk.
Von hier führt eine Querstraße der Via dell’Abbondanza zur Porta Nocera hinunter, einem einfachen Tor der vorröm. Befestigung. Vor ihr senkt sich eine Rampe von der Höhe des Stadtgebiets hinunter zu der Straße vor der Stadt, die an der Mauer entlang nach O die Verbindung zur Nachbarstadt Nocera herstellte. Rechts in einem Gebäude neben der Rampe liegen die Gipsausgüsse einiger beim Vesuv-Ausbruch an dieser Stelle ums Leben gekommener Menschen.
In dem Vorstadtgebiet ist ein Teil der Nekropole von Pompei freigelegt worden. Auch vor anderen Toren befinden sich entsprechend dem antiken Brauch, die Toten vor der Stadt in »Totenstädten« beizusetzen, die für die röm. Zeit typischen, verschiedenartigen Grabbauten. Das Gebiet vor der Porta Nocera wurde erst in neuerer Zeit von der Asche befreit, so daß hier die Witterung noch nicht so sehr auf die Reste eingewirkt hat wie vor den anderen Toren.
Die Landstraße nach Nocera, die hier als Gräberstraße dient, wird von der aus der Stadt kommenden Straße geschnitten. Westlich der Kreuzung erhebt sich ein repräsentatives Grab aus Tuffquadern; auf rechteckigem Unterbau steht eine halbkreisförmige Exedra. Die Bekrönung aus Säulen und Altären überragte nach dem Ausbruch die Aschenschicht und ist als Baumaterial später abgeräumt worden. Eine große Inschrift nennt die Verstorbenen: »Eumachia L[ucii] f[ilia] silai et suis« (Eumachia, die Tochter des Lucius, für sich selbst und ihre Angehörigen). Es ist das Grab jener reichen Priesterin und Vorsteherin der Tuchmacherzunft, die auch am Forum das Gebäude des Tuchmarktes erbauen ließ und deren Porträtstatue im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel steht. Es folgen Gräber mit Ädikulen, in denen die Statuen der Verstorbenen aus Tuffstein aufgestellt sind, schließlich das Monument der Familie der Tillii, die mehrere Stadtvorstände (Duumviri) von Pompei gestellt hat, und das Grab des Augustalen Publius Vesovius Philerus, der sich in einer Inschrift über die falsche Beschuldigung eines Freundes beklagt und diesem den Fluch der Penaten und der Unterweltsgötter herbeiwünscht. Östlich der Straßenkreuzung steht ein Rundgrab, ein sog. Tumulus, den die reiche Veia Barchilla für sich und ihren Mann errichten ließ. Die Mauern der hintersten Gräber in dieser Reihe sind im 4. Stil bemalt; sie stammen aus der letzten Zeit von Pompei.
Nach N führt vom Forum aus eine Straße rechts am Jupiter-Tempel vorbei. Hinter dem Ehrenbogen für Augustus wird sie links von Läden begleitet, während rechts nach 3 Ladenöffnungen eine Reihe von Säulen und Pilastern vor das Untergeschoß der Häuser gestellt ist und einen Laubengang bildet, ein erster Ansatz für die im 2.
und 3. Jh. n. Chr. so beliebten Säulenstraßen, welche die Straßen im ganzen Mittelmeergebiet in offene Säle und Höfe umwandelten. Eine wichtige Rolle bei der Gestaltung dieser Säulenstraßen spielten die Ehrenbögen, durch die sie in einzelne‚ überschaubare Abschnitte unterteilt wurden. Auch hier steht als Abschluß dieses noch kurzen Stückes hinter der Straßenkreuzung der Ehrenbogen für Caligula.
An der Kreuzung erhebt sich auf hohem Podium der Tempel für die Fortuna Augusta. In der Cella trägt der Architrav der Nische für die Statue des Augustus die Inschrift des Bauherrn. Demnach hat ein Marcus Tullius, der 15 Jahre lang Duumvir (Stadtvorstand von Pompei), Augur und Militärtribun war, das Heiligtum auf seinem eigenen Grund und Boden und auf eigene Kosten errichten lassen.
Die vor dem Bogen des Caligula vorbeilaufende Via di Nola, eine der beiden Hauptstraßen in der WO-Richtung, führt nach O zur Porta di Nola, an der eine Reihe reicher Häuser aus der vorröm. Zeit und eine der 3 öffentlichen Thermen liegen (dem Fortuna-Tempel gegenüber). Man betritt diese Bäder von der Via di Nola aus. Die Bäder für die Männer und für die Frauen hatten getrennte Eingänge. Man erreicht den noch gut erhaltenen Teil für die Männer durch einen schmalen Gang und gelangt in einen 1. Gewölberaum, das Apodyterium, in dem 2 Flüchtlinge beim Vesuv-Ausbruch erstickt sind. Die linke Tür an der gegenüberliegenden Schmalseite führt in den Säulenhof, die Palästra, die rechte in einen runden Kuppelraum mit dem Kaltwasserbecken. Nach rechts folgt das mäßig erwärmte Gewölbe, das Tepidarium.
3 Bronzebänke stehen um das Bronzebecken, mit dem dieser Raum vor dem Einbau der unterirdischen Heizkanäle, der Hypokausten, erwärmt wurde. Die Telamonen, die das Gesims unter dem Gewölbe tragen, entstammen dem Urbau (kurz nach 100 v. Chr.), während der Stuck am Gewölbe aus der Zeit der Restaurierung nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. herrührt. Im 3. Gewölberaum, dem Calidarium, sieht man durch Schadstellen im Boden und an den Wänden in die Heizkanäle. In diesem heißesten Raum befindet sich das Heißwasserbecken und in der Apsis das Labrum, ein Springbrunnen für kaltes Wasser. Die Inschrift am Beckenrand besagt, daß es von den Duumvirn Gnaeus Melissaeus Aper und Marcus Staius
Rufus i. J. 3/4 n. Chr. für den Preis von 5240 Sesterzien gekauft worden ist.
Den Thermen schräg gegenüber befindet sich der Eingang zum sog. Haus des tragischen Dichters ( Region 6, Insula 8, Nr. 5), mit dem Mosaik des angeketteten Hundes auf dem Boden (die Inschrift »Cave canem« besagt: Vorsicht vor dem Hund). In Bulwers Roman »Die letzten Tage von Pompeji« dient dieses Haus als Vorbild für das Haus des Glaukos. Viele der in diesem Gebäude entdeckten Wandbilder befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Aus dem Tablinum hinter dem Atrium stammen das Mosaik von der Einstudierung eines Theaterchores und das Gemälde mit dem Tod der Alkestis. — Im Peristyl befindet sich ein einfaches Lararium in Form einer Ädikula. — Das Triclinium ist im 4. Stil ausgemalt. Über schwarzem Sockel liegt ein roter Streifen; darüber herrschen die gelben Flächen vor; zwischen ihnen Durchblicke auf fantastische Architekturen vor blauem Grund. Die Bilder auf den gelben Flächen zeigen links Adonis, darüber Marsyas und Olympos; in der Mitte läßt Theseus Ariadne auf Naxos zurück, und rechts verläßt Äneas Dido. Aus diesem Haus stammen auch (heute im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel) die Hochzeit des Achill mit Chryseis, des Kronos mit Rhea sowie die Opferung der Iphigenie. Einige angrenzende Läden sind von diesem Haus aus zu betreten, das einem in der letzten Zeit von Pompei reich gewordenen Kaufmann gehörte.
Eines der großen Häuser, die eine ganze Insula einnehmen, das Haus des Pansa, liegt links vom Haus des tragischen Dichters. Es stammt aus der vorröm. Zeit und ist unter hellenistischem Einfluß entstanden. Vom ehem. Reichtum zeugen noch die sorgfältig bearbeiteten Quadern an der Fassade und die Pilasterkapitelle am Eingang. Später wurde das Haus aufgeteilt und vermietet, so auch die Läden zu seiten des Eingangs, deren Mauerwerk (opus reticulatum) aus der frühen Kaiserzeit stammt. Durch den Eingang geht der Blick über das Impluvium im Atrium und durch die Säulen des Peristyls auf den Garten, der den ganzen rückwärtigen Teil der Insula einnimmt.
Auf der gleichen Straßenseite, gegen die Porta di Nola zu, steht ein gut erhaltenes Haus aus der vorröm. Zeit, das ebenfalls eine ganze Insula einnimmt (Region 6, Insula 12, Nr. 2). Noch reicher als das Haus des Pansa, bewahrte es bis zum Ende sein herrschaftliches Gepräge. Nach der Bronzefigur eines tanzenden Fauns wird es das Haus des Fauns genannt. Es hat 2 Eingänge und 4 Läden
an der Front. Der 2. Eingang ist später anstelle eines Ladens hinzugefügt worden. An den Pilastern und Kapitellen des Haupteingangs haben sich Reste des Marmorstuckes erhalten, mit dem die Fassade ehemals verputzt war. Die Fauces des Eingangs sind im 1. Stil inkrustiert: unten Marmorimitation, oben 2 Säulenfronten aus Stuck, mit dahinter liegenden Scheintüren. Im Impluvium des tuskanischen Atriums steht ein Nachguß der namengebenden Faun-Statuette. Kleine Cubicula schließen sich an. Nach rechts führt ein Gang zum 2. Atrium, um dessen Impluvium 4 korinthische Säulen stehen.
Aus diesem Haus stammt ein großer Teil der Mosaiken im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. So befand sich auf der Schwelle vom Eingang zum Atrium ein Fries mit Frucht- und Blättergirlanden und 2 tragischen Masken; in den beiden Alae rechts und links hinter dem Atrium das »Tauben«- und das »Katzenmosaik«. In den beiden Räumen zu seiten des Tablinum an der Rückseite des Atrium saßen im Fußboden die »Meerfauna« und der »Bacchische Genius auf dem Panther«. Das berühmteste Mosaik aber befand sich auf dem Boden des Triclinium an der Rückseite des nun folgenden Peristyls aus 28 Tuffsäulen mit ionischen Kapitellen. Auf der Schwelle zwischen den stuckierten korinthischen Säulen mit den noch rot eingefärbten Kapitellen lag das 3teilige Nilmosaik und im Raum selber das »Alexandermosaik«.
Rechts vom Triclinium führt ein schmaler Gang in den Garten. Seine ionischen Säulen sind in der letzten Zeit von Pompei erneuert worden. Vorher standen auch hier Tuffsäulen. Der Umgang hatte urspr. 2 Geschosse, Reste der kleinen Säulen vom Obergeschoß stehen an der Wand rechts. In dem Triclinium neben dem Alexandermosaik lag im Fußboden das Mosaik mit dem Kampf eines Löwen mit einem Panther. Die Reste lassen noch erkennen, wie ein solcher Fußboden geordnet war: An den Rändern lief ein Wellenband aus schwarzen und weißen Steinen entlang, ein sog. laufender Hund. Das übrige war weiß und in der Mitte das Bild eingelassen. An fast allen Wänden sind noch Spuren der strengen Dekoration 1. Stils zu sehen. In einem der Räume am Garten sind die Grabungen tiefer geführt worden und haben die Reste kleinerer Häuser erbracht, die beim Bau des hellenistischen, palastartigen Baues überdeckt worden sind. An der Seite führt ein Gang in den Wirtschaftsteil des Hauses und zu den Treppen in das Obergeschoß. Erst kommt die Küche mit Brunnen, Herd und
einer Ädikula für die Laren, dann ein Bad mit heizbarem Fußboden.
Dem Haus des Fauns gegenüber liegt der Eingang zum Haus mit den Figuralkapitellen (Region 7, Insula 2, Nr. 57). Es stammt ebenfalls aus vorröm. Zeit und hat im Peristyl mit den dionysischen Kapitellen eine Wand des 1. Stils bewahrt. Die Figuralkapitelle waren im Atrium mit dem rechteckigen Impluvium angebracht.
Rechts neben dem Haus der Figuralkapitelle führt eine gekrümmte Gasse zu einer größeren Bäckerei (links, Nr. 22) mit Ofen und 4 Mühlen aus Lavastein. — In derselben Insula 2 liegt das Haus des verwundeten Bären (Nr. 45), so genannt nach dem Mosaik im Eingang, durch den der Blick über das Atrium zum Garten und einem Mosaikbrunnen führt. Dieser hat die Form einer mit Mosaik überzogenen Nische. In der Apsis erscheint Venus in einer Muschel, unter ihr ein Fries mit Tieren.
Rechts davon führt eine Gasse zum Lupanar (Region 7, Insula 12, Nr. 18), dessen Obergeschoß restauriert werden ist. Zu ebener Erde liegen kleine Räume, deren Wände mit Malerei und Graffiti bedeckt sind.
An der Kreuzung der Via di Nola mit der Via Stabiana liegen die zentralen Thermen. Sie sind als letztes und größtes der 3 öffentlichen Bäder errichtet worden und waren nur für Männer zugänglich. Gegen die Straße hin ist die Front für Läden bestimmt. Im Inneren beherrscht die große Palästra die Anlage, die nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. erbaut wurde.
Die Via di Nola weiter hinunter folgt auf der rechten Seite die sog. Casa del Centenario (Region 9, Insula 8, Nr. 3). Sie wurde 1879, also 1800 Jahre nach dem Vesuv-Ausbruch, ausgegraben und hat daher ihren Namen. Es ist ein großes, durch mehrmaligen Umbau verändertes Anwesen, das mindestens 3 voneinander geschiedene und nur durch das Peristyl verbundene Wohnungen enthielt. Im großen tuskanischen Atrium mit marmornem Impluvium sind die Dekorationen im 4. Stil verblieben. In den beiden Räumen zu seiten des Tabliniums, die sich zum Garten öffnen, hat der eine eine schwarze Dekoration, auf der sich eine leichte gelbe Architektur abhebt; der andere ist weiß gehalten, auf den Feldern schweben kleine Figuren, an den rahmenden Linien schlingen sich feine Ranken, auf denen Vögel sitzen. Von den Säulen des Peristyls sind einige beim Erdbeben von 62 eingestürzt und wurden anschließend durch gemauerte ersetzt. Dabei hat man auch die noch erhaltenen Tuffsäulen mit unten rot eingefärbtem
Stuck überzogen. — Vor dem Obergeschoß im vorderen Teil des Hauses steht eine Säulenreihe aus Tuffstein mit reichen hellenistisch-ionischen Kapitellen. — In einem Brunnenraum am Ende des Triclinium liegt der Fußboden tiefer. Zu einem Becken in seiner Mitte führt eine Wassertreppe aus einer Mosaiknische. Im unteren Teil des Raumes läuft eine Dekoration von Fischen und Meerestieren auf grün-blauem Grund. Über einem roten Streifen sieht man seitlich in eine Gartenlandschaft, vor der geflügelte Sirenen perspektivisch gemalte Wasserbecken tragen. An der Rückwand sind Tierkämpfe aufgemalt. — Hinter der im 4. Stil dekorierten Seitenwand des Peristyls liegt die Küche (mit einem Lararium) und an einem Gang das Bad (mit dem Wasserbecken im größeren Raum und dem kleineren Schwitzraum). — Ein schmaler Gang führt zu einer Nebenwohnung mit bemalten Räumen (4. Stil). Das Schwarz der Wände ist verblaßt. Auf roten Flächen sitzen 3 Bilder: Links Theseus mit dem Minotauros, in der Mitte Hermaphrodit und Marsyas, rechts Orest und Pylades bei Iphigenie. Es folgen ein gelber und ein weißer Raum, die im 4. Stil ausgemalt sind.
Eine Seitenstraße führt zum Haus des Marcus Lucretius Fronto (Region 5, Insula 4, Nr. 10). Es gehört zu den am besten erhaltenen Häusern des 3. Stils.
Im tuskanischen Atrium steht hinter dem marmornen Impluvium noch ein Marmortisch an seinem urspr. Ort. Die Wanddekoration verzichtet auf illusionistische Wirkung, über dem roten Sockel ist die Wand schwarz, die trennenden Leisten stellen keine Architektur dar, sondern gliedern nur die Flächen der Wand. — Das anschließende Tablinum zeigt den Übergang vom architektonischen 2. Stil zur Flächigkeit des 3. Stils. Die obere Zone wirkt wie eine flache stilisierte Bühne mit roten und gelben Flächen vor dem schwarzen Grund, während in der unteren Zone auf die räumliche Wirkung fast ganz verzichtet wird. Nur seitlich der roten Mittelfelder ist der Eingang eines im Halbrund hinter ihnen durchführenden Ganges angegeben. In miniaturistisch feiner Ausführung sitzen auf den schwarzen Seitenfeldern an silbernen Kandelabern Landschaftsbilder, die tatsächliche Motive, z. T. aus der Umgebung von Pompei, verarbeiten, so rechts den Blick auf Villen vor den Bergen der Sorrentiner Halbinsel. Die Bilder auf den roten Flächen zeigen rechts den Triumph des Dionysos, links Mars und Venus. — Das Cubiculum rechts davon ist über rotem Sockel gelb gehalten. Auf den Flächen sitzen Medaillons schwebender Eroten und 2 Bilder: links Narziß, rechts, mit der Inschrift, Pero und Mikon. — Im schwarz-gelben Cubiculum rechts daneben ist über dem purpurnen Sockel die klare Flächigkeit des 3. Stils erreicht, während in der oberen Zone vor derselben Farbeinteilung zerbrechliche, irreale Architekturen angegeben sind. Die Bilder auf den. schwarzen Feldern zeigen die Toilette der Venus und Ariadne, die Theseus vor dem Labyrinth das Wollknäuel überreicht. — Im
rechts anschließenden Raum ist eine Wand im reinsten 3. Stil erhalten. Vor den roten Flächen schweben Eroten, auf der gelben sitzt das Bild: Die Ermordung des Neoptolemos in Delphi. — Im Zugang zum Garten führte eine Treppe ins obere Geschoß. Hinter ihr liegt die Küche. — Im Cubiculum rechts zeigen 2 Bilder links Hermaphrodit und Marsyas, rechts Pyramos und Thisbe. Die Rückwand des Gartens ist mit großfigurigen Tierbildern bemalt.
Auf der Via di Nola weiter hinten liegt in Region 5, Insula5, Nr. 5 eine Gladiatorenkaserne. In diesem Gebäude waren die Familien der Gladiatoren untergebracht, welche die pompejanische Stadtverwaltung in Sold genommen hatte. Später diente der große Portikus unterhalb des Theaters den Gladiatoren als Herberge. Auf der halbhohen Mauer zwischen den Säulen des Peristyls sind mythologische Szenen und Tierbilder angebracht. In den Stuck der Säulen haben die Gladiatoren ihre Namen eingekratzt.
Im Haus des Marcus Obellius Firmus (Region 3 ) zeugen die 4 korinthischen Säulen noch von der großzügigen Raumgestaltung der vorröm. Zeit. Im und neben dem Impluvium stehen Marmortische, an der rechten Seite des Atriums eine schwere Eisentruhe. An den Garten schließen sich ein Saal und ein Cubiculum an, die im 2. Stil dekoriert sind.
Die Via di Nola führt weiter hinunter zur einfachen Porta di Nola, vor der 2 Gräber in Halbkreisform ausgegraben wurden. Bei dem einen steht eine Säule in der Mitte des Halbrundes.
Die Via Stabiana führt oberhalb ihrer Kreuzung mit der Via di Nola zur Porta Vesuvio. Die Kreuzung wird auch Kreuzung des Orpheus genannt, nach einem Haus links ( Region 6, Insula 14, Nr. 20), an dessen Gartenrückwand ein Fresko den thrakischen Sänger Orpheus zwischen den Tieren zeigt.
Rechts gegenüber liegt das Haus des Bankiers Lucius Caecilius Iucundus (Region 5, Insula 1, Nr. 27). Im Atrium ist eine Kassette mit Rechnungstafeln gefunden worden; links ein marmorner Larenaltar mit Reliefstreifen, die das Erdbeben von 62 darstellen: unten der Jupiter-Tempel auf dem Forum und oben die eingestürzte Porta Vesuvio. Neben dem Tablinum steht ein Nachguß der hier gefundenen Bildnisherme des Caecilius Iucundus. In rigorosem Realismus sind die Züge dieses Mannes wiedergegeben, das Haar dagegen in der Stilisierung des augusteischen Klassizismus. In die Zeit des Augustus weist auch die Dekoration im Tablinum (3. Stil). Die herausgeschnittenen Bilder befinden sich im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Noch am Platz sind zweimal ein Satyr und eine Mänade sowie der Rest einer Säulenhalle. Stärker verblaßt ist die Malerei im Triclinium am Garten.
Die letzte Querstraße der Via Stabiana führt rechts zum Haus der silbernen Hochzeit (Region 5, Insula 2). Es wurde 1893 im Jahr der silbernen Hochzeit des italien. Königs Umberto und seiner Frau Margherita ausgegraben. Das wiederhergestellte 4säulige Atrium zeigt die großzügige Räumlichkeit der vorröm. Epoche. Um das Compluvium sitzen Stirnziegel und Wasserspeier aus Terrakotta, die das Regenwasser in das Impluvium leiten. Das Haus stammt aus dem 2. Jh. v. Chr., wurde aber in der röm. Kaiserzeit umgestaltet. Dabei sind die schlanken Tuffsäulen mit einer dicken, unten rot eingefärbten Stuckschicht versehen worden. Die Dekoration der Wände ist im 2. und 4. Stil durchgeführt. Im Atrium haben sich noch die Reste der einfachen Bemalung im 2. Stil erhalten. Die Alae, das Tablinum, der Durchgang zum Peristyl und die Wände des Peristyls zeigen Spuren einer Bemalung im 4. Stil. Aus der Zeit der letzten Wiederherstellung des Hauses stammen auch die Stuckschicht an den Säulen sowie die 6seitige Form der Peristylsäulen. — Die herrschaftlichen Räume liegen an der S-Seite des Peristyls. Links ein Saal (Oecus), dessen hinterer Teil mit einer von 4 Säulen getragenen Tonne überwölbt ist. Die Malerei stammt aus dem 2. Stil: über schwarzem Sockel aufrechte rote Felder, von denen je 2 von einer Girlande zusammengefaßt werden. Vor dem oberen Porphyrfries stehen Konsolen in Form springender Delphine. Darüber erscheint eine leichte Architektur mit Durchblicken auf den blauen Himmel. — Zur Mitte des Gartens öffnet sich das gelb gehaltene Triclinium mit den schweren Frucht- und Blättergirlanden zwischen 4eckigen Pfeilern, die bis zur Decke hinaufgezogen sind. Den Konsolenfries bilden hier tanzende Mänaden und Satyrn. — Zu seiten des Triclinium liegen kleine, z. T. tonnengewölbte Räume. Vor das gemalte Quaderwerk der Wand sind Säulen gemalt, die ihren Schatten auf die Wand werfen. Der schwarz gehaltene Saal an der rechten Ecke ist im 4. Stil dekoriert. Rechts von ihm gelangt man durch 2 gelbe Zimmer im 2. Stil zum Bad; vorne das gewölbte Schwitzbad mit einem Brunnen; vom einfach gemusterten Fußboden sind große Teile erhalten. Vom Peristyl führt auch eine Tür zur Küche und zu einer Latrine.
Die sog. Casa degli Amorini dorati an der Via Stabiana (Region 6, Insula 16, Nr. 7) ist über sehr unregelmäßigem Grundriß errichtet. Für das Atrium, 2 kleine Cubicula und das Tablinum wurde ein kleines Areal an der Straße genommen. Das größere Peristyl mit den herrschaftlichen Wohnräumen schließt sich an der linken hinteren Ecke des Atrium an. Das ganze Anwesen ist im 3. Stil dekoriert und verdankt seine Anlage ebenso wie das nahegelegene Haus der Vettier einer Schicht, die kurz vor dem Vesuv-Ausbruch von 79 n. Chr. zu Vermögen gekommen ist.
Wie das Haus der Vettier zeugt die Ausschmückung von einer dionysischen Idyllik, die z. Z. Neros verbreitet war. Daneben Spielt
auch die Verehrung der ägyptischen Göttin Isis eine Rolle. Der dionysischen Sphäre entstammen die marmornen Zierstücke im Garten: kleine Doppelhermen mit dem Antlitz des bärtigen Gottes und Maskenreliefs. Vom Architrav des Peristyls hängen Marmormasken und Marmoroscilla herab, die auf beiden Seiten ein flaches Relief tragen: 1. eine Mänade und einen Satyr; 2. einen gefesselten und einen springenden Kentaur. Maskenreliefs und ein Satyr sind auch an der einen Rückwand des Peristyls eingelassen. — Für Isis ist in einer Ecke des Peristyls ein kleines Heiligtum eingerichtet. Über den sich vor einem Altar ringelnden Hausschlangen befassen sich auf gelben Feldern 2 Darstellungen mit dem Kult der ägyptischen Göttin: einmal die Kultgegenstände, daneben über einem weißgekleideten Fackelträger in der oberen Zone der schakalköpfige Anubis, als Geleiter in das Totenreich dem griech. Gott Hermes gleichgestellt und deswegen auch mit seinem Attribut, dem Herold-Stab ausgestattet; daneben die Göttertrias — der Horusknabe, Isis und Osiris mit erhobenem Sistrum, einer Metallklapper, die zum Kult gehörte. — Der hintere Teil des Gartens liegt höher und ist wie eine Bühne gestaltet. Der mittlere Raum blieb unfertig. Vom weißen Raum links sind der Fußboden und auch Teile der Decke erhalten. Rechts neben dem kleinen Lararium mit marmoriertem Sockel führt eine Tür in ein gelb ausgemaltes Cubiculum, in dessen Wand 4 runde Glasscheiben eingelassen waren, deren vergoldete Rückseiten eingravierte Amor-Figuren zeigten. Diese Gläser befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Nach ihnen trägt das Haus seinen heutigen Namen.
Die Via Stabiana führt hinaus zur Porta Vesuvio, neben der ein Wasserkastell das vom Berg kommende Wasser in 3 Kanäle verteilte. Außerhalb der Porta Vesuvio liegen Gräber verschiedener Typen, darunter ein viereckiger ummauerter Grabbezirk, der von einem Grabaltar überragt wird. Die Inschrift nennt den Ädil Gaius Vestorius Priscus, der 22 Jahre gelebt hat, und seine Mutter Mulvia Prisca, die ihrem Sohn das Grabmal hat erstellen lassen. Neben der Inschrift sind im Stuckrelief 2 Hermaphroditen, links eine tanzende Mänade, auf der Rückseite ein ruhender Satyr und rechts wieder eine Mänade gegeben. Auf den roten äußeren Pfeilern schweben Putten. Die Innenwände des Grabmals sind mit Szenen aus dem Leben des Verstorbenen bemalt. — Daneben steht ein anderes Grab in Form einer halbkreisförmigen Sitzbank, einer Exedra, auf deren Mitte eine Säule steht.
Man sieht außerhalb der Porta Vesuvio an der Stadtmauer entlang. Der 1. Turm wurde außen in ganzer Höhe wiederhergestellt. Sein Mauerwerk unterscheidet sich von dem der Mauer. Die Türme an dieser Seite der Stadtmauer sind offenbar nachträglich (aber noch vor der röm. Besetzung) in
die Mauer eingefügt worden. Sie sind aus Bruchsteinen gebaut und haben einen Verputz aus imitierten Quadern erhalten, um sie der Quadertechnik der Mauer selbst anzupassen. Reste dieses Verputzes sind erhalten.
Innerhalb der Porta Vesuvio gabelt sich die Straße. Der rechte Zug führt zum Haus der Vettier (an der 1. Straßenkreuzung unten rechts, Region 6, Insula 15, Nr. 1). Es gehört zu den am besten erhaltenen Häusern von Pompei. Seine 2 Besitzer, Aulus Vettius Restitus und Aulus Vettius Conviva, haben es in den letzten Jahren vor dem Vesuv-Ausbruch im 4. Stil zu einem wahren Museum ausstatten lassen. Schon die Fassade gegen die Straßen hin zeugt von dem Reichtum der Bewohner. Sie hatten es nicht nötig, durch die Vermietung von Läden zu verdienen. Mit einem unten stärkeren, festen Verputz haben sie ihr kostbar hergerichtetes Haus gegen die Einflüsse der Witterung geschützt.
Im schwarz gehaltenen Eingang ist ein Bild des Priapus (unter Verschluß) als eines segensreichen Gottes angebracht. Das Atrium hat noch seine alte, tuskanische Form. Links und rechts führen in Nebenräumen Treppen in das der Dienerschaft vorbehaltene Obergeschoß. In dem einfachen Hof, in dem die Treppe beginnt, befindet sich an einer Wand das Heiligtum für die Hausgötter, die in einer Ädikula aus Stuck gemalt sind: In der Mitte opfert der Genius der Familie, zu seinen Seiten die tänzelnden Laren mit Trinkhörnern (die hier in springenden Ziegen enden). Unter ihnen windet sich die zugehörige Schlange. — Neben dem Hof befinden sich die Küche und mehrere kleine Räume. — Um das Atrium und das Peristyl gruppieren sich die ausgemalten Räume. Links neben dem Eingang, in einem unten gelb gehaltenen Zimmer, sind unter einem Fries mit Fischen und Seetieren noch 2 mythologische Szenen zu erkennen: links die verlassene Ariadne, rechts Leander, der für Hero den Bosporus durchschwimmt. — Im folgenden, weißen Raum thronen in der oberen Zone rechts ein jugendlicher Zeus, geradeaus Leda mit dem Schwan. In den anderen Ädikulen stehen Satyrn, Nymphen, Opferdiener und Dienerinnen. Die Bilder in der unteren Zone stellen mythologische Szenen dar. Bei den Zimmern um das Atrium herrscht die weiße Farbe als Grund vor. Auf sie sind die feinen Architekturen und Girlanden aufgemalt. Bei den großen Alae sind in der unteren Zone gelbe Flächen eingespannt, auf denen kleine rote Bilder sitzen. Der größte Prunk ist im Peristyl und den daran anschließenden Räumen entfaltet. — Im Garten wurden alle Gegenstände an dem Ort gelassen, an dem man sie bei der Grabung fand. marmorne Tische und Brunnenbecken, bei denen bronzene und marmorne Figuren
als Wasserspeier dienten. In der Mitte stehen auf reliefierten Säulen 2 Doppelhermen mit dem Gesicht des jugendlichen und des bärtigen Dionysos. An den Wänden ist die ganze Üppigkeit des 4. Stils ausgebreitet, seine 4 Hauptfarben — Rot, Gelb, Schwarz und Weiß — werden in immer neuen Wechsel gegeneinander gesetzt. Dazwischen entfalten sich irreale Architekturphantasien, auf den Feldern schweben Figuren und sind Landschaften angebracht, und 2 Räume bringen sorgfältig gemalte Kopien griech. Gemälde. - Der große Raum an der Schmalseite des Peristyls enthält die bekanntesten Motive. Über dem schwarzen Sockel, auf dem Figuren stehen und sich Girlanden schlingen, erheben sich rote Felder, deren unterer Teil von einem schwarzen Fries unterbrochen wird. Auf ihm sind Putten bei verschiedener handwerklicher und sportlicher Beschäftigung zu sehen. Auf der Mitte der Felder schweben Liebespaare der griech. Sage, von rechts nach links: Perseus und Andromeda, Dionysos und Ariadne, Apoll und Daphne, Poseidon und Amymone. Die großen Bilder sind herausgeschnitten; sie zeigten rechts: Agamemnon beim Opfer der Hirschkuh, Apollon als Sieger über die Pythonschlange und links Orest und Pylades in Tauris vor dem König Thoas (die Bilder befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum zu Neapel). Eine zierliche Architektur auf schwarzem Grund rahmt die roten Felder ein, darüber folgt ein Stuckgesims und nochmals darüber eine komplizierte Architektur auf weißem Grund, in der sich verschiedene Figuren bewegen.
Neben diesem Saal befindet sich ein kleiner Hof, an den sich ebenfalls ausgemalte Cubicula anschließen. An der Ecke des Peristyls liegt ein weiterer, reich ausgestatteter Raum. Am Sockel ist verschiedenartiger Marmor imitiert, auf den großen roten Feldern sitzen Kopien griech. Gemälde, links: Daidalos führt Pasiphae die künstliche Kuh vor; in der Mitte wird Ixion für sein frevelhaftes Begehren nach der Göttin Hera auf das Rad gebunden; links findet Dionysos die schlafende Ariadne. Auf den weißen Feldern schweben Satyrn und Mänaden. Die weißen Prospekte zwischen den Feldern sind im unteren Teil durch blaue Platten und schmale Bilder verstellt (Stilleben und Marinebilder), auf denen Theatermasken und geflochtene Getreideschwingen mit den Gegenständen der dionysischen Mysterien stehen. Den oberen Teil der Wand nehmen die komplizierten Architekturen mit Figuren in den Ädikulen ein. — Diesem Raum entspricht ein zweiter auf der anderen Seite des Peristyls. Er ist einfacher dekoriert mit rotem Sockel und gelbem Grund. Die Gemäldekopien stellen Herakles als Kind dar, der die Schlange erwürgt, die Tötung des Pentheus durch die Mänaden und die Bestrafung der Dirke. — Bei der Dekoration der langen Peristylrückwand wurde in den schwarzen Feldern eine gewisse Symmetrie beachtet. In der Mitte stehen 2 dionysische Figuren: ein Satyr rechts, eine Mänade links. Nach den Seiten hin folgen erst Stilleben, dann schwebende weibliche Figuren und
schließlich ein schmales Tierbild. In den Ecken sind Landschaften direkt auf den schwarzen Grund gesetzt. In ähnlichem Sinn werden auch die zerstörten Seiten des Peristyls gestaltet gewesen sein.
Das sog. Haus des Labyrinthes (Region 6, Insula 11, Nr. 10) liegt der Rückfront der Casa del Fauno gegenüber und stammt wie dieses aus dem 2. Jh. v. Chr. Im Atrium stehen 4 hohe korinthische Säulen und deuten auf eine ähnliche Großzügigkeit der Ausführung wie im Haus der silbernen Hochzeit hin. Im Atrium und im Tablinum sind noch Reste der Stuckverkleidung im 1. Stil zu sehen. Die herrschaftlichen Wohnräume liegen am weiten Peristyl hinter dem Tablinum: in der Mitte ein Saal mit eingestellten Säulen, ein Oecus Corinthius, und Cubicula. Die Wände zeigen gute Beispiele der Malerei im 2. Stil. Im anschließenden Saal ist in den Fußboden ein Mosaikbild eingelassen — Theseus und Minotauros vor dem Labyrinth —, nach dem das Haus heute benannt wird. In den Wirtschaftsräumen im W-Teil des Hauses befinden sich das Bad und eine Bäckerei mit Ofen und Mühlen.
In der Gasse weiter nach W folgt in der vom Forum kommenden Querstraße das Haus der Kastor und Pollux (Region 6, Insula 9, Nr. 6, 7). Das große Anwesen ist in augusteischer Zeit durch das Zusammenlegen dreier Häuser zustande gekommen. Dabei wurde die Fassade durch eine einheitliche Verkleidung von großen stuckierten Quadern zusammengefaßt. Im Inneren blieben die älteren Teile noch erhalten. Hinter dem Haupteingang Nr. 6 das sog. korinthische Atrium aus 12 Säulen. Die Malerei der Wände ist im 4. Stil ausgeführt. In den Räumen rechts und links vom Tablinum sind in die Dekoration mythologische Bilder eingefügt; rechts die Geburt des Adonis, sowie Skylla und Minos, links Apollon und Daphne, sowie Silen und Nymphe mit dem kindlichen Dionysos. Hinter dem Tablinum liegt ein Peristyl aus dorischen Säulen, an dessen Rückwand die Nische für das Lararium steht. Rechts vom Atrium öffnet sich ein 2. Peristyl mit einem großen Wasserbecken in der Mitte; die Wände sind im 4. Stil dekoriert.
An der Straße zum Turm liegt das sog. Haus des Meleager (Region 6, Insula 9, Nr. 2). Es stammt noch aus dem 2. Jh. v. Chr., seine Dekoration wurde aber nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. im 4. Stil erneuert. Wegen der geringen Tiefe der Insula liegt das Peristyl links vom Atrium, dessen Mitte ein großes Wasserbecken einnimmt. Hier befinden sich auch die dekorierten Räume des Hauses: ein Saal mit eingestellten Säulen, ein sog. Oecus Corinthius, und in der NO-Ecke ein Triclinium mit schlecht erhaltener Malerei des 4. Stils.
Der Turm am Ende der Straße wurde z. T. wiederherge-
stellt. Eine Treppe führt auf die Plattform hinauf. Da der Turm an der höchsten Stelle der antiken Stadt steht und durch seinen Wiederaufbau auch das umliegende Gelände überragt, bietet er den besten Überblick über die Grabungen, aber auch einen Eindruck von der Lage der Stadt auf den letzten Ausläufern des Vesuvs und am Golf von Neapel, außerdem einen Blick auf die Montes Lactarii der Sorrentiner Halbinsel gegenüber. An klaren Tagen sieht man bis nach Capri, auf dem in den letzten Jahrzehnten vor dem Ausbruch des Vesuvs die röm. Kaiser (V. a. Tiberius 27-37) ihre Villen hatten.
An der Straße, die zur Porta Ercolano führt, liegt das sog. Haus des Sallust (Region 6, Insula 2, Nr. 4), dessen Fassade aus großen regelmäßigen Blöcken gemauert ist. Seitlich des Eingangs befinden sich Läden. Trotz der Vermietung des vorderen Teils gehört es zu den vornehmsten, noch erhaltenen Häusern der vorröm. Zeit, das die einfache Disposition der frühen Häuser bewahrt hat. Die hohen Räume um das Atrium herum sind noch ganz von der Großzügigkeit des 2. Jh. v. Chr. geprägt. An den Wänden sitzen Reste der Dekoration aus dem 1. Stil, die nach Form und Farbe eine Verkleidung mit farbigem Stein imitiert. Hinter dem Tablinum liegt ein schmaler Garten mit einer Reihe von Säulen, zu dem sich ein Triclinium (1. Stil) öffnet. Rechts vom Atrium ist eine Reihe kleinerer Räume im 4. Stil ausgemalt, doch stark verblieben. Die Rückwand des 2. Gartens war mit großfigurigen Szenen geschmückt (erhalten: Herakles mit dem nemeischen Löwen).
Nahe der Porta Ercolano liegt an der rechten Straßenseite eines der ältesten erhaltenen Häuser Pompeis, das sog. Haus des Chirurgen (Region 6, Insula 1, Nr. 910). Es wurde im 4./3. Jh. v. Chr. aus schweren Kalksteinblöcken auf einem einfachen, regelmäßigen Grundriß errichtet. Seine beiden Seiten sind symmetrisch um eine Achse vom Eingang bis zum Tablinum geordnet. Der Garten hinter dem Tablinum mit dem daran angrenzenden Zimmer und den dahinter liegenden Nebenräumen und der Küche stammen von einer Renovierung des ganzen Anwesens im 1. Jh. n. Chr. Damals sind auch die Wände des alten Hauses bemalt worden. Zuletzt bewohnte ein Arzt dieses Haus. Seine bei den Grabungen gefundenen chirurgischen Instrumente befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel.
Wenig oberhalb des Hauses des Chirurgen endet das Stadtgebiet an der Stadtmauer, die hier, an der NW-Ecke, einen Knick macht. Die W-Mauer ist gegen den Abhang des Lavavorsprungs gebaut, auf dem die Stadt liegt, während vor
der N-Mauer das Gelände sanft ansteigt und die Mauer die Häuser überragt. Man sieht rechts vom Tor auf die treppenförmige Innenseite, über deren steile Stufen eine rasche Besetzung der Mauer bei einer Belagerung möglich war. Erst als die Stadt nach der Eroberung durch Sulla ihren Festungscharakter eingebüßt hatte (80 v. Chr.), konnten die Häuser bis an die Stufen herangebaut werden. Auch die 3torige Anlage mit einem Torhof, mehr eine Durchfahrt als ein Festungstor, stammt aus der röm. Zeit.
Vor dem Tor bietet sich das Bild eines röm. Suburbiums, eines Vorstadtgebietes mit Gräbern, Villen und dazwischen eingestreuten Tavernen und Lagerhäusern. Außen an der Mauer entlang führt eine gepflasterte Straße, die gleichzeitig das Pomerium, die kultische Stadtgrenze, ist.
Zu beiden Seiten des Tores beginnen die Gräber. Links eine Gruppe mit 2 halbrunden Sitzbänken als Grabmonumenten und dahinter, z. T. restaur., die Ruine eines Rundtempels auf hohem Sockel. Zwischen den Säulen standen ehemals die Statuen der Verstorbenen. Das Grab gehörte der Familie der Istacidii, die wahrscheinl. die weiter außerhalb gelegene Mysterienvilla besaß. — Unter den Gräbern auf der rechten Straßenseite befindet sich eines, dessen hohe Säule eingestürzt neben dem Sockel liegt. Es folgt das Grab des Ädils Marcus Terentius Maior, für dessen Leichenfeier die Stadt 2000 Sesterzien beigesteuert hat. Die Gruppe endet an einer stuckierten Nische mit einer Sitzbank im Inneren. Aus dem Grab rechts davon stammt die blaue Glasvase mit den kelternden Putten im Archäologischen Nationalmuseum zu Neapel.
Hinter der stuckierten Grabnische beginnen auf beiden Seiten die Tavernen und die Läden vor den Villen. Auf der rechten Seite gibt ein Eingang den Durchblick in einen Garten frei, in dem ehemals die 4 Mosaiksäulen standen, die sich heute im Archäologischen Nationalmuseum zu Neapel befinden. Auf der linken Seite liegt hinter den Tavernen eine große Villa, die 1763 ausgegraben und, nachdem die Mosaiken und Wandbilder herausgenommen waren, wieder zugeschüttet worden ist. Sie wird als die Villa des Cicero bezeichnet, der in der Nähe von Pompei eine Villa besessen hat. Indes deutet nichts darauf hin, daß es sich gerade um dieses Anwesen gehandelt haben muß.
Bei einer weiteren Gruppe von Grabdenkmälern gabelt sich die Straße. Der rechte, nicht freigelegte Zug führt zu dem antiken Eingang der Mysterienvilla, links verläuft die ehem. Uferstraße nach Herculaneum. Hier befindet sich rechterhand die Grabplatte eines Diomedes in die Wand eingelassen. Schräg gegenüber ist der Eingang zu einer großen Villa, die nach dieser Grabplatte von
den Ausgräbern die Villa des Diomedes genannt worden ist. Von hier stammen die feinen Mosaikbilder des Dioskurides im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Der Eingang wird von 2 Säulen gerahmt. Er führt auf die Ecke eines Peristyls, an dessen einer Langseite (gegen die Straße hin) das Bad auf einem dreieckigen Grundriß untergebracht ist: in einem kleinen Säulenhof das Kaltwasserbecken und daran anschließend die heizbaren Räume. An der Schmalseite liegt hinter einem Vorzimmer ein Raum, dessen halbrunde Außenwand an 3 Seiten Fenster hat, damit zu jeder Tageszeit Sonnenlicht einfallen kann. Vom Tablinum, dem Eingang gegenüber, gelangt man auf die Terrasse über dem Garten, der wegen des abfallenden Geländes tiefer liegt. Eine Treppe und eine Rampe führen in das von einem Portikus umstandene Geviert hinunter. In der Mitte des Gartens ist ein Wasserbecken und ein Sommertriclinium angelegt. Die Ecken der Abschlußmauer gegen W waren ehemals von 2 Aussichtstürmen flankiert, von denen der Blick über den Golf nach Capri hinüberging.
Mysterienvilla
Das ländliche, etwas außerhalb vor der Porta Ercolano gelegene Anwesen bestand schon vor der Eroberung von Pompei und der Umgestaltung der Stadt in eine römische Kolonie. Man erreichte die Villa von einer nicht ausgegrabenen Seitenstraße aus, die von der Gräberstraße abzweigte. Zwischen Eingang und Peristyl lagen die Küche, die Räume für den wirtschaftlichen Betrieb und wahrscheinl. auch damals schon ein Raum mit einer Weinpresse und eingemauerten großen Tongefäßen für den Wein (die jetzt dort sichtbare Anlage stammt aus der Zeit kurz vor dem Vesuv-Ausbruch 79 n. Chr.). So war hier offenbar von Anfang an der Gott Dionysos durch das ihm heilige Gewächs gegenwärtig und brauchte nicht erst eingeführt zu werden, als in der Mitte des 1. Jh. v. Chr. die Villa für die Mysterien dieses Gottes umgestaltet und neu ausgemalt wurde. Die Kulträume richtete man in dem Teil hinter dem Atrium ein, also dort, wo man heute die Villa betritt. Vom Niveau der heutigen Straße gelangt man auf eine Terrasse, die im Altertum über einem Gewölbe, einem Kryptoportikus, angelegt worden ist. Auf diesem Gewölbe lagen die Räume hinter einer Front von Säulen. Von hier aus hatte man einen weiten Blick über das Meer bis nach Capri und zum Vesuv. Die hinter der Terrasse reich ausgemalten Räume dienten nicht als Wohnung, sondern dem Dionysos-Kult. Die städtische Bevölkerung sah schon da-
mals im Landleben den Überrest einer verlorengegangenen unschuldigen Vorzeit. Hier waren unter einfachen Menschen noch die Götter gegenwärtig. So entwickelte sich der Brauch, Hochzeiten in ländlichen Villen abzuhalten und die Brautleute dabei in die Mysterien des Gottes Dionysos einzuweihen, deren geheimste Symbole solche der Fruchtbarkeit waren. Im Zusammenhang mit dieser religiösen Feier wurde auch die Ehe vollzogen.
Für diese Vorgänge hatte die reiche pompejanische Familie der Istacidii ihre Villa herrichten und ausmalen lassen. Der wichtigste Raum wurde dabei mit einem großfigurigen Fries versehen, dessen einzelne Gruppen die Vorbereitung zur Feier, die Erscheinung des Gottes Dionysos und die dabei vollzogenen religiösen Handlungen vorführen.
Über einem hohen, mehrfach gestreiften Sockel verläuft eine schmale, grüne Bühne. Den größten Teil der Wand nimmt die gemalte Architekturgliederung ein: Hohe rote Platten werden durch Porphyrpilaster voneinander getrennt; darüber liegen ein Mäanderband, Platten aus farbigem Marmor und eine Girlande auf schwarzem Grund. Der obere Teil der Wand und die Decke sind nicht erhalten. Auf der grünen Bühne und vor den roten Platten spielt sich der Vorgang ab, der sich von der Tür über die linke Wand bis zur Stirnseite des Saales steigert: Links vom Eingang sitzt auf dem Brautbett die Brautmutter, deren Kleidung die dionysischen Farben Violett und Gelb zeigt, und schaut zu ihrer Tochter hinüber, die, ebenfalls in violette und gelbe Gewänder gekleidet, frisiert wird. Ein geflügelter Eros hält den Spiegel, ein zweiter lehnt an einem violetten Pfeiler und schaut zu. In der Rechten hält er einen Lorbeerzweig. Mit Lorbeer, der bei der Vorbereitung zur Feier eine Rolle spielte, sind auch die Mädchen und die Silen auf der linken Wand bekränzt, und die vom Rücken gesehene Frau in der Mitte läßt einen Lorbeerzweig mit Wasser übergießen. In der Kleidung aller dieser Figuren herrschen Violett und Gelb vor. Links läßt eine Frau einen Jungen, dessen Eltern noch am Leben sein mußten, heilige Texte vorlesen. Eine violett und gelb gekleidete Schwangere trägt einen verdeckten Korb zur Mittelgruppe. Den Bereich der Vorbereitung schließt der Silen ab. Er hat sich schon der Hauptszene zugewendet, ist aber durch den Lorbeer mit den Frauen hinter ihm verbunden. Lorbeer ist die Pflanze des Apollon, und in den Bereich dieses Gottes gehört auch das Musikinstrument, die Leier, die der Silen spielt. Er stützt sie auf einen Porphyrpfeiler, hinter dem ein neuer Bereich beginnt: ein mythisches Arkadien, ein Land der Hirten und des Friedens zwischen den Geschöpfen. Den Anfang bildet ein Paar Hirten, die nicht mehr völlig menschliche Wesen sind: sie haben Ziegenohren, sind also Satyrn, Wesen aus dem Bereich des Dionysos. Ein Junge,
von dessen Schoß ein Wolfsschwanz herabhängt, bläst auf einer Syrinx, einer Hirtenflöte, und die junge Hirtin reicht einer Ziege die Brust zum Trinken. Die Grenze zum goldenen Zeitalter ist überschritten, Mensch und Tier leben friedlich miteinander — doch nur für den, der sich dem Kult des Gottes hingibt. Wer sich ihm aber verschließt, den erfüllt sein Erscheinen mit Schrecken und Raserei, wie der griech. Tragiker Euripides in seinen »Bakchen« dargestellt hat. Hier auf dem Bild läuft eine junge Frau erschreckt an dem Frieden der Hirten vorbei. Ihr Blick geht hinüber zur Ursache ihres Schreckens: dem Erscheinen des Gottes. In trunkener Geste, mit herabgeglittenem Gewand lehnt er am Schoß seiner Gemahlin Ariadne, die in der Mitte als Herrin des Festes thront. Sie spielt mit einem Bausch ihres violetten Gewandes und hat die Rechte Dionysos auf die Brust gelegt. Der Gott ist mit dem ihm heiligen Efeu bekränzt. Efeu ist auch um die Spitze des langen Thyrsos-Stabes geschlungen, der auf seinem Schoß lehnt, und efeubekränzt ist schließlich der alte Silen, der auf einem Marmorblock hockt: Es ist Marsyas, der die Zukunft sagen kann, wozu er sich eines Mediums bedient, hier eines jungen Mannes mit Tierohren, der sich über ein ihm von Marsyas entgegengehaltenes Gefäß beugt. Mit weitaufgerissenen Augen starrt der Jüngling hinein, und aus seinem Stammeln formuliert der Alte die Weissagung, wobei er nur langsam die Lippe bewegt. Über diese Gruppe hält ein ebenfalls tierohriger Jüngling die Maske des Papposilen, des Ziehvaters von Dionysos. Durch die Maske wird zugleich ein anderer Bereich des Gottes angedeutet, das Theater. Masken wurden auch bei den Mysterien gezeigt und sind oft auf den Wandbildern neben den bei der heiligen Handlung gebrauchten Gegenständen zu sehen (etwa in einem Raum des Vettier-Hauses). In einer geflochtenen Kornschwinge, einem Lignum, liegen diese Gegenstände, von einem violetten Tuch verdeckt, und werden auf dem Höhepunkt des Festes enthüllt. Diesen Vorgang zeigt die Szene rechts von Ariadne. Ein Mädchen kniet vor der Kornschwinge und ist dabei, vorsichtig das Tuch zu heben, um der Braut das Bild des Phallus zu enthüllen (auf einem Fresko in einer Villa bei Stabiae ist unter dem violetten Tuch deutlich die Form des männlichen Gliedes zu erkennen). In diesem Augenblick wird die Weihe vollzogen. Zwei Mädchen hinter der Knienden lehnen sich ängstlich aneinander vor der Erscheinung eines Wesens aus anderen Sphären, das mit freiem Oberkörper und hohen Theaterschuhen herabschwebt und dessen Füße den Boden kaum berühren. Die grünen Flügel breiten sich weit aus, während die Gestalt mit einer Gerte zum Schlag auf den Rücken des knienden Mädchens ausholt. Dieser rituelle Schlag soll Fruchtbarkeit bewirken. Die Gestalt ist eine Personifikation der Jungfräulichkeit oder die Jungfrau selbst, das Sternzeichen, unter dem im Herbst die Weinlese beginnt, der Sage nach die erste Dienerin des Dionysos. Vor der geschlagenen Braut tanzen Mänaden, Frauen, die vom Gott
ergriffen sind. Sie entsprechen den arkadischen Hirten auf der Wand gegenüber, und mit ihnen endet auf dieser Seite der Bereich des Dionysos. Die Braut ist zweimal auf der Fensterwand zu sehen: links unter dem Schlag der Virgo und an entsprechender Stelle rechts, ebenfalls vor einem Porphyrpilaster, beim Schmücken.
An der Ecke, an der die Brautmutter auf dem Brautbett sitzt, führt eine kleine Tür in ein Cubiculum mit 2 Bettnischen. Die Türen in den Nischen sind später eingebrochen worden. Hier wurde die Ehe vollzogen. In den Bettnischen ist das gleiche Dekorationssystem angewendet wie im Saal: Aufrechte rote Felder werden von violetten Pilastern getrennt. Auch hier sind einzelne dionysische Figuren und Gruppen aufgemalt: ein tanzender Faun, eine Frau mit Schriftrolle und Efeu im Haar, der trunkene Papposilen, dessen gelbes herabgleitendes Gewand von einem Mädchen gehalten wird, der trunkene Dionysos, der von einem Satyr gestützt wird. Auf ihn schaut ein junger Mann, der sich die Augen wegen des Glanzes der göttlichen Erscheinung beschattet. In den Nischen ist der obere Wandstreifen unterschiedlich gestaltet: In der einen geht der Blick in einen nach oben offenen Hof, in der anderen stehen vor einem grünen Quaderwerk Masken und kleine Bilder.
Im hohen Atrium der Villa sind Reste einer ähnlichen Dekoration zu sehen, über der ein Waffenfries und darüber ein blauer Landschaftsstreifen sitzt. Viele der Türen sind später, als die Villa nicht mehr für die religiöse Feier verwendet wurde, zugemauert worden, viell. z. T. nach dem Erdbeben von 62 n. Chr., um das angegriffene Mauerwerk zu stützen. Von hier und auch vom Peristyl aus erfolgte der Zugang in einfachere Cubicula. Ein reicher ausgemaltes lag auf der linken Seite des Atriums am Ende eines Ganges. Seine große Öffnung zur äußeren Loggia konnte mit einer 3flügeligen Tür geschlossen werden, deren in der Asche entstandener Hohlraum mit Zement ausgegossen wurde. Solche Türen muß man sich in allen Öffnungen denken. Durch die kleinere Öffnung ist ein Cubiculum mit 2 Bettnischen zu sehen, deren Wände mit einer perspektivisch gemalten, phantastischen Theaterarchitektur dekoriert sind.
Auf der anderen Seite des Atriums führt der gleiche Gang zu einem Saal, dessen Wände ein ähnliches Architektursystem zeigen. Auf den Pilastern ruht ein porphyrgoldener Fries. Im unteren Teil stehen gelbe Platten hinter einer Front von ionischen Säulen. Die Perspektive des gekröpften Gebälkes zeigt, daß diese Front von dem 2. Interkolumnium aus betrachtet sein will. Der Fries trägt eine rote Decke. Unter ihm hindurch schaut man in einen hinteren Raum, der mit farbigen Quadern verkleidet ist. In der Mittelwand führt eine Scheintür in diesen hinteren Raum, der durch einen hohen Bogen nach außen geöffnet ist. Vor der Öffnung hängt an einer Leine ein violetter Vorhang.
Das Bestreben, die Wände mit einer perspektivisch gemalten Scheinarchitektur zu vertiefen, entspricht dem 2. pompejanischen Stil von etwa 80 bis 20 v. Chr. Die Villa ist zwischen 60 und 50 v. Chr. ausgemalt worden und zeigt ein schon fortgeschrittenes Stadium innerhalb dieser Phase der röm. Wandmalerei. Ungewöhnlich an der Ausmalung der Mysterienvilla ist der Figurenfries im Hauptraum. Es gibt aus Pompei und seiner Umgebung nur wenige Beispiele für diese großflächige Malerei: z. B. die Elefanten in einem Haus an der Via dell’Abbondanza und die Szene aus dem makedonischen Königshof aus der Villa bei Boscoreale (im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel). In späterer Zeit sind neben Dionysos auch andere Kulte für die Besitzer der Villa wichtig geworden. So ist es möglich, daß der Apsidenraum neben dem Peristyl dem Kaiserkult gedient hat. Eine Statue der Livia wurde bei den Grabungen gefunden (heute im Antiquarium).
Das Tablinum der Villa (heute Eingangsraum) ist später im 3. Stil ausgemalt worden. Auf seiner schwarzen Wand, die auf perspektivische Wirkung verzichtet, sitzt über dem Sockel ein Fries mit ägyptischen Figuren. Im 3. Stil sind auch die 2 Cubicula an der NW-Ecke der Villa ausgestattet: mit schwarzem Sockel, roten Feldern und weißer oberer Zone, über die ein feines Gespinst von geraden Linien gezogen ist. Aus der letzten Zeit der Villa stammt schließlich das Belvedere, der halbrunde Fensterraum in der Mitte der W-Seite, durch dessen Reste man heute den Bau betritt.
Antiquarium
Die veränderten Vorstellungen vom Ziel einer Grabung führten ab 1860 nicht nur zu dem Bestreben, die Wandmalereien in den Häusern zu konservieren; auch die Skulpturen und Gerätschaften sollten von nun an in Pompei bleiben. Deshalb wurde 1861 ein Antiquarium eingerichtet, nachdem man zuvor die Funde nach Neapel in das Archäologische Nationalmuseum gebracht hatte, wo sie einen wesentlichen Teil der Bestände ausmachen. Das Antiquarium wurde 1926 neu geordnet, 1943 nach der Bombardierung von Pompei geschlossen und 1948 anläßlich der Zweihundertjahrfeier der Grabungen neu eröffnet.
Das Antiquarium steht neben der Porta Marina vor dem Gelände des Venus-Tempels auf einer Terrasse, die aus den Gewölben einer vor der Stadt gelegenen Villa, der sog. Villa Imperiale, gebildet wird. Von hier bietet sich das gleiche Panorama über den Golf von Neapel bis nach Capri hin wie ehedem von dem Portikus der Villa aus.
In der Eingangshalle stehen 2 Frauenstatuen aus Terrakotta‚ die der vorröm. Epoche entstammen. Sie sind in das griech. Gewand der hellenistischen Zeit gekleidet: Über das lange Unter-
gewand wird ein Tuch aus feinem Stoff geschlungen, durch das sich die Falten des Rockes abdrücken. Die Statuen waren ehemals mit Stuck überzogen und bemalt, bei der kleineren ist noch das Weiß des Rockes und das Rot des Umschlagtuches sichtbar. — Die Marmorstatuetten dienten als Brunnenfiguren. Sie hielten entweder einen Gegenstand (etwa eine Vase), aus der das Wasser floß, oder das Wasser wurde durch sie hindurchgeleitet, wie bei der Statuette des ziegenhörnigen Gottes Pan (eine Kopie nach einem Werk des griech. Bildhauers Polyklet, 5. Jh. v. Chr.). — Weitere marmorne Brunnenfiguren stehen in den Vitrinen; hier außerdem 2 rote Reliefbecher, sog. Terra sigillata, aus einer im 1. Jh. v. Chr. berühmten Werkstatt in Arezzo, Bronzestatuetten, magische Gegenstände aus Bronze und Wandstücke mit eingekratzten Inschriften (Graffiti): ein Vers aus den Eklogen des Vergil und Bemerkungen über erwünschte oder erfüllte Liebe. — Die Terrakotta-Statuette eines sitzenden Mannes neben der Eingangstür stellt, lt. Inschrift auf der Basis, einen der 7 griech. Weisen dar, Pittakos aus Mytilene. Die Figur stand im Garten eines kleinen Hauses am Wasserbecken.
In den Räumen rechts von der Eingangshalle sind Funde aus dem vorröm. Pompei ausgestellt. Im 1. Raum enthalten 2 sich gegenüberstehende Vitrinen Grabbeigaben aus dem Sarno-Tal (9. bis 7. Jh. v. Chr.). Die Gefäße und Bronzegegenstände zeigen, daß die Bevölkerung in gleicher Weise unter etruskischem wie unter griech. Kultureinfluß (seit dem 8. Jh.) stand. In der Mitte des Raumes ist eines der Gräber nachgebildet. Das Skelett des Toten liegt zwischen den Beigaben, hauptsächlich schwarzer, etruskisch beeinflußter Keramik. — Vitrine 2 enthält die aus Terrakotta gebildeten Architekturverkleidungen des dorischen Tempels oberhalb des Theaters. Sie gehören zu einer Erneuerung des Bauschmuckes im 4./3. Jh. v. Chr. Die älteren Verkleidungen dieses Tempels sind in der Vitrine links davon zu sehen. Sie stammen noch aus der griech. Zeit von Pompei (ca. 470-450 v. Chr.) — In den Vitrinen an der Stirnseite und links davon werden Architektur-Terrakotten (z. T. noch mit Bronzenägeln zum Aufnageln der Platten) vom 1. Apollon-Tempel und Scherben griech. schwarzfiguriger und rotfiguriger Keramik aus dem Ende des 6. und dem Anfang des 5. Jh. v. Chr. aufbewahrt.
Im nächsten Raum sind Funde aus der samnitischen und der folgenden Epoche ausgestellt, als die Stadt unter hellenistischen Kultureinfluß gekommen war. Der Giebel gehört zu einem Dionysos-Tempel, der außerhalb der Stadt lag. In dem gestreckten Dreieck lagern sich Dionysos und seine Frau Ariadne. Neben dem Gott liegen ein Satyr und ein Panther, während auf der Seite Ariadnes Figuren aus dem Bereich der Liebesgöttin auftauchen: ein Eros mit einem Spiegel und die der Aphrodite heilige Gans. Vor dem Giebel steht der Altar des Tempels mit einer Inschrift in oskischer Sprache mit dem Namen des Stifters, des Ädils Maras
Atiniis. Der Tempel stand an der Stelle der Bahnstation von Pompei und ist ein früher Beleg für den. Kult des Dionysos, dessen wichtigstes Denkmal der große Fries in der Mysterienvilla ist. Auch die Figuralkapitelle sind mit dionysischen Themen dekoriert.
Im Durchgang: 1. der efeubekränzte Kopf des Dionysos, von 2 tanzenden Figuren begleitet; 2. ein Satyr mit der Hirtenflöte und eine tympanonschlagende Mänade. 2 weitere Kapitelle stehen zu seiten der Tür; sie stammen aus dem nach ihnen benannten Haus (Casa dei Capitelli figurati, Region 7, Insula 4, Nr. 57) und zeigen auf den 2 bearbeiteten Seiten je ein menschliches Paar und einen Satyr mit Mänade. Den vom Panther begleiteten Gott Dionysos mit Thyrsos, Kantharos und Efeu im Haar zeigt auch die Stele zwischen den Kapitellen. — Die geflügelte Sphinx im Durchgang stammt von einem samnitischen Grab bei der Porta Vesuvio. — Die Grabbeigaben in der Vitrine zeigen den griech.-hellenistischen Kultureinfluß im vorröm. Pompei, bemalte Keramik aus Unteritalien vom Ende des 4. Jh. v. Chr. und schwarze Gefäße mit weiß aufgesetzten Ornamenten oder mit Reliefschmuck aus dem 3. Jh. v. Chr. Auch die Plastiken sind von griech. Vorbildern abhängig: die weibl. Terrakottafiguren, die 2 Köpfe aus Stabiae und der kniende Telamon.
Im folgenden Raum sind röm. Bildnisse ausgestellt. In der Mitte eine Statue der Kaiserin Livia, der Frau des Augustus, die in der Mysterienvilla gefunden wurde. Das Gesicht ist für sich gearbeitet und in den über den Kopf gezogenen Gewandteil eingefügt. In dieser Tracht wird Livia in ihrer Rolle als Priesterin dargestellt. Rechts die Statue auf einer antiken Konsole das Bildnis des Marcellus, des Sohnes der Octavia, der Schwester des Augustus, der 20jährig in Baiae starb. Auch er ist mit dem über den Kopf gezogenen Gewandteil des Priesters dargestellt. Links und rechts in den Ecken 2 röm. Porträthermen: jeweils aus ihren Häusern das Bildnis des Cornelius Rufus und des Vesonius Primus, das die Inschrift trägt: Primo N[ostro] Anteros arcar[ius] (dem Primus — hat dieses Bildnis — der Bankier Anteros aufgestellt). Die unterlebensgroße Statue stammt von dem Grab der Istacidier vor der Porta Ercolano. Es handelt sich um einen Angehörigen der Familie, welche die Mysterienvilla besaß. Rechts neben der Statue auf einer Konsole ein Bildnis aus vorröm. Zeit, ein Beispiel der unter griech. Kultureinfluß entstandenen Kunst der italischen Stämme. 2 Köpfe in der Vitrine stammen aus der Casa degli Amorini dorati: das Bildnis eines Römers, wohl des Besitzers, und die Wiederholung eines griech. Bildnisses; es war dort im Garten mit den Maskenreliefs und Dionysos-Hermen aufgestellt und zeigt Menander, den großen Dichter der neuen Komödie. — Das Bildnis eines alten Mannes neben der Vitrine legt Zeugnis vom Beginn der röm. Porträtkunst ab, die aus den wächsernen Totenmasken “entwickelt worden sein soll. Diese Bildnisse
der Ahnen wurden bei den Leichenbegängnissen vorangetragen und in den Atrien der Häuser aufbewahrt. In der späten Republik und in der Kaiserzeit sind diese Galerien von Wachsmasken in Marmor umgesetzt worden. Eine solche in Marmor übertragene Wachsmaske scheint der Kopf des Alten zu sein.
Die 3 folgenden Räume enthalten Funde aus dem röm. Pompei, die einen Einblick in das tägliche Leben im 1. Jh. n. Chr. geben. In den Vitrinen im 1. der Räume v. a. Geschirr aus Bronze, Glas und Ton, Schmucksachen, Gegenstände und Geräte aus Elfenbein. — Im Durchgang zum 2. Raum liegen der Gipsausguß eines beim Vesuv-Ausbruch umgekommenen Menschen, der Kopf eines Mannes und ein in seiner Todesqual sich krümmender Hund. — Die Mitte des 2. Raumes nimmt das Modell einer Winzerei vom Hang des Vesuvs ein, deren Reste man bei Boscoreale ausgegraben hat. Die Trauben wurden mit großen Balkenpressen gepreßt, der Most in Tonkrügen vergoren, die in den Boden eingelassen waren, und dort auch aufbewahrt. — In den Wandvitrinen sind außer Geschirr die Werkzeuge verschiedener Berufe ausgestellt, links, neben dem toten Hund, in Vitrine 13 der Vorrat des Gemmenschneiders Pinarius Cerealis von der Via dell’Abbondanza. In Vitrine 14 Gerätschaften für den Fischfang und Muscheln aus der Hafenvorstadt (hierher gehört auch der Anker zwischen den Vitrinen); in Vitrine 15 Waagen und Farbvorräte; in Vitrine 16 rotes Reliefgeschirr aus Arezzo und darin (im unteren Teil) verkohlte Lebensmittel, Brote, Nüsse, Datteln und Getreidekörner. Die Vitrine 17 zeigt verkohlte Feigen, Haselnüsse, verkohlte Tuchreste und Bronzegeräte sowie Geschirr (Waagen, Wasserhähne, ein Warmwasserkessel, Gürtelschnallen, Schlüssel, Schlösser, Gartengerät, Siebe usw.). Die Vitrine 18 enthält außer Geschirr noch Münzen und Geräte eines Silberschmieds. Daneben steht eine Sonnenuhr.
Im letzten Raum, dem Durchgang zu der Porta Marina, stehen verschiedene Gipsausgüsse: ein kauernder Mensch, ein Baumstumpf und ein Wagenrad. Auf den herausgenommenen Mosaikfußböden sind bronzene Einrichtungsgegenstände aufgestellt: ein Tisch, ein Ephebe als Lampenhalter, schlanke, hohe Kandelaber, eine Konsole, die von einem Delphinreiter getragen wird, und ein Heizbecken für glühende Kohlen.
Stabiae, die dritte der vom Vesuv-Ausbruch d. J. 79 n. Chr. verschütteten Städte, hatte ein anderes Schicksal als Pompei und Herculaneum. Nur in der Zeit vor dem Bundesgenossenkrieg vom Jahre 90 v. Chr. an gleicht sich die Geschichte der 3 Orte. Auch Stabiae wurde von den einheimischen Italikern zu einem nicht
bekannten Zeitpunkt gegründet, gelangte abwechselnd unter griechischen, etruskischen und samnitischen Einfluß und war von etwa 340 v. Chr. an mit Rom verbündet. In der Nähe der Same-Mündung und an der innersten Bucht des Golfes von Neapel gelegen, wurde es noch vor Pompei zum Hafen eines Städtebundes, dessen Hauptort Nocera war, und dem außer Pompei und Herculaneum auch Sorrent und Salerno angehörten. Stabiae scheint mit seinem Hafen stark befestigt gewesen zu sein. Beim Bundesgenossenkrieg, 89 v. Chr., in dem die mit Rom verbündeten italischen Städte der Hauptstadt gleichgestellt werden wollten, wurde es von Sulla belagert, erobert und — im Gegensatz zu Pompei und Herculaneum — zerstört. Nur durch die Nekropolen ist heute noch bekannt, daß hier in der vorröm. Epoche eine Stadt gelegen hat. Von ihr selbst sind bislang keine Spuren gefunden worden.
Die an den Berghängen entspringenden Heilquellen ließen aber auf der Anhöhe von Varano, östlich des Stadtgebietes, ein neues luxuriöses Leben erblühen. Entsprechend Baiae an der anderen Seite des Golfes wurde Stabiae ein bevorzugter Villen-und Kurort der stadtröm. Gesellschaft; eines speziellen Rufes erfreute sich bei den röm. Ärzten die Milch von den Triften des Mons Lactarius (Monte Faito). Es entstanden weitläufige, um Peristyle geordnete Anlagen, in deren z. T. kleinen Räumen die besten Beispiele der röm. Wandmalerei des sog. 2. bis 4. Stils gefunden worden sind.
In das 9. Jh. fällt die Errichtung des »Castrum ad mare de Stabiis« oberhalb des Hafens, das dem Städtchen seinen neuen Namen gab (die heutige Ruine an der Strada Panoramica, mit mächtigen Rundtürmen, entstammt im wesentlichen dem Umbau unter Karl I. von Anjou). Die neuere Geschichte von Castellammare besteht hauptsächlich aus Zerstörungen und Plünderungen, denen der alte Baubestand des Ortes weitgehend zum Opfer fiel. 1749 begannen auf Anweisung Karls von Bourbon die ersten Antikengrabungen; Ferdinand IV. gründete die Werft, die heute den wichtigsten Industriezweig bildet, und erneuerte den Ruf der alten, schon von Plinius, Columella und Galen geschätzten Thermalquellen.
Antiquarium Stabiano
Die erste Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Antikenmuseum in der Via Marco Mario 2 (Einlaß durch den Kustoden in Nr. 6)
Wie in Pompei und Herculaneum begannen auch in Stabiae die Grabungen 1749, wurden aber ziellos und nur als Suche nach Kunstwerken durchgeführt und schon 1782 eingestellt. Die Funde aus diesen Unternehmungen gelangten in das Archäologische Nationalmuseum von Neapel. — Mit gründlichen Grabungen und der Konservierung der Funde am Ort wurde erst im 20. Jh. begonnen. Als deren Ergebnisse ist heute die Villa von S. Marco, weitgehend restaur., zu besichtigen; während in der etwa 1 km
entfernten, wegen eines Bildes berühmten Villa di Arianna in Varano noch gegraben wird. Die Einzelfunde, Teile der Wände und die Dekoration kleinerer Villen (Carniano und Petraro), sind in das Antiquarium gebracht worden. Hier hat man auch die Funde aus den vorröm. Nekropolen der Umgebung von Stabiae untergebracht, die sich (von Castellammare über Gragnano, Lettere und S. Antonio Abate am Fuß der Berge hinziehen.
Die im Saal I ausgestellten Malereien stammen aus der Villa von S. Marco. Bemerkenswert sind 2 Landschaften: In die eine ist eine Szene aus dem Ödipus-Mythos eingefügt; in der Mitte zwischen den Architekturen sitzt die Sphinx, vor ihr steht Ödipus, der das Rätsel löst. Die andere Landschaft zeigt im Vordergrund ein ländliches Heiligtum, im Hintergrund Berge und Villen. — Die roten Bildfelder mit den aufgemalten Figuren stammen von der Sockelzone einer Wand des 4. Stils, die anderen Stücke aus dem dekorativen Wandaufbau, so auch das größere Bruchstück mit dem Bild eines Bogenschützen, viell. des Gottes Apollon; es zeigt einen Durchblick, durch den die gemalte Scheinarchitektur auf den Wänden gegliedert wurde.
Im kleinen Raum VI finden sich weitere Fragmente von gemalten Wanddekorationen (auf gelbem Grund eine Landschaft und eine lila gekleidete, sitzende Frau). Stuckreliefs von einer gewölbten Decke aus einer Villa bei Petraro und Platten aus einem Fußbodenbelag.
An den Wänden von Saal II sind größere Teile der Stuckdecke aus der Villa in Petraro angebracht. Sie stammen von den Wänden und dem Gewölbe eines Baderaumes. Die 2 Bruchstücke mit den Reliefs von Faustkämpfen zeigen den. Aufbau der Wand: Über den Feldern der Sockelzone mit den springenden Greifen folgt das Hauptfeld mit den Figuren, über dem das Gewölbe beginnt. Auf dem Gewölbe saßen gerahmte Felder mit kleinen schwebenden Figuren. Auf anderen großen Feldern sind Narziß mit Eros und Dädalus mit Pasiphae dargestellt. Die 4 Vitrinen inmitten des Saales enthalten sowohl Gegenstände aus den röm. Villen als auch Beigaben aus den Gräbern der vorröm. Zeit, die in der Nähe von Castellammare aufgedeckt wurden. In der Villa von Varano sind die Münzen gefunden worden, die kurze Zeit vor dem Vesuv-Ausbruch geprägt wurden und alle das Profil des Kaisers Vespasian (69-79 n. Chr.) zeigen. Von den Grabbeigaben blieb v. a. die Keramik erhalten. Die ältesten Stücke stammen aus dem 7. Jh. v. Chr.
An der rechten Wand des Durchgangs zum Saal III ist ein Plan der Villa in Petraro angebracht, auf dem rechts die Räume des ehemals mit den Stuckreliefs verzierten Bades angegeben sind.
Die Vitrinen im Saal III enthalten Grabbeigaben, unter denen sich neben der einheimischen Keramik auch Importware be-
findet, v. a. fein bemalte rotfigurige Gefäße aus Athen (5. Jh. v. Chr.). — An den Wänden sitzen Malereien aus den Villen von Varano und S. Marco. Links hinter dem Durchgang: die Muse Melpomene mit der tragischen Maske im Arm. Von einer Decke stammt die fliegende Victoria mit Siegespalme, Schild und Speer, die auf ihren Schultern die Göttin Minerva trägt. Ebenfalls an einer Decke befand sich die Himmelskugel mit dem perspektivisch gemalten Himmelsäquator und den 6 Planetenbahnen; in der Kugel stehen Dionysos, eine weibliche Figur und 2 Putten mit Ähren und einem Hasen.
Im Durchgang zum Saal IV hat man die Grundrisse der beiden Villen angebracht, von deren Wänden die Bilder der 3 vorausgegangenen Säle abgenommen wurden, links Varano, rechts S. Marco.
Aus einer Villa bei Caiano (ebenfalls in der Umgebung von Castellammare) stammen die Wandteile im Saal IV. In einem der Räume bestand die Wand aus einer gelben Sockelzone und einem roten Hauptteil. Auf dem gelben Sockel wechseln fabelhafte Meerwesen und blaue Seelandschaften einander ab. Im roten Teil sitzen zwischen leichten Architekturen die Bilder, auf den roten, von einer zarten Ranke umgebenen Flächen schweben weibliche Figuren. Dem Fenster gegenüber ist der Triumph des Dionysos dargestellt. Der Gott ruht auf einem Lager, das von 2 bekränzten Stieren gezogen wird. Zu ihm schauen bekränzte Mänaden auf, die von einem die Doppelflöte blasenden Satyr angeführt werden. Neben dem Gespann reitet Silen auf einem Maultier. Die Mänade hinter ihm schlägt das Tympanon. Vor ihr schreitet ein kleiner bocksfüßiger ithyphallischer Satyr, und zwischen den Beinen der Stiere zieht das Tier des Dionysos, der Panther, mit dem Zug mit. — Das Mittelbild zeigt den Raub der Amphitrite durch Poseidon auf einem Meerpferd, das von einem Triton geführt wird. Vor dem Paar reitet Eros mit dem Dreizack des Poseidon auf einem Delphin. — Neben dem Fenster reitet ein Paar auf einem Meergreifen, wahrscheinl. Dionysos und Ariadne. — Rechts vom Durchgang steht ein gelbes Wandstück mit einem Lararium, einer Nische für die Hausgötter, auf deren Grund eine opfernde Minerva thront. Unter der Nische ringelt sich die im röm. Hauskult wichtige Schlange. Diese Wände sind im sog. 3. Stil von Pompei dekoriert. — Die gerahmten Wandteile, v. a. die schwebenden Figuren auf gelbem Grund, stammen aus anderen Villen.
Die Vitrinen im Saal VII enthalten Grabbeigaben aus den vorröm. Nekropolen von Stabiae, Schmuck, Fibeln und Gebrauchsgegenstände aus Bronze, Eisen und Muscheln, v. a. aber Keramik aus dem 7. bis 3. Jh. v. Chr. (einfache einheimische Ware, Gefäße, die nach griech. Vorbildern bemalt wurden, und griech. Importstücke). — Die Vitrine in der Mitte des Raumes zeigt ein italisches Grab aus dem 7. Jh. v. Chr. Die Asche des Toten, eine Speerspitze, verschiedene Fibeln für sein Gewand und 2 kleine
Gefäße sind in den Steinsarg gelegt worden. — Die Kapitelle und die Reste von Wandmalerei stammen aus röm. Villen.
Im Saal VIII werden steinerne Denkmäler aufbewahrt, die bis 1964 im Kapitelsaal des Domes standen. Einige von ihnen hat man bei der Erweiterung des Domes in den Jahren 1875-79 gefunden. Der 11. Meilenstein von der Straße zwischen Nuceria Alfaterna und Stabiae wurde unter der Regierung des Kaisers Hadrian i. J. 121 aufgestellt. Das bronzene Geschirr in der mittleren Vitrine gehörte zur Kücheneinrichtung einer röm. Villa bei Stabiae. — In den Ecken stehen marmorne Sarkophage oder Sarkophagdeckel: u. a. ein Sarkophagkasten mit Girlanden, Eroten und Masken, dessen Deckel noch aufsitzt; die Inschrift nennt eine Bettia Felicitas, die Frau eines Batinius Julius. — Der an seiner Vorderseite mit 10 Figuren im hohen Relief versehene Sarkophagkasten stellt ein gutes Beispiel dieser Gattung dar. Er zeigt Apollon umgeben von den 9 Musen; je 2 Figuren sind einander zugekehrt. Über der Schulter des Apollon wird noch der Kopf der Athena sichtbar. Durch die Anwesenheit der Göttin der Weisheit sind auf diesem Sarkophag alle Gestalten vereinigt, durch die das geistige Leben im 3. Jh. v. Chr. symbolisiert wurde.
Aus dem Kapitelsaal des Domes stammen die mittelalterl. Grabplatten von Kanonikern im Saal IX. Die mittlere Vitrine enthält Gegenstände aus spätröm. und früchristl. Zeit, darunter eine Elfenbeinfibel, auf der 2 sich umarmende Figuren eingraviert sind, viell. die Apostel Petrus und Paulus. — Das steinerne Portal mit den gedrehten Säulen stand ehemals am Eingang der Minoritenkirche von Castellammare. Das Skelett in der Vitrine davor wurde bei den Grabungen in der röm. Villa von S. Marco gefunden und gehört einer Frau, die beim Vesuv-Ausbruch von 79 n. Chr. ums Leben kam.
Im schmalen Gang XI sind Grabbeigaben aus den vorröm. Nekropolen der Umgebung von Stabiae ausgestellt. Die Stuckreste und Fragmente von Wandmalerei stammen aus einer kleinen röm. Villa aus Carmiano. Zum Schmuck von Villen gehörten auch das Alabastergefäß, das Brunnenbecken und die marmorne Statuette eines älteren Hirten mit einem Tier auf der Schulter.
Von den Kirchen der Stadt nennen wir: Il Gesù in der gleichnamigen Straße, einen Saalbau von 1615 mit einem Altarbild von Luca Giordano (Madonna del Soccorso). — Der Dom, eine 3schiffige Pfeilerbasilika mit hoher Vierungskuppel, stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jh., wurde aber 1875-93 durchgreifend erneuert. In der 1. Kapelle links eine Berufung Petri von Gius. Bonito; 4. Kapelle rechts: Heimsuchung von Giacinto Diana.
Die wichtigsten Antiken-Fundorte sind 2 große röm. Villen der Kaiserzeit östlich oberhalb der Stadt (Pianoro di Varano). Sie wurden 79 n. Chr. verschüttet, im 18. Jh. wiederentdeckt und werden seit 1950 systematisch ausgegraben. Ihre großartigen Ausmaße wie auch das künstlerische Niveau der erhaltenen Ausstattung kennzeichnen sie als Bauten imperialen Ranges; sie bilden damit die notwendige Ergänzung zum Bilde bürgerlichen Wohlstandes, wie es in Pompei und Herculaneum vor Augen tritt. Die Besichtigung muß mit dem Kustoden des Antiquariums verabredet werden.
Auf dem Weg passiert man die Grotta di S. Biagio, ein Michaels-Heiligtum mit Überresten von Fresken des 11. Jh. Darüber liegt auf dem Grundstück des Fondo de Martino die Villa A (Villa di Arianna, nach dem großen Dionysos- und Ariadne-Bild im Triclinium). Die ausgegrabenen Räumlichkeiten zeigen den Typus einer »Aussichtsvilla«, deren ausgedehnte Terrassen, Portiken und Kryptoportiken, parallel zur Hangkante, die vielfältigsten Ausblicke über den Golf und die Küste vom Faito bis zum Vesuv gewährten. Erhalten haben sich auch zahlreiche Wanddekorationen, darunter prächtige mythologische Bilder aus der Spätzeit des 3. Pompejanischen Stils und schöne Mosaikfußböden.
Die Villa B (Villa di S. Marco), auf dem Gelände der Fattoria dello Joio, zeigt eine recht ungewöhnliche Anlage, die sich am ehesten als die eines »Sanatoriums« verstehen läßt. Ihre Entstehung wird in die Jahre 62-79 n. Chr. datiert. »In flavischer Zeit«, schreibt F. Rakob, „wurde der nördliche, von einem tetrastylen Atrium erschlossene Wohntrakt mit einer aufwendigen Badeanlage, deren Bauflucht der abgewinkelten Stützmauer an der Hangkante folgt, um 2 weiträumige Peristyle erweitert. Die südliche Hofanlage, dreischenklig als Porticus triplex zum Meer geöffnet, war mit dem zentralen Gartenperistyl durch eine Rampe an der vorderen Terrasse verbunden. Das an flavischen Hangvillen ausgebildete Grundrißschema eines zum Landschaftsprospekt axial gerichteten Gartenhofs mit einem Saalbau an der Aussichtsfront ist hier mit neuen Raumformen anderer Architekturgattungen unverhüllt kombi-
niert: in hartem Bruch fügen sich die Fensterwände erhöhter Trikonchosräume an die Säulenhalle, während die östliche Schmalseite des Peristyls als gekrümmte Schaufassade mit Halbsäulen und Nischengliederungen ausgebildet ist, hinter der ein verschatteter Kryptoportikus verläuft. Im Zentrum der Exedra markierte ein Nymphäum den axialen Abschluß der Gartenzone, deren von regelmäßigen Baumreihen umstandenes, langes Wasserbecken den Blick aus einem höhlenartigen Grottenraum über den offenen Hof durch den weit geöffneten West-Oecus zum Meerprospekt lenkte.« Der malerische Schmuck auch hier von erlesener Feinheit.
Die bevorzugte Villeggiatura der Neuzeit waren die bewaldeten Hänge des Monte Faito im S der Stadt. Boccaccio beschreibt im »Decamerone« (X, 6) das hier gelegene Landhaus des Neri degli Uberti. Villa Quisisana, als Sommersitz der angiovinischen Herrscher 1310 von Robert (1. Weisen gegr., diente v. a. König Ladislaus und seiner Schwester Johanna II. als Aufenthalt. Der heutige Bau am Ende einer Steineichenallee, die vom höchsten Punkt der »Strada Panoramica« gegen den Berg aufsteigt, stammt aus der Zeit Ferdinands I. von Bourbon (1820); an der Rückfront ein prachtvoller Park mit säkularem Baumbestand. 1860-1967 diente die Villa als Hotel; seitdem ist sie verlassen und scheint dem Verfall entgegenzugehen.
Vor dem westl. Ortsausgang, oberhalb der Straße nach Sorrent, liegt die Kirche S. Maria di Pozzano, 1506 gegr., mit Bildern und Fresken von Paolo de Matteis, Sebastiano Conca und Giacinto Diana.
Die von der Strada Panoramica südöstlich abzweigende Straße führt nach dem munteren Städtchen GRAGNANO (Chiesa del Corpus Domini, Ende 16. Jh., mit Bildern von Marco Pino und Giacinto Diano); weiter östlich der Ortsteil Lettere (Lactarius) mit einer großartigen Burgruine (gegr. im 10. Jh., von den Anjou erneuert) und weitem Blick über die Sarno-Ebene zum Vesuv. Am Fuß dieser Berge fand 553 die Schlacht zwischen Narses und Teia statt, die der Gotenherrschaft in Italien ein Ende setzte.
Vico Equense, das röm. Aequa oder Aequana (wahrscheinl. von aequum‚ Ebene) liegt auf einem Tuffplateau mit senkrecht ins Meer abstürzenden Wänden an der W-Flanke des Monte Faito. In den Gotenkriegen des 6. Jh. wurde die Römersiedlung vollkommen zerstört; ein Fischerdorf an der Marina di Equa fiel den Sarazenenstärmen des 9. Jh. zum Opfer. Auf den Mauern der alten Oberstadt, deren regelmäßiges Straßennetz sich im heutigen Stadtplan noch deutlich abzeichnet, gründete Karl II. von Anjou gegen Ende des 13. Jh. ein neues Städtchen; es hieß zunächst ein-
fach Vico (vicus: Dorf, Häusergruppe), dann Vico di Sorrento; im 18. Jh. kam der heutige Name in Gebrauch.
Spuren angiovinisch-aragonesischer Paläste finden sich noch in manchen Straßen des alten Zentrums (v. a. Vico Monte und Via Monsignor Natale), sind allerdings durch Neubauten der letzten Jahre vielfach brutal zerstört worden. — Das Jesuiten-Noviziat (Palazzo Giusso, 1610 erb. und nach 1822 verändert) am Ende der Via Girolamo Giusso enthält Überreste des von Karl II. errichteten Kastells. — Am W-Ende der Marina di Equa steht die Ruine des angiovinischen Arsenals, ein massiver würfelförmiger Bau mit spitzbogigen Portalen, im Inneren eine Halle mit 2-3 kreuzgewölbten Jochen auf quadratischen Pfeilern; später mehrfach umgebaut und verändert.
Chiesa dell’Annunziata
Die Kirche wurde von Karl II. gegründet und war bis 1799 Kathedrale. Ihre prekäre Lage am Rande des Steilabsturzes über der Marina hat immer neue Reparaturen notwendig gemacht (zuerst 1587-89, dann v. a. im 19. und 20. Jh.); doch ist die Struktur des got. Urbaus einigermaßen erkennbar geblieben.
Die Längswände zeigen außen noch einige der alten Spitzbogenfenster; die Eingangsfassade ist barock erneuert, daneben steht ein massiver 4geschossiger Campanile (17. Jh.). — Das Innere, durch die jüngste Restaurierung erbärmlich zugerichtet, war eine 3schiffige Basilika mit offenem Sparrendach über dem Mittelschiff und kreuzrippengewölbten Seitenschiffen (originale got. Gewölbe unter barockem Verputz hat noch die Sakristei am linken Seitenschiff). An den spitzen Triumphbogen schließen sich ein Querschiff und 3 Chorkapellen, die mittlere mit zierlichem Rippengewölbe über 5 Seiten des Achtecks.
Ein Fresko des 14. Jh. (Madonna) hat sich über dem Eingang der letzten Seitenkapelle links erhalten. — Die 5 Bilder der Apsis (Marienleben) stammen von Giuseppe Bonito (1787). Am Ende des rechten Seitenschiffs das Grabmal des Bischofs Cimmino, von 1343; darunter das Fragment einer frühmittelalterl. Schrankenplatte mit einem prächtigen Flügelroß (vgl. die entsprechenden Stücke im Mus. Correale zu Sorrent). — Am 1. Schiffspfeiler rechts das Grabmal des großen Staatsrechtlers Gaetano Filangieri, der sich 1788, schwer lungenkrank, in das Kastell von Vico Equense zurückgezogen hatte, das damals seiner Schwester Teresa Satriano-Ravaschieri gehörte (vgl. S. 320). Er starb noch im gleichen Sommer, im Alter von 36 Jahren; der letzte Band seiner »Scienza della Legislazione« blieb unvollendet.
Oberhalb des Ortes liegt die Kirche SS. Ciro e Giovanni, 1715 anstelle eines älteren, von Alfons I. von Aragon restaurierten Baues neu errichtet, mit feiner, leicht geschwungener Stuckfassade und farbiger Majolikakuppel.
Im westlich des Tales gelegenen Ortsteil Seiano (nach L. Aetius Seianus, dem mächtigen Günstling des Tiberius, der hier eine Villa besessen haben soll) steht das kleine Santuario di S. Maria delle Grazie oder S. Maria Vecchia, im 14. Jh. gegr. und modern erneuert; vom Urbau ist ein Madonnenfresko über dem Portal übrig geblieben. — Die hübsche Kirche S. Marco, mit 2 Türmchen zu seiten der Fassade und strebepfeilerbewehrter Kuppel, wird dem Vanvitelli-Schüler Bartolomeo Bottiglieri zugeschrieben.
Von der Höhe der Punta Scutolo westlich Seiano geht der Blick über den Piano di Sorrento mit den Ortschaften Meta, Piano, S. Agnello und Sorrent. Die Formation des Geländes ähnelt der von Vico Equense: im Schutz des Kalkgebirges, das im W mit der Punta del Capo wieder zur Küste vorspringt, hat sich eine flache, leicht nach N geneigte Tuffbank angelagert, deren Rand steil gegen das Meer abstürzt. Von den Bergen herabkommende Wasserläufe haben tiefe Schluchten in den weichen Stein geschnitten; die Straßen verlaufen vielfach als Hohlwege zwischen hoch ummauerten, mit hölzernen Matten abgedeckten Agrumengärten, durch deren dunkles Laubdach kein Sonnenstrahl zur Erde dringt.
Die unvergleichliche Eignung des Platzes als Sommerfrische erkannten zuerst die Römer der Kaiserzeit (Augustus, Agrippa, Antoninus Pius), nachher v. a. die Reisenden des 18. und 19. Jh. Seine landschaftlichen Reize beschrieben und besangen im Altertum Plinius d. Ä. und Statius, Ovid, Horaz und Martial; in die neuere Literaturgeschichte ist Sorrent als Geburtsort Torquato Tassos (1544-95) eingegangen. Der Vater Bernardo Tasso, Sekretär des Ferrante Sanseverino, stammte aus Bergamo, die Mutter Porzia de’ Rossi aus Neapel (vgl. S. 209). Zwei Zimmer des angeblichen Geburtshauses werden im Albergo Imperiale Tramonto (Via Vittorio Veneto) gezeigt. In der Strada S. Nicola 29 (westwärts der Via Tasso) steht die Casa Fasula, vormals Sersale; hier wohnte als Witwe des Marzio Sersale Torquatos Schwester Cornelia, die den Dichter nach seiner Flucht aus Ferrara im Juli 1577 aufnahm und bis zu seiner Abreise nach Rom im Dezember dieses Jahres beherbergte.
Die archäologischen Funde in den Grotten der Sorrentiner Küste reichen bis in die Jungsteinzeit zurück. Eine J. griech. Siedlung ist vermutl. von Capri aus gegründet worden; nach ihrem Seesieg
über die Etrusker (474 v. Chr.) brachten die Syrakusaner den Ort in ihren Besitz; auf sie folgten die Samniten und endlich die Römer. Der latein. Name Surrentum wird von einem (hypothetischen) griech. Sireon abgeleitet, und mit anderen Orten der Küste streitet Sorrent um den bedenklichen Ruhm, als Heimstätte der Sirenen zu gelten. Noch bei Strabo findet sich die Bezeichnung Promontorium Sirenum für die Spitze der Halbinsel. Die Durchfahrt zwischen ihr und Capri war wegen ihrer heftigen Stürme gefürchtet, und man suchte die unheilbringenden Meerwesen durch Opfergaben zu besänftigen; ein dem Kult der Sirenen geweihtes Heiligtum, übrigens das einzige in der hellenischen Welt, scheint in der Gegend von Massa Lubrense, viell. auch weiter südlich an der Marina di Jeranto gestanden zu haben. Später stellten die Schiffsleute sich unter den Schutz der Athena, deren Name seither mit dem Kap verbunden ist (Capo Minerva). Ihr Tempel wurde der Sage nach von Odysseus gegründet, von Augustus restauriert; sein Standort läßt sich mit einiger Sicherheit auf der Felsenterrasse an der südl. Spitze des Vorgebirges lokalisieren, die heute den Leuchtturm trägt (Punta della Campanella).
Deutlichere Spuren des antiken Surrentum finden sich im Bereich der Stadt selbst. Ihre Grenzen sind von Natur aus vorgezeichnet durch tiefe Schluchten im O und W, z. T. auch im S, und durch den Steilabsturz zum Meer. Innerhalb dieses Gevierts blieb das Weichbild der Stadt durch die Jahrhunderte unverändert, und die im 16. Jh. neu errichtete Stadtmauer, von der an der S- und W-Seite noch Teile zu sehen sind, folgt überall dem Zug des antiken Mauerringes. Im N hat sich am Fußweg zur Marina Grande eines der griech. Stadttore erhalten, mit prachtvollem Quaderwerk, das ins 5. Jh. v. Chr. datiert wird (der äußere Bogen 16. Jh.); weitere Reste griech. Mauerwerks finden sich am S-Tor (Via Parsano).
Klar erkennbar ist das griech. Straßennetz: Zwischen Piazza Tasso und Piazzale Parsano bilden 5 Decumani (im S war noch ein 6.) und 8 (heute 7) Cardines rechteckige Insulae von etwa 55 x 80 m Seitenlänge. Die Straßen sind, wo die alten Baufluchten noch bestehen, nicht breiter als 3-4 m. Übrigens findet man auch in der ostwärts angrenzenden Ebene noch vielfache Spuren eines alten rechtwinkeligen Wegnetzes, das durch Mauern und Wasserleitungen fixiert worden ist. Ein großer röm. Aquädukt führte unterirdisch von den Höhen im S (Fontanelle) nach Carotto, von dort entlang der Hauptstraße nach Sorrent; das aus tiefen Zisternen bestehende Hauptreservoir liegt in den Gärten
ostwärts der Piazza Tasso. — Den Decumanus Maximus der Stadt bildete die Via Tasso, den Cardo Maximus die Via S. Cesareo/Via Fuoro; diese bezeichnet zugleich den Ort des Forums.
An der Stelle der SS. Annunziata soll ein Kybele-Tempel gestanden haben, am Ufer der Marina Grande Tempel der Ceres und der Venus. Vergil brachte der Venus von Sorrent einen marmornen Amorino als Weihgeschenk dar, um ihren Beistand für die Vollendung der »Aeneis« zu erflehen.
Der Uferrand des Plateaus, auf dem heute die großen Hotels stehen, war in röm. Zeit von. Privatvillen besetzt; zu ihnen gehörten wahrscheinl. auch ein Zirkus, eine Therme und ein Theater, deren Spuren man östlich der Altstadt gefunden hat (im Bereich der Villa Correale, des Albergo Royal und des Albergo Vittoria). Die Villen hatten durch Tunnel Zugang zum Meer und setzten sich am Strand in allerlei maritimen Anlagen fort (Häfen, Fischbecken, Nymphäen); man findet derartige Mauerreste noch in dem pittoresken Vallone del Pizzo (auch Golfo del Pecoriello) östlich der auf einer doppelten Reihe von Substruktionsbögen stehenden Villa Crawford (S. Agnello); ferner unterhalb des Convento dei Cappuccini (Villa Nicolini); an der Marina Grande unterhalb der Piazza della Vittoria, des Albergo Syrene und der Villa Tritone (u. a. ein wohl erhaltenes, aus dem Tuff gehauenes Nymphäum mit Spuren von Mosaik- und Stuckdekor, der Frontbau aus Mauerwerk erneuert); Von der Terrasse der Piazza della Vittoria aus sieht man bei heller Sonne und ruhigem Meer auch unterseeische Mauerzüge, viell. Reste von Wellenbrechern zum Schutz der am Ufer gelegenen Baulichkeiten. — Auch die Berghänge südlich der Stadt scheinen Landhäuser getragen zu haben; Ortsnamen wie Cesarano deuten auf kaiserliche Besitzungen hin.
Die bekannteste der Sorrentiner Villen lag auf dem Vorgebirge im W; ihr Besitzer war Pollius Felix, ein reicher Puteolaner, der nach der Mitte des 1. Jh. n. Chr. in seiner Vaterstadt und in Neapolis verschiedene politische Ämter bekleidete, sich aber bald ins Privatleben zurückzog und als Schriftsteller und Philosoph dilettierte. Ein enges Freundschaftsverhältnis verband ihn mit dem Dichter P. Papinius Statius; dieser war öfters im »Surrentinum Pollii« zu Gast und hat in seinen »Silvae« (II, 2) eine ebenso ausführliche wie begeisterte Schilderung der Anlage gegeben. Sie bildet einen fundamentalen Text für das Verständnis röm. Bau-und Lebens-
gewohnheiten. In immer neuen Wendungen feiert Statius den Villenbesitzer als einen Bezwinger der Natur; diese fügt sich willig dem ihr bisher unbekannten Dienst, lernt das Joch des Bauherrn zu tragen und dem Menschen freundlich Zu sein: Die schroffen Berge sind als Terrassen gezähmt, der Weg, urspr. rauh und staubig, ist geglättet und befestigt worden; wo kahler Fels war, wächst jetzt ein hoher Hain. Die Räume und Hallen der Villa sind jedem Bedürfnis angepaßt; es wechseln Morgen- und Abendsonne, Hitze und Kühle, Wind und Windschatten, das Brausen der Wellen und ländliche Stille; auch die Aussicht erneuert sich von Zimmer zu Zimmer, jedes Fenster rahmt und beherrscht einen bestimmten Fernblick.
Trümmer der Anlage sind an verschiedenen Stellen des Vorgebirges zu finden. Eine Abzweigung der Straße nach Massa Lubrense im Ortsteil Capo di Sorrento (an der Ecke Nr. 31 die Villa Il Sorito, in der Maxim Gorki 1924-33 gewohnt hat) führt zur Punta del Capo, mit weitläufigen Mauerresten und einer im Volksmund Bagno della Regina Giovanna genannten Felsenbucht, viell. künstlich ausgehauen oder erweitert, in die das Meer durch ein gemauertes Bogentor eintritt. — Es folgt die idyllische Bucht von Marina di Puolo (Pollio), im W begrenzt vom Capo di Massa; auf seinen Hängen, heute durch einen Steinbruch verwüstet, liegen die Überreste ausgedehnter Baulichkeiten. Man erkennt zuoberst die Stelle des Hauptpalastes der Villa; er lag auf einer planierten und durch Substruktionen gestützten Terrasse mit halbrunder Aussichtsexedra (vgl. die Tiberius-Villen auf Capri); darunter ein weit auseinandergezogenes Gartenperistyl; am Ufer Nymphäen, Grotten, Schwimmbecken und Ruheräume. Irgendwo am Strand standen Tempel des Herkules und des Neptun.
Reste weiterer Villen, Grotten, Ziegel-und Retikulatmauerwerk findet man allenthalben auf den Klippen und in den Strandbuchten der Küste bis zum Kap Minerva.
Die mittelalterl. und neuere Geschichte von Sorrent ist reich an kriegerischen Verwicklungen und inneren Kämpfen. Gegen Goten, Byzantiner und Langobarden, Sarazenen und Amalfitaner konnte die Stadt ihre Selbständigkeit bewahren; seit 1137 gehörte sie zum Normannenreich. Das 13. und 14. Jh. sind von sozialen Auseinandersetzungen erfüllt. Zwischen 1528 und 1542 kämpften Franzosen und Spanier um den Besitz des Ortes. 1558 von türkischen Piraten gebrandschatzt, ging die Stadt an den Bau nicht nur der
üblichen Wachttürme, sondern eines ordentlichen Mauerrings, der dem Zug der antiken Stadtmauer folgte (s. o.) und 1561 vollendet war. 1648 griffen die Masaniello-Unruhen aus Neapel auf Sorrent über; 1656 wütete eine Pestepidemie, 1799 kam es zu schweren Kämpfen zwischen Royalisten und Republikanern.
S. Antonino (an der gleichnamigen Piazza, nördl. der Piazza Tasso)
Die Kirche ist wahrscheinl. die älteste der Stadt. Ihre Lage an der Stadtmauer wird aus dem Wunsch dieses Sorrentiner Heiligen des 6./7. Jh. erklärt, weder in noch außerhalb der Stadt begraben zu sein.
So ist die Krypta der Kirche vermutlich aus einer Coemeterialbasilika des 1. Jahrtausends hervorgegangen; doch hat der Umbau von 1753 den urspr. Zustand unkenntlich gemacht. — Die Form der Oberkirche, einer 3schiffigen Basilika mit je 8 Rundbogenarkaden auf antiken Granitsäulen, könnte auf einen Bau der Normannenzeit (12. Jh.) zurückgehen; er wurde 1608 erneuert und seitdem mehrfach restauriert. Auch die 3bogige Vorhalle scheint noch dem 1. Plan anzugehören. Erhalten hat sich aus dem 12. Jh. ein schönes Portal an der rechten Seitenwand, aus antikem Spolienmaterial.
An der Decke des Mittelschiffs Wundertaten des Titelheiligen, von G. B. Lama (1734); im Querschiff große Historienbilder (Belagerung von Sorrent 1649, Pest 1656) von G. del Pò (1687); in der Apsis die 5 Schutzheiligen der Stadt, G. B. Lama zugeschrieben; darunter Ruhe auf der Flucht und Ekstase des hl. Cajetan Thiene, von del Pò (1685). Die Kirche besitzt eine berühmte Weihnachtskrippe mit Figuren der wichtigsten Krippenmeister des 18. Jh.
Dom SS. Filippo e Giacomo (Largo Arcivescovado / Corso Italia)
Wahrscheinl. anstelle einer älteren Kirche oder Kapelle in der 2. Hälfte des 15. Jh. errichtet, wurde der Bau später mehrfach restauriert. Ins 11. oder 12. Jh. läßt sich der von 4 antiken Säulen flankierte Bogendurchgang im Untergeschoß des Campanile datieren. In der rechten Seitenwand der Kirche liegt ein 1479 datiertes Marmorportal mit den Wappen der Aragonesen, des Papstes Sixtus IV. und des Erzbischofs Giacomo de Angelis. Die neugot. Eingangsfassade entstand 1913-26.
Das Innere, eine 3schiffige Pfeilerbasilika, hat im Mittelschiff links den Bischofsthron unter einem Marmorbaldachin aus antikem
Spolienmaterial, von 1573; aus dem gleichen Jahr die Kanzel gegenüber; darunter eine Madonna mit Johannes d. T. und dem Evangelisten von Silvestro Buono. Das Deckenbild des Mittelschiffs stammt von Oronzo Malinconico (Sorrentiner Märtyrer und Bischöfe, 1685), das des Querschiffs von Giac. del Pò (Assunta mit SS. Filippo e Giacomo). Schönes intarsiertes Chorgestühl. Im rechten Seitenschiff sind neuerdings Fragmente marmorner Schrankenplatten aufgestellt worden, die ins 11. oder frühe 12. Jh. datiert werden, darunter eine prächtige fauchende Löwin (vgl. die Sammlung im Mus. Correale, s. u.).
Im Treppenhaus des Arcivescovado ein röm. Sarkophagrelief (Amazonenschlacht).
An der Piazza F. Saverio Gargiulo 7 liegt der hübsche Kreuzgang des Franziskanerkonvents (seit dem 8. Jh. Benediktinerkloster, Anfang 15. Jh. von den Franziskanern übernommen; die angrenzende Villa Comunale war der Klostergarten). Die gekreuzten Spitzbogenarkaden auf Säulchen und Achteckpfeilern, wohl vom Ende des Trecento, bilden einen späten Nachklang der bekannten Kreuzgänge von Amalfi und Ravello; 2 Seiten im 15. Jh. erneuert (Rundbogen); 3 Eckpfeiler innen durch antike Säulen verstärkt (1932-42 restaur.).
Von den zahlreichen Spätbarockbauten nennen wir: S. Paolo (Via Tasso) vom Anfang des 18. Jh., Saalkirche mit reich gegliederter Tambourkuppel über der Vierung, schönen Stuck- und Holzdekorationen, Fußboden in Majolika und Backstein; großangelegte Fassade mit Ecksäulen und Doppelpilastern (unvollendet), die Kuppel mit bunter Majolikahaube. — Chiesa dell’Addolorata (Via S. Cesareo), Ovalraum mit 4 Kreuzarmen, reicher Stuckdekor, Fußboden. — S. Maria del Carmine (Piazza Tasso), Stuckausstattung 2. Hälfte 18. Jh. — S. Onofrio, eine lustige Stuckfassade an der Straße zwischen Sorrent und S. Agnello. — Südlich oberhalb der Stadt (Abzweigung der Straße nach Massa links, kurz hinter dem Piazzale Parsano) liegt am Fuß der Felswand S. Antonio: Eine Allee mit buntgekachelten Ruhebänken führt durch einen Agrumenhain zu dem weißverputzten Bau, einer winzigen Saalkirche des 18. Jh.
Überreste bedeutender Profanbauten des Mittelalters finden sich in vielen Straßen der Altstadt. In der Strada Pietà 14 (südlich des Corso Italia, zwischen Piazza Tasso und Dom) steht der Palazzo Venier, wahrscheinl. aus dem 13. Jh., mit je 3 Bogenfenstern in 2 Geschossen, gerahmt von Schmuckbändern mit Zickzack-und Rhombenmuster aus grauem und gelbem Tuffstein, dazwischen Tondi mit Sternen, in denen bunte Majolikascheiben (patere) saßen. — Ebendort Nr. 24 der Palazzo Correale mit durazzeskem Portal und Spitzbogenfenster mit feinem Maßwerk, 1.
Hälfte des 15. Jh. — Ein reich ornamentiertes Durazzo-Portal der gleichen Zeit an der Casa Ferola, (Via Grazie 8, Piazza S. Antonino); weitere alte Portale in der Strada S. Nicola 8, Via dell’Accademia 11, Via Fuoro 15 (wohl noch roman., mit antikem Spolienmaterial). Eine Quattrocento-Fassade mit 3bogiger Säulenloggia findet sich am Ende des Vico Galantariaro (südl. Abzweigung der Via Pietà). — In Via S. Cesareo 61 ein prächtiges Haus des 17. Jh.; die Rückwand des Gartens (zum Vico delle Grazie) hat einen Erker mit zierlichem Doppelfenster des 15. Jh., letztes erhaltenes Beispiel einer spezifisch sorrentinischen Bauform, von der man noch vielfach vermauerte Überreste hat.
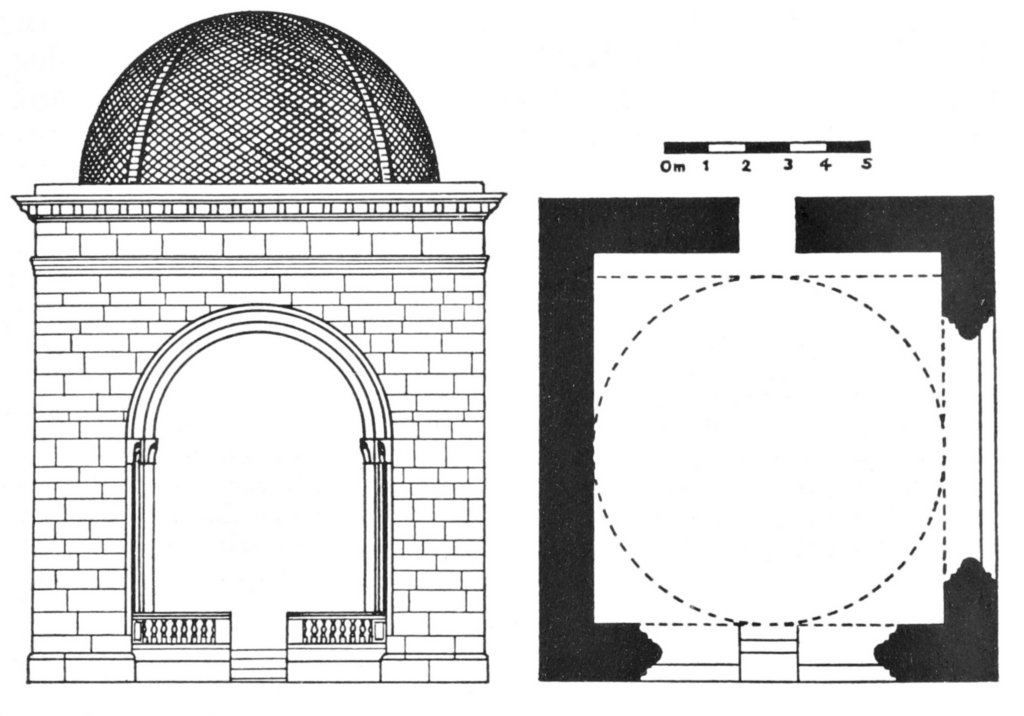 Sorrent. Sedile Dominova, Fassade und Grundriß
Sorrent. Sedile Dominova, Fassade und Grundriß
Sedile Dominova (Via S. Cesareo, Ecke Via Reginaldo Giuliani)
Das leidlich erhaltene Bauwerk gibt einen Begriff von der Architektur dieser in Neapel fast spurlos verschwundenen Gebäudegattung (vgl. S. 20). Es handelt sich um eine quadratische Halle mit halbkugeliger Kuppel, nach den beiden Straßenseiten in großen Arkaden geöffnet. Die architektonischen Hauptmotive (Rundbogen, Pendentifkuppel) weisen
in die 2. Hälfte des 15. Jh.; das ornamentale Detail zeigt die damals übliche Mischung von Frührenaissance (Kranzgebälk) und fortlebender katalanischer Gotik (Bogenprofile, Kapitelle). Die Balustrade stammt wohl erst aus dem 16., die Majolikaverkleidung der Kuppel aus dem 17. Jh. Ein dahinterliegender geschlossener Saal diente den hier versammelten Nobili zur geheimen Beratung. — Der 2. »Sitz« der Stadt, Sedil di Porta genannt, befand sich urspr. im Kastell des heute verschwundenen O-Tores; von einem 1505 errichteten Neubau sieht man noch einen Rest unter dem Glockenturm in der Via S. Cesareo (Ecke Piazza Tasso).
Museo Correale (am Ende der Via Correale, westl. der Altstadt)
Das Museum verdankt seine Entstehung einer 1917 konstituierten Stiftung der Brüder Alfredo und Pompeo Correale di Terranova, die damit das Andenken ihrer aussterbenden Familie lebendig hielten. Schon 1428 erhielt Zottolo Curiale von Johanna II. von Anjou das Gelände der Villa am Capo di Cervo zwischen Sorrent und S. Agnello zugesprochen; 1481 wurde der Besitz von Ferrante I. bestätigt.
Der heutige Bau stammt aus dem 18. Jh.; er enthält nicht nur eines der schönsten Provinzmuseen Kampaniens, sondern bietet auch Gelegenheit zu Spaziergängen in einem der berühmten Sorrentiner Orangenhaine.
Das Museum wurde 1924 eröffnet, 1953 neu geordnet. Aus dem Besitz der Familie Correale kommen in erster Linie die reichen kunstgewerblichen Sammlungen: europäisches und orientalisches Porzellan, Majolika, Glas, Möbel, Waffen u. a. Angela de’ Medici d’Ottajano, die Witwe Alfredos, steuerte den größten Teil der Gemälde bei; die antiken und mittelalterl. Bildwerke gehörten meist der Stadt Sorrent. Wir heben im folgenden nur einige besonders wichtige Stücke hervor; für das Kunstgewerbe bietet der Museumsführer von G. Morazzoni eine zuverlässige Übersicht.
Erdgeschoß. In Saal II und in der Bibliothek eine Sammlung seltener Ausgaben der Werke Torquato Tassos, auch einige Autographen des Dichters, darunter ein verzweifelter Brief von 1585 an den Arzt Ottavio Pisano, der ihn von »Melancholie, Wassersucht und Fäulnis« befreien soll. — In Saal IV steht die Sorrentiner Basis, ein leider stark beschädigtes Meisterwerk der röm. Skulptur aus der Zeit des Augustus. Es handelt sich wohl um die Basis einer monumentalen Sitzfigur, vermutl. des Kaisers selber; die Reliefs, stilistisch eng verwandt mit denen der »Ara Pacis« in Rom, werden als Schutzgötter des Julischen Hauses gedeutet: An der vorderen Schmalseite sitzt vor einem ionischen Tempel der Genius Augusti (nur Beine und Füllhorn erkennbar);
rechts steht Mars, ein kleiner Amor ist dabei, ihn der links zu ergänzenden Venus zuzuführen; an der Rückseite Apoll als Kitharöde zwischen Artemis mit der Fackel und Sito mit dem Szepter, zu deren Füßen die weissagende Sybille; an den Langseiten links die sitzende Kybele, dahinter ein Löwe, ein Korybant und eine Matrone; rechts in einem Tempel Vesta mit ihren Priesterinnen. — An der Wand eine ägyptische Basaltskulptur, Fragment eines »Pastophoros« (Bettelpriester, die Schreine mit Götterbildern durch die Straßen trugen und um Almosen baten) aus der Zeit Sethos’ I. (ca. 1200 v. Chr.). — Ferner beachtliche Fragmente griech. Bildwerke, prähistorische und griech. Gräberfunde. — Saal V enthält röm. Plastik, darunter Sarkophagreliefs des 1. Jh. v. Chr. (Amazonenschlacht, die 7 griech. Weisen).
Von höchstem Interesse ist die Sammlung mittelalterl. Reliefplatten in Saal VI. Es sind hauptsächlich Fragmente von Chorschranken aus verschwundenen Sorrentiner Kirchen. Die 2 großen querrechteckigen Platten mit Paaren von Greifen und Flügelrössern, wohl gegen 1100 entstanden, gehören einem in Kampanien mehrfach vorkommenden Typus an; gegenüber Werken des 10. Jh. (Cimitile) zeigt sich ein Fortschritt in der organischen Durchbildung der Körper und Köpfe, in der Festigung des Standmotivs und in der stabilen Füllung der Fläche. Etwa in die gleiche Zeit gehören die kleinen Platten mit einzeln oder paarweise angeordneten Tieren (Greifen, Pfauen, Flügelpferde, Adler) in runden Rahmenfeldern; sie lassen sich bis in alle Einzelheiten auf byzantin. Kopien sassanidischer Seidenstoffe zurückführen (nahe verwandte Stücke in Rom, Mus. Baracco). Das gleiche gilt für eine Reihe einzelner Bruchstücke, darunter einen prachtvollen Leoparden, der sonderbarerweise in eine vor ihm aufwachsende Pflanze beißt. Ins 12. Jh. gehören der großartige aufrechtstehende Adler, mit ungemein reicher und fein stilisierter Durchbildung des Federkleides, und eine dreieckige Platte (Tafel S. 576) von einer Kanzelbrüstung mit einem phantastischen Meerungeheuer (dem Walfisch der Jonaserzählung), begleitet von munter die Wellen durchkreuzenden Fischlein (ähnliche Stücke in Capua, Minturno, Gaeta u. a.; im übrigen vgl. man auch die Platten in den Kirchen von Sorrent (S. 567), Vico Equense (S. 561) und Neapel (S. 65, 134, 161).
In den Sälen des 1. Obergeschosses befindet sich v. a. Kunstgewerbe; außerdem eine reiche Sammlung von Werken neapolitan. Maler des 19. Jh. (Pitloo, Gigante, Duclére u. a.). — In Saal VII eine Seelandschaft von Salvator Rosa. — In Saal X Krippenfiguren des 18. Jh. (Vassallo, Mosca, Sammartino).
Im 2. Obergeschoß Fortsetzung des Kunstgewerbes, außerdem interessante Gemälde: In Saal XVI 3 anonyme Bilder des 15. Jh. aus Neapel (Dreifaltigkeit, Pietà, Verkündigung) und Werke von Lama, Corenzio, Previtali, Teodoro d’Errico. — Saal XVII: 2 Studienköpfe von van Dyck. — Saal XVIII: Kreuztragung von Bonito, Pietà von A. Vaccaro. —
Saal XIX-XXI: Pfingstwunder von Francesco Celebrano, Flucht nach Ägypten von Giacinto Diana, Studienköpfe von Lanfranco, weitere Bilder von Mura, del Pò, Solimena, Giordano u. a., vorzügliche Stilleben des 17. und 18. Jh. (Ascione, Ruoppolo, Recco).
Vom Museo Correale kann man über die »Strada bassa« (Via Califano — Via Rota — Corso Crawford — Via Cappuccini) zwischen prächtigen Villen und Parks des 18. und 19. Jh. nach S. AGNELLO gelangen. Die gleichnamige Kirche an der Hauptstraße (Piazza S. Agnello) hat Decken-und Altarbilder von Gius. Castellano, Gius. Mancinelli und Giacomo di Castro; daneben die hübsche Stuckfassade der Confraternità del Sacramento.
Die Hauptkirche des östlich angrenzenden Ortes PIANO ist S. Michele (Via S. Michele); angebl. anstelle eines antiken Tempels im 16. Jh. errichtet, mehrfach verändert und restaur., eine Pfeilerbasilika mit Querschiff und Vierungskuppel. In der reich vergoldeten Holzdecke Bilder von Girolamo Imparato (1587), Kuppelfresko von Francesco Saraceni (1722); Altarbilder von Andrea da Salerno (zugeschrieben, 2. Kapelle rechts), Marco Pino (1587, rechte Chorkapelle), Fabrizio Santafede (linke Chorkapelle), Ippolito Borghese (2. Kapelle links), Solimena (Querschiff rechts).
In der gleichen Straße die Chiesa della Misericordia, ein reich dekorierter Kuppelzentralbau von 1759, mit exzellent erhaltenem Majolika-Backstein-Fußboden; Altarbild von Gius. Bonito. Im Zugehörigen Augustinerinnenkloster ein hübscher Kreuzgang des 18. Jh. Auf dem Dach der Kirche ein mit Holzgittern abgeschirmtes Belvedere für die Nonnen. — Die Pfarrkirche des oberen Ortsteils La Trinità besitzt 2 Bilder von Leandro Bassano (Hl. Andreas und Auferstehung, 1610).
META, am östlichen Rand der Ebene, hat in den tiefer gelegenen Vierteln am Strand von Alimuri die hübschesten Straßenbilder mit vielen intakten Häusern und Palästen des 16.-18. Jh. bewahrt. — An der Hauptstraße oben steht über einem aussichtsreichen Vorplatz die Kirche der Madonna del Lauro, nach der Überlieferung anstelle eines Minerva-Tempels im 18. Jh. erbaut. 3schiffige Pfeilerbasilika mit Querschiff und flacher Vierungskuppel; neben der klassizist. Fassade ein hochragender Campanile. Am linken Querschiffsaltar ein Rosenkranzbild des 16. Jh.; im Chor Holzfiguren des 18. Jh. (Schutzengel, hl. Michael und auferstandener Christus); rechts vom Chor die Kapelle der Madonna del Lauro, mit prächtigen Marmorintarsien, in den Kuppelzwickeln Evangelisten von Bonelli oder Bonito (1785).
Das am westl. Ende der Halbinsel gelegene Städtchen wird zuerst im 10. Jh. erwähnt als Massa Publica, später Lubrense (vom lat. delubrum = Heiligtum — entweder der Minerva oder der Sirenen). Seine Geschichte ist gekennzeichnet durch wechselvolle Kämpfe um die Selbständigkeit gegenüber Sorrent. Der heutige Ort entstand erst zu Anfang des 16. Jh.; die mittelalterl. Stadt auf dem Hügel
von Annunziata, die vorübergehend Königin Johanna II. von Anjou als Wohnsitz diente, wurde im 14. und 15. Jh. mehrfach zerstört, danach verlassen und erst später wieder besiedelt.
An der Piazza Vescovado steht der Palazzo Vescovile, mit eleganter Stuckfassade des 18. Jh. Daneben die Kathedrale S. Maria delle Grazie von 1512, ca. 1760 erneuert; Hochaltarbild von Andrea da Salerno.
An der Marina liegt die Kirche S. Maria della Lobra (urspr. di Lubra), 1528 anstelle eines angebl. frühchristlichen Vorgängerbaus errichtet; Zu ihr gehört ein Franziskanerkloster mit hübschem kleinen Kreuzgang.
Südlich von Massa, rechts oberhalb der Fahrstraße nach Termini, die Frazione S. Maria; in der Kirche S. Maria della Misericordia, von 1613, eine Madonnenstatuette des 14. Jh. und ein dem Domenico Gargiulo zugeschriebenes Altarbild. — Ein Fußweg führt weiter nach Annunziata, dem ältesten Zentrum von Massa. Der mächtige Rundturm ist ein Überrest eines 1389 von dem Gouverneur Pietro Acciapaccia erbauten Kastells. Die SS. Annunziata, ehem. Kathedrale, wurde 1465 von Ferrante I. zerstört, gegen Ende des 17. Jh. wiederaufgebaut und im 18. Jh. üppig ausgestattet; daneben ein Konvent mit weitläufigen Terrassen, Gärten und Belvederi, heute alles verlassen und neuerlich im Verfall. Der Blick auf das gegenüberliegende Capri hat etwas Märchenhaftes.
Den Ruhm dieser einzigartigen Insel zu verkünden, ist nicht die Aufgabe unseres Textes; wir müssen uns damit begnügen, den Besucher, den hier ganz andere Eindrücke gefangennehmen, auf ihre wichtigsten Kunstdenkmäler hinzuweisen. Wer sich für Capris Natur- und Geistesgeschichte interessiert, wird bald einer literarischen Tradition begegnen, die durch Namen wie Platen und Byron, Paul Heyse und Gregorovius, Norman Douglas, Edwin Cerio und Werner Helwig gekennzeichnet ist.
Der latein. Name der Insel, Caprea (Strabo) oder Capreae (Varro), ist eher vom griech. kapros (= Wildschwein) als vom latein. capra (= Ziege) herzuleiten; dafür hat das griech. tragarion (= Ziegenstall) der Punta Tragara ihren Namen gegeben. Die ältesten Spuren des Menschen auf Capri — das damals mit dem Festland der Halbinsel von Sorrent zusammenhing — stammen aus der Altsteinzeit (Hauptfunde in der Grotta dei Felci westlich oberhalb der Marina Piccola). Der erste Sammler derartiger Altertümer auf Capri war der röm. Kaiser Augustus: Seine Inselvilla enthielt statt der üblichen Kunstgalerie eine Art paläontologisches Museum mit Steinwaffen und Knochen vorzeitlicher Tiere, »quae dicuntur gigantum ossa et arma heroum« (Sueton).
Aus der Zeit der griech. Kolonisation, deren Datum unsicher bleibt (die bisher gemachten Gräberfunde gehen nicht vor das 4. Jh. v. Chr. zurück), haben sich nur geringe
monumentale Überreste erhalten. Es handelt sich einmal um Teile der Akropolismauer des Ortes Capri (zu sehen von der Aussichtsterrasse der Bergstation der Funicolare, unter den rechter Hand angrenzenden Häusern), zum andern um die sog. Scala fenicia, die mit über 500 Stufen von der Marina Grande nach Anacapri hinaufführt und bis zum Bau der Fahrstraße (1877) die einzige Verbindung dieses hoch über dem Meer gelegenen Fischerdörfchens zum Hafen darstellte. Die Partie oberhalb der Straße, heute nur noch mühsam begehbar, ist aus dem Felsen gehauen und zeigt Verwandtschaft mit altgriech. Anlagen auf Inseln der Ägäis. An ihrem Ende, beim Castello di Barbarossa (s. S. 586), erkennt man die Reste der »Porta della Differenzia«, eines mittelalterl. Stadttors mit Zugbrücke, das die Gebiete der beiden Inselgemeinden voneinander schied.
Zu welthistorischer Bedeutung stieg Capri in der Anfangszeit des röm. Imperiums auf. Als erster geriet Caesar Octavian, der spätere Augustus, in den Zauberbann der Insel: Auf der Rückkehr vom Feldzug gegen Kleopatra (29 v. Chr.) legte sein Schiff in Capri an; Sueton berichtet, eine vertrocknete Steineiche habe damals frisch zu grünen begonnen — glückhaftes Vorzeichen des neuen Lebens, das der künftige Herrscher aus dem alten Stamme der Republik erwecken sollte. Sogleich nach Errichtung des Prinzipats machte Augustus Capri zur kaiserlichen Domäne; der Stadt Neapel
wurde dafür die Insel Ischia zurückerstattet, die während der Sullanischen Kriege selbständig geworden war. Wie oft der Kaiser im Laufe seiner langen Regierungszeit Capri aufgesucht haben mag, ist nicht bekannt; doch besitzen wir Suetons denkwürdige Schilderung seiner letzten hier verbrachten Lebenstage (14 n. Chr.).
Sie beginnt mit der Überfahrt von Pozzuoli: Ein alexandrinisches Handelsschiff begegnet der kaiserlichen Trireme, von seinem Deck her rufen die Kaufleute den Augustus an und wünschen ihm Heil als dem Stifter des Lebens und der Schiffahrt, der Freiheit und des Wohlstandes. Auf Capri verteilt Augustus Geschenke, Togen und Pallien und ordnet an, daß die Römer griechisch, die Griechen lateinisch sich kleiden und sprechen sollten. Er besucht die Spiele in der Palästra, gibt Festmähler und »läßt keine Art von Vergnügen aus«; als Improvisator griech. Verse bringt er die Literaten seiner Umgebung in Verlegenheit und prägt für Capri (oder Anacapri) den Namen »Apragopolis«, die Stadt der Faulenzer. Wenige Tage darauf stirbt der Kaiser auf seinem Landgut bei Nola. Die düsteren Farben, in denen Sueton und Tacitus das Bild seines Nachfolgers Tiberius angelegt haben, sind von der neueren Geschichtsforschung etwas aufgehellt worden, und der literarisch unbelastete Tourist unserer Tage begegnet wohl nirgends mehr dem schauerlichen Mythos von »Timberio«, der für die Reisenden des 19. Jh. den Hintergrund des Inselerlebnisses bildete. Tatsache bleibt, daß eines der blutigsten Dezennien der röm. Kaisergeschichte von Capri aus dirigiert worden ist. Auf der Flucht vor Verschwörung, Umsturz und mörderischen Intrigen verließ Tiberius i. J. 27 n. Chr. seinen Palast auf dem röm. Palatin und zog sich auf das unzugängliche Eiland zurück; doch behielt er die Zügel des von Zerfall bedrohten Imperiums fest in der Hand, durch Kuriere und einen optischen Telegraphen mit Rom und dem Flottenstützpunkt Misenum verbunden. Der Tod ereilte den Kaiser auf einem seiner seltenen Ausflüge an die kampanische Festlandsküste; da das stürmische Meer die Rückfahrt nach Capri unmöglich machte, starb Tiberius, 78jährig, in der Villa des Lucullus am Cap Miseno (37 n. Chr.).
Von da an sank Capri, 10 Jahre lang Mittelpunkt der Welt, in einen Zustand relativer Bedeutungslosigkeit zurück. Nach dem Ende des Römerreiches war die Insel den wechselnden Herren Neapels untertan; ihre exponierte Lage vor der Küste des Golfes machte sie zur leichten Beute der sarazenischen Seeräuber, die v. a. im 16. Jh. verheerende Raubzüge unternahmen (1535 Barbarossa Kaireddin, 1553 Dragut). Zwischen 1806 und 1815 kämpften Franzosen und Engländer um den Besitz des strategisch wichtigen Punktes; mit dem Sieg der Bourbonischen Restauration fiel Capri an das »regno« zurück und gehört seitdem zur Provinz Neapel.
Schon um die Mitte des 18. Jh. war das Interesse der Archäologen an den Überresten der Kaiserzeit erwacht. Die Entdeckung der »Blauen Grotte« durch August Kopisch (1826) leitete das Zeitalter
des Tourismus ein, der das Gesicht der Insel langsam, aber stetig veränderte und ihrer Bevölkerung, bis dahin eine der ärmsten Italiens, zu materiellem Wohlstand verhalf.
Die wichtigsten Monumente Capris sind die Ruinen der Tiberius-Villen, voran die der Villa Jovis. Daß der Kaiser hier eine ganze Serie von Wohn-und Lusthäusern errichten ließ, die nach Lage und Bauweise den im Laufe des Jahres wechselnden klimatischen Bedingungen Rechnung trugen, entspricht röm. Gepflogenheit. Tacitus spricht von 12 Villen, welche die Namen der 12 Hauptgötter des Olymps getragen hätten. Diese viell. mythisch aufgerundete Zahl, unter der auch bescheidene Landhäuser mitlaufen mögen, hat die Phantasie der Lokalforscher mächtig angefeuert, doch sind nicht mehr als 3 Baukomplexe heute noch erkennbar; ein 4. Ruinenbezirk am N-Hang des Castiglione, südwestlich des Ortes Capri, wurde 1786-90 von dem österreichischen Gesandtschaftssekretär Hadrawa ergraben und vollständig zerstört; von dort stammt der große Marmorfußboden von Capodimonte (s. S. 422). Spuren alter Konstruktionen finden sich ferner auf dem Monte Tuoro über der Punta Tragara, an der Unghia Marina unterhalb der Certosa sowie bei Tiberino und Pozzo westlich und nordwestlich von Anacapri.
Die Villa Jovis (Tafel S. 577) trägt als Hauptwohnsitz des Kaisers den Namen Jupiters. Sie liegt in schwindelerregender Position auf der O-Spitze der Insel, am Rande eines 300 m tiefen Steilabsturzes — ein letzter, äußerster Rückzugsort, der seinem Bewohner gleichwohl das Gefühl vermitteln konnte, im Zentrum des Erdkreises zu stehen.
Nachdem die gesamte Ausstattung früheren Raubgrabungen zum Opfer gefallen ist, bleibt dem heutigen Besucher der Anblick imponierender Mauerreste (1932-35 vollständig freigelegt), deren Ergänzung zum Bilde des kaiserlichen Palastes nur mit Hilfe eines ortskundigen Spezialisten gelingen wird. — Der Grundriß zeigt eine bemerkenswert regelmäßige, rechtwinklig geordnete Anlage, die mit gewaltigem Aufwand an Hilfskonstruktionen (Planierung, Terrassierung, Stützgewölbe) dem felsigen Boden abgewonnen wurde. Ein etwa quadratischer Innenhof enthält ein
System von aus dem Felsen gehauenen Regenwasserzisternen, die das schwierige Problem der Wasserversorgung des Platzes lösen. Ringsum zogen sich 4 Gebäudeflügel. Der Capri zugekehrte W-Trakt enthielt im Untergeschoß gewölbte Vorratskammern; darüber erhoben sich 2 oder 3 balkengedeckte Stockwerke mit durchgehenden Korridoren und kleinen Kammern, offenbar Wohnräume für Gefolge und Personal. An der S-Seite des Zisternenhofes erkennt man eine Reihe von 5 Rechtecksälen, der 4. mit 2 Apsiden: Es handelt sich um die Thermenanlage der Villa.
Der O-Flügel enthielt offenbar die Prunk- und Staatsräume: eine symmetrisch durchgebildete Gruppe von Sälen und Kabinetten, die in einer gegen den Klippenrand vorspringenden halbrunden Tribuna ausmünden. Der N-Flü-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Sorrent. Museo Correale, Fragment einer Kanzelbrüstung (12. Jh.)
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Capri. Villa Jovis, Luftaufnahme
gel dürfte die Privatgemächer des Kaisers beherbergt haben; sie kommunizierten mit einer hochgelegenen Felsenterrasse, auf der heute die Cappella der Madonna del Soccorso steht. — An der nördl. Kante des Felsens zieht sich ein 92 m messender Wandelgang (ambulatio) entlang, der die phantastischste Aussicht über den Golf gewährt. Hier mag Tiberius, „speculabundus ex altissima rupe“ (Tacitus), der Signale und Boten geharrt haben, die ihm den Fortgang der Kämpfe in Rom und im Reich zu melden hatten. Südlich angrenzend einige Sommerwohnräume mit Triclinium und eigener Zisterne. Die Signalstation, später als Leuchtturm (faro) benutzt und von dem Eremiten der Kapelle unterhalten, liegt südlich der Villa am Rand des Abgrunds; ihre Licht- und Rauchzeichen wurden von ähnlichen Türmen an der Punta Campanella (Kap Minerva) und in Misenum aufgenommen. Auf dem Wege zum Faro wird der »Salto del Tiberio« gezeigt, d. h. die Stelle, wo die Opfer kaiserlicher Grausamkeit ins Meer hinabgestoßen worden seien; doch besteht kein historischer Anlaß, den fabelhaften Natureindruck auf solche Weise zu humanisieren.
Die 1937 ausgegrabene Villa von Damecuta liegt am NW-Rand der Hochebene von Anacapri, oberhalb der Blauen Grotte. Ihr Bestand ist nicht nur durch alte Raubgrabungen, sondern auch durch die Festungsbauten der Engländer und der Bourbonen dezimiert. Die-«Hauptgebäude der Villa, durch ihre Nordlage als Sommersitz gekennzeichnet, ziehen sich wieder an der Kante des Steilhanges entlang.
Am westl. Ende befand sich der große Palast mit einer zum Meer vorspringenden Halbrotunde auf gemauerten Substruktionen. Der anschließende Wandelgang, etwas kürzer als in der Villa Jovis, war hier von einer schattenspendenden Säulenpergola überdeckt; daneben lief eine 2. Loggia mit Ruhesitzen in Nischen (Exedren). Am O-Ende des Ganges, wo sich heute ein dicker Sarazenen-Turm erhebt, lagen offenbar die Privatgemächer des Kaisers. Auf dem landeinwärts anschließenden Gelände finden sich weit verstreute Reste von Retikulatmauerwerk, wohl Spuren der Wirtschafts- und Dienergebäude, und eine geräumige Zisterne.
Die 3. kaiserzeitliche Anlage, von der wenigstens Teile auf uns gekommen sind, ist der Palazzo a Mare, am Ufer westwärts der Marina Grande. Es handelte sich um einen aus-
gedehnten Gebäude- und Gartenkomplex, der von dem röm. Hafen (seine Reste noch sichtbar an der Punta Vivara westlich des Strandes von Marina Grande) bis zu den Bagni di Tiberio (s. u.) reichte. Die Baulichkeiten selbst scheinen eher bescheiden gewesen zu sein; dies und die Position der Villa lassen vermuten, daß wir es hier mit einer Gründung des Augustus zu tun haben, der wohl gegen die Sommerhitze, nicht aber (wie Tiberius) gegen Kontakt mit dem Volk allergisch war. Die Ruinen wurden 1790/91 von Hadrawa gründlich ausgenommen, 1806-15 zur Festung umgewandelt und später von Villen und Hotels überbaut; Spuren von Substruktionen, Zisternen und dgl. finden sich hauptsächlich in den Grundstücken des Hotels Bristol, der Villen Williams und Stepanow und im Gelände des Sportplatzes (Campo sportivo).
Ein großartiges Bild bieten die Überreste der wohl tatsächlich erst von Tiberius angelegten Bagni di Tiberio (heute Badeanstalt) mit einer riesigen Futtermauer, einem halbkreisförmig einspringenden Nymphäum, Fischbecken, Spuren von Wohngebäuden und einem Bootshafen.
Zur Villenarchitektur des röm. Capri gehören die Grotten, natürliche Aushöhlungen des Kalkfelsens, die zu Nymphäen (Nymphen- und Quellheiligtümern) ausgebaut wurden. Die Blaue Grotte scheint das Nymphäum Maritimum der Damecuta-Villa gebildet zu haben. Vermutl. ist der jetzige Eingang damals hergestellt bzw. erweitert worden; an der Rückwand des Inneren findet sich ein gemauerter Bootsanlegeplatz, dahinter eine ausgehauene Öffnung, die zu einem vielfach gewundenen Gang führt. Es handelt sich kaum um einen Verbindungsweg an die Oberwelt, sondern wohl eher um einen Versuch, im Innern des Berges eine Wasserader aufzufinden. Ob in antiker Zeit ein Landzugang zur Grotte bestand, läßt sich nicht mehr ausmachen; wahrscheinl. ist aber, daß ein neben der Grotte gelegener Landeplatz den Verkehr nach Damecuta vermittelte; der Aufstieg führt an den Resten einer kleineren röm. Villa vorbei, die unmittelbar über der Grotte liegt (Villa di Gradola oder delle Gradelle).
Ebenfalls nur von See her erreichbar ist die einige Meter über dem Wasserspiegel liegende Grotta dell’Arsenale (zwischen Marina Piccola und Punta Tragara). Den gewaltigen
Rundraum umzieht eine gemauerte Sockelbank; darüber sind Nischen ausgehauen; 1879 wurden Reste eines Marmorfußbodens und der Stuck- und Mosaikverkleidung des Felsengewölbes gefunden.
Die schwer zugängliche Grotta del Castiglione in der S-Flanke des gleichnamigen Berges südwestlich des Ortes Capri, in der man ähnliche Spuren entdeckt hat, gehörte zu der oben erwähnten Castiglione-Villa.
Beträchtliche architektonische Überreste enthält die Grotta di Matromania im wilden SO-Teil der Insel, unterhalb des »Arco Naturale«. Wie weit der auf einen Kybele-Kult hinweisende Name (Mater Magna) zu Recht besteht, ist nicht bekannt; jedenfalls zeigt das erhaltene Mauerwerk die typische Form eines Nymphäums: ein rechteckiger Apsidensaal, im Hintergrund halbkreisförmige Stufenringe, die zu einer Quellnische aufsteigen; auch hier Spuren von Stuck- und Mosaikdekoration.
Die wichtigsten Kirchen der Insel führen wir getrennt nach den beiden Städten auf.
S. Anna liegt versteckt inmitten der Altstadt an der Via S. Maria delle Grazie (dies der urspr. Titel der Kirche), einer nördl. Quergasse der Via Le Botteghe. Vor der anspruchslosen Fassade, mit lustig geschweiftem Giebelkontur, öffnet sich ein kleiner Vorplatz mit Freisäulen, die ehemals eine Pergola trugen. — Das Innere ist eine Pseudobasilika (3 Schiffe, Mittelschiff erhöht, aber nicht durch eigene Fenster beleuchtet) im Miniaturformat, von primitiver und windschiefer Konstruktion. Das 1. Stützenpaar besteht aus plumpen Zwillingssäulen, das 2. aus antiken Säulenstümpfen mit schönen Spolienkapitellen. Die Arkaden sind stark gestelzt; sie tragen im Mittelschiff eine Tonne, in den Seitenschiffen gratige Kreuzgewölbe; 3 Halbrundapsiden (die linke umgebaut) bilden das Presbyterium. Abgesehen von der barock stuckierten, wahrscheinl. sogar ganz erneuerten Tonnenwölbung (urspr. auch hier Kreuzgewölbe?) ist die Struktur rein mittelalterlich und läßt sich, mangels dokumentarischer Überlieferung, etwa ins 11. oder 12. Jh. datieren. Freskenreste vom Ende des 14. Jh.
Certosa di S. Giacomo
Das große Kartäuserkloster wurde zwischen 1371 und 1374 gegründet. Der sanft nach S abfallende Sattel zwischen Castiglione und Monte Taoro, der das Kloster trägt, lag damals einsam vor den Mauern des Ortes: Der Blick ist vom Golf von Neapel abgewandt und geht auf die Weite des offenen Meeres. Der Stifter
Giacomo Arcucci, Sekretär der Königin Johanna I., entstammte der vornehmsten und reichsten Familie von Capri. Anlaß der Stiftung war die Geburt seines ersten Sohnes Jannuccio. Beim Umsturz von 1381, der Johanna den Thron und später das Leben kostete, wurde auch Arcucci enteignet, gefangengesetzt und zum Tode verurteilt; nach seiner Begnadigung trat er als mittelloser Pilger in das von ihm gegründete Kloster ein; sein Sohn Jannuccio wurde von den Mönchen freigekauft. In den folgenden Jahrhunderten waren die Kartäuser die mächtigsten Feudalherren der Insel. 1553 überstand das Kloster die Brandschatzung durch sarazenische Seeräuber unter Dragut; 10 Jahre später wurden die beschädigten Gebäude wiederhergestellt und nach S erweitert. Mit der Säkularisation von 1808 begann der Verfall, dem einige neuere Restaurierungen nur vorläufig Einhalt geboten haben.
Ein Blick über den weit auseinandergezogenen Baukomplex von der Via della Certosa zeigt im welligen Auf und Ab der »volte estradossate« die frühe Anwendung der capresischen Wölbtechnik in all ihrem Formenreichtum. Einen barocken Akzent setzt der 4kantige, mit einem durchbrochenen Volutenaufsatz bekrönte Uhrturm. Durchaus singulär innerhalb der Kartäuserarchitektur des Trecento ist die Form der Kirche: ein Saalraum mit 3 quadratischen Kreuzgewölben auf Wandvorlagen, aber ohne Kreuzrippengliederung, mit halbrunder, außen polygonal ummantelter Apsis. In der Eingangswand sitzt eine große Fensterrose, darunter das Spitzbogenportal mit Relieffiguren (hll. Bruno und Jakobus) und einem Lünettenfresko des Trecento (Madonna mit den genannten Heiligen, rechts der Stifter mit 2 Söhnen, links 3 Frauen, angeführt von Johanna I.). In der Apsis ein 3bahniges Maßwerkfenster; die Seitenwände haben in jedem Joch ein schmales und hohes Lanzettfenster. Einige Reste barocker Stuckierung und Freskoausmalung tun dem Charakter des Raumes keinen Abbruch. — Rechts neben der Kirche der Kreuzgang des Trecento-Baues (neuerdings restaur.), mit 4-5 rundbogigen Kreuzgratgewölben auf Spoliensäulen mit teils antiken, teils got. Kapitellen. — Der südlich angrenzende Große Kreuzgang mit 12 x 13 dorischen Pfeilerarkaden stammt aus der Erweiterung von 1563; ringsum die ganz verfallenen Mönchszellen. — An der W-Seite lag die gleichfalls im 17. Jh. erbaute, luxuriös und weiträumig angelegte Wohnung des Priors. Eine Gittertür gewährt Zugang zu einem Gärtchen mit verwildertem Pflanzenwuchs;
von dem um einige Stufen erhöhten Belvedere bietet sich ein unerwarteter Ausblick auf die wild zerklüftete S-Küste der Insel.
S. Costanzo (am Anfang der Fahrstraße von Marina Grande nach Capri, neben der Abzweigung der »Scala Fenicia«)
Ihrer Gründungsgeschichte nach wohl Capris älteste Kirche. Die Reliquien des Titelheiligen‚ eines Patriarchen von Konstantinopel, wurden wahrscheinl. Z. Z. des Bilderstreites nach Capri verbracht (die Legende berichtet von der wunderbaren Seefahrt und Landung des in einem Faß verschlossenen Leichnams); seit dem 9. Jh. ist sein Kult auf der Insel bezeugt.
Die heute stehende Kirche ist das Produkt zweier deutlich getrennter Perioden. Der 1. Bauabschnitt läßt sich stilistisch etwa ins 12., frühestens ins 11. Jh. datieren. Zu ihm gehören die charakteristischsten Partien des Außenbaus: der schlanke, von 8 steilen Rundbogenfenstern durchbrochene Kuppeltambour und der Campanile, deren kegel- und bienenkorbförmige Hauben wie exotische Gewächse aus dem Laub der umgebenden Weingärten hervorschauen. Ihnen entspricht im Inneren ein Zentralkuppelraum vom italobyzantin. Typus der »Cattolica« von Stilo (Kalabrien). Das System der Gewölbe — hoch gestelzte Pendentifkuppel im Zentrum, Tonnen in den Kreuzarmen, Kreuzgratgewölbe in den Ecken — ruht auf 12 Spoliensäulen (vermutl. aus den Ruinen des nahegelegenen »Palazzo a Mare«); die 4 mittleren wurden in den 1750er Jahren ausgetauscht; die alten Stücke, Prachtexemplare von »giallo antico«‚ wanderten nach Caserta, wo sie beim Bau der Palastkapelle Verwendung fanden. Die Apsis im rechten Querarm und ein vermauerter Eingangsportikus an der gegenüberliegenden Seite lassen die urspr. O-W-Ausrichtung des Baues erkennen. — Gegen 1330 wurde die Kirche durch Anbauten erweitert und dabei um 90° umorientiert: An der N-Wand entstand ein 2geschossiger Eingangstrakt (später mehrfach verändert), im S setzte man ein großes quadratisches Presbyterium mit weitgespanntem Kreuzrippengewölbe an. Spätere Ein-und Umbauten wurden bei einer gründlichen Restaurierung 1932-35 soweit als tunlich beseitigt.
S. Michele (urspr. S. Croce), am Weg nach Villa Jovis (Via Tiberio 3), wurde gegen Ende des 14. Jh. gegründet. Der Michaels-Titel stammt von einer 1802 geschlossenen Kapelle auf dem Gipfel des Monte S. Michele, in den Ruinen einer röm. Zisterne (unzugänglich). Der bescheidene Bau
besteht aus 3 Gewölbeeinheiten. Auf die offene Vorhalle mit Tonne folgen im Inneren ein Kreuzgratgewölbe und eine Hängekuppel. Der Eingang zeigt noch ein got. Profil, im Inneren Spuren von Restaurierungen i aus dem 16. Jh.
S. Salvatore (auch S. Teresa; oberhalb der Via Roma)
Die Kirche wurde 1678-85 von Dionisio Lazzari errichtet. Die schmucklose Vorhallenfassade erhebt sich über einer doppelläufigen Freitreppenanlage; das Innere ist ein einfacher tonnengewölbter Saalraum mit Seitenkapellen.
Gründerin der Kirche und des zugehörigen Theresianerinnenkonvents war die Neapolitanerin Prudentia Pisa (1621-99), die in frühem Kindesalter nach Capri kam und als Suor Serafina di Dio dem religiösen Leben der Insel eine dramatische Note verlieh. Schon als Kind von Visionen und Erlebnissen nach dem Vorbild der hl. Therese von Avila heimgesucht, entfaltete Suor Serafina eine heftige Aktivität als Klostergründerin, die sie in Gegensatz zum Bischof, zu den Kartäusern und auch zu den weltlichen Autoritäten brachte. Der von beiden Seiten mit den bedenklichsten Mitteln geführte Kampf endete für Serafina mit einer offiziellen Anklage wegen quietistischer Ketzerei und zweieinhalbjähriger Zellenhaft, während welcher auch ihre Nonnen in Aufruhr gerieten und die Klosterzucht sich in einer Kette von Skandalen auflöste. Ein posthum in Gang gesetzter und von den reuigen Capresen mit enormen Kosten betriebener Kanonisationsprozeß endete nach über 100jährigen Verhandlungen ohne Ergebnis.
S. Stefano
Die Kathedrale von Capri bleibt als südl. Kulisse der Piazza auch flüchtigen Inselbesuchern im Gedächtnis.
Der unregelmäßige Grundriß des Platzes, auf dem alles Leben des Städtchens zusammenströmt, ist wohl schon im frühen Mittelalter fixiert worden. An der Stelle des Municipio scheint vordem der Bischofspalast gestanden zu haben; der Vorgänger des quadratischen Uhrturms war vermutl. der (nach mittelalterl. Gewohnheit frei stehende) Campanile des Domes.
Capri war bis 1818 Bischofssitz; heute ist S. Stefano Pfarrkirche. Die Vorgeschichte des Domes ist in undurchdringliches Dunkel gehüllt; man weiß nur, daß die alte (gotische?) Kathedrale im Laufe des 17. Jh. so baufällig geworden war, daß man sich 1683 zu einer Erneuerung a fundamentis entschloß. Die Pläne zeichnete F. A. Picchiatti aus Neapel, doch stellt sich die Baugeschichte als ein Triumph capresischer Folklore über den konventionellen Barock des vizeköniglichen Architekten dar. Während Picchiatti seine Aufenthalte auf der Insel hauptsächlich dazu benutzte, die antiken Ruinen zu plündern und Baumaterial nach Neapel zu schicken, blieb die Ausführung der Kathedrale dem Capomaestro Desi-
derio Marziale überlassen, der aus Amalfi zugewandert war und in Capri zum Begründer einer über 200jährigen Dynastie lokaler Baumeister und Handwerker wurde (»la razza dei Marzianelli«).
Marziales Werk also ist die pittoreske Außenansicht des Baues, dessen Kuppeln und Tonnengewölbe, Strebepfeiler und -bögen ein ästhetisch wie technisch gleichermaßen reizvolles Schauspiel bieten (man beachte die kunstvolle Wasserführung von den Wölbeflächen über offene Rillen und Wasserspeier bis in die Abflußrohre der Seitenwand). Die Kirche liegt um einige Meter über dem Platzniveau; über 12 Stufen erreicht man die Eingangsfassade, eine große weiß verputzte Schauwand von basilikalem Typus, mit 2 Pilasterordnungen, Voluten und geschweiftem Giebelkontur. — Das Innere folgt einem Standardtypus neapolitan. Barockkirchen (vgl. S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone von Francesco Grimaldi): 3schiffige Pfeilerbasilika mit Vierungskuppel, Kuppeln auch über den Seitenschiffen, Pilastergliederung mit verkröpftem Gebälk und Gurten an der Tonnenwölbung; der Stuckdekor zeigt die Manier der Fanzago-Schule.
Der Marmorfußboden zu Füßen des schön intarsierten Hauptaltars wurde 1759 aus Fundstücken der Villa Jovis zusammengesetzt; der Fußboden der Cappella del Rosario stammt aus der Villa di Tragara. In der Kapelle links vom Hochaltar Grabmäler der Giacomo und Vincenzo Arcucci, von M. Naccherino, aus der Certosa.
S. Maria di Cettella heißt, nach einem in der Umgebung wachsenden Gewürzkraut, die kleine Einsiedlerkirche unter dem Gipfel des Monte Solaro, am Rand der östl. Steilwand des Berges. Es handelt sich um eine Anlage vom Ende des 14. Jh. Die Kirche hat 22 kreuzgewölbte Joche; rechts daneben die überkuppelte Sakristei, dahinter ein tonnengewölbter Wohnraum. Die Gewölbefelder bilden außen eine zusammenhängende Terrasse zum Sammeln des Regenwassers; auf einer Ecke sitzt ein durchbrochener Campanile. Geöffnet nur noch zu den Festen der Gnadenmadonna, 15. August und 7./8. September.
S. Michele (Piazza S. Nicola)
Die Kirche, berühmt wegen des Majolikafußbodens, ist auch als architektonisches Kunstwerk von hohem Interesse.
Aus Inschriften geht hervor, daß die Kirche 1719 fertig war oder jedenfalls der Vollendung entgegenging; ihr Erbauer D. A. Vaccaro erweist sich hier wie in seinem neapolitan. Hauptwerk, der Concezione a Monte Calvario, als Architekt von genialem Ein-
fallsreichtum, der manche Errungenschaft der späteren Rokokobaukunst Oberitaliens (Vittone) vorwegnahm.
Die Fassade entwickelt sich über eckig gebrochener Grundlinie mit vortretendem Mittelteil und zurückgenommenen Flanken. Das Hauptgeschoß hat eine frei behandelte toskanische Halbsäulengliederung, darüber liegt eine hohe Attika. Energische Verkröpfungen betonen die Vertikalen; in der Mittelachse ist das Gebälk halbrund aufgebogen, dementsprechend die Attika hier durch eine giebelbekrönte Fenster-Ädikula unterbrochen. — Mit dem kräftigen, aber groben Effekt dieser Schauwand kontrastiert das fein und reich gegliederte Innere. Der oktogonale Hauptraum ist in der Längsachse zwischen 2 querrechteckige Räume mit ausgerundeten Ecken eingespannt (Vestibül und Presbyterium); 2 kurze seitliche Querarme enden in abgeplatteten Halbrundapsiden. Die 4 Diagonalseiten des Achtecks öffnen sich zu Nebenkapellen von querelliptischer Grundgestalt. Unverkennbar ist der Typus von Fanzagos S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone abgeleitet, doch ist Vaccaro im Aufriß ganz eigene Wege gegangen. Hauptträger der Gliederung sind 8 kannelierte korinthische Halbsäulen; sie stehen aber nicht in den Winkeln des Oktogons, sondern flankieren paarweise die diagonal gerichteten Wandabschnitte. Auf diese Art erhält das (im Grundriß ganz reguläre) Achteck einen deutlich ausgeprägten Rhythmus, der sich durch Verkröpfungen und Gurtbänder bis in die Gewölbezone hinaufzieht. Die Kuppelkalotte beginnt unmittelbar über dem Hauptgebälk und wird von rhythmisch wechselnden Stichkappen angeschnitten. Das System der Halbsäulenordnung ist streng und sauber durchgeführt, der Kannelierung entspricht das reiche Lineament der Gebälkprofile; dazu tritt geometrisches Stuckrahmenwerk mit einzelnen plastischen Motiven der Fanzago-Schule (»rosoni«, Engelsköpfe, Kartuschen, Muscheln und Blattwerk).
Eine echte Sehenswürdigkeit ist das Paradiso Terrestre, das große Majolikabild des Fußbodens (Bestrafung Adams und Evas durch den Erzengel Michael). Die Idee könnte wohl auf Vaccaro zurückgehen, der an der Gestaltung des Chiostro delle Majoliche von S. Chiara in Neapel bestimmenden Anteil hatte und auch in seinem Palazzo Spinelli di Tarsia mit farbig glasierter Majolika gearbeitet hat. Doch ist der Boden erst 1761 datiert; ausführender Meister war der aus den Abruzzen gebürtige Leonardo Chiaiese, der hier ein (sonst nicht bekanntes) Bild Solimenas
als Vorlage benutzt haben soll. Die bunte Menagerie, verteilt über eine baum- und wasserreiche Gegend von der Art antiker Nil-Landschaften, muß jeden Tierfreund entzücken; die Vertreibung des sündigen Menschenpaares spielt sich mehr als beiläufige Episode im vorderen Drittel des Oktogons ab. — Auf dem Hochaltar, mit reichen Marmorintarsien, ein hl. Michael von Malinconico; weitere Altarbilder von Giacomo del Pò (Geburt Christi und Gethsemane) und Paolo de Matteis.
S. Sofia (Piazza Armando Diaz), die Pfarrkirche von Anacapri, wurde als 3schiffige Basilika 1510 begonnen und ohne einheitlichen Plan bis ins 19. Jh. weitergebaut. Um die steil profilierte Vierungskuppel, die den Ort weithin überragt, gruppieren sich Nebenkuppeln verschiedener Bauart in lieblichem Durcheinander. Aus der Mitte des Settecento stammt die Eingangsfassade, mit 2 Pilasterordnungen und sparsamem Stuckdekor; die räumlich fein bewegte Mittelgruppe verbindet ein Kompositionsschema Sanfelices (Nunziatella) mit borrominesken Kurvaturen.
Unter Capris mittelalterl. und neueren Profanbauten sind nur wenige von kunsthistorischem Interesse, doch liegt ein besonderer Reiz in der örtlichen Bauweise, die als Inselstil (E. Peterich), mit charakteristischen Varianten, auch auf Ischia, Procida und an einigen isolierten Stellen der Pestlandküste vorkommt. Ihre »orientalischen« Aspekte erklären sich nicht aus einer direkten Berührung mit den Arabern (die in der Geschichte der Insel nur sehr sporadisch auftauchen, und gewiß nicht als Baumeister), sondern aus den gemeinsamen natürlich-historischen Bedingungen vieler südmittelmeerischer Küstenstriche. Dazu zählt der auf Capri besonders fühlbare Wassermangel: So beginnt jeder Bau mit der Anlage einer unterirdischen Zisterne, die das auf den Dachflächen sich sammelnde Regenwasser aufnehmen soll. Die beim Ausheben der Grube anfallenden Steine finden ihre Verwendung als Baumaterial. Das fertige Mauerwerk wird zum Schutz gegen die Sonnenhitze mit einem blendend weißen Kalkputz überzogen; alljährlich erneuert, schleift er Ecken und Kanten ab und verleiht dem Außenbau seine charakteristische Modellierung. Auch Bauholz ist Mangelware: So wird anstelle durchgehender Decken- und Dachkonstruktionen über jedem Raum ein Gewölbe errichtet, das außen bucklig hervortritt (volte estradossate); Stockwerke werden, der meist gegebenen Hanglage entsprechend, um eine Terrasse zurückgesetzt und über Außentreppen zugänglich gemacht. Die gebräuchlichsten Wölbformen sind die
Mulde (a padiglione oder a gàveta), die Tonne (a botte) oder das Kreuzgewölbe (a crociera); der Wölbungsquerschnitt ist leicht gedrückt (a sesto ingannato), so daß, nach einer alten Handwerkerregel, die lichte Höhe des Innenraums seinen Durchmesser nicht übersteigt. Die Abdichtung der Außenhaut mit Hilfe eines wasserfesten Estrichs (astrico battuto) aus in Kalkmilch gestampfter vulkanischer Schlacke (lapilli) scheint schon von den Römern geübt worden zu sein, wie überhaupt die Existenz röm. Wölbungsbauten auf Capri und an anderen Stellen der Golfküste eine spezifische Voraussetzung des »Inselstils« bildet: Die verlassenen Räumlichkeiten der Kaiservillen boten den Anwohnern bequemen Unterschlupf und regten zur Nachahmung an. Tatsächlich lassen sich die oben aufgezählten Wölbformen durchweg auf röm. Muster zurückführen. Auch die Verwendung von Tongefäßen (mummarelle) als Konstruktionsmaterial deutet auf das ununterbrochene Fortleben antiker (röm.-byzantin.) Baupraktiken. Ihre Kenntnis und Übung sind jetzt am Aussterben; an ihre Stelle tritt die modernistische Nachahmung der überkommenen Formen in Kunststein und Eisenbeton, die teilweise unerträgliche Resultate zeitigt. Relativ wohlerhaltene Bauernhäuser des »Inselstils« findet man am ehesten auf der Hochebene von Anacapri; die städtische Bauweise zeigen in Capri die Gäßchen rings um die Piazza, v. a. in dem Viertel zwischen S. Stefano und Castiglione (in der Via Posterula Häuser des 14. und 15. Jh.); ferner der Häuserkomplex am O-Ende von Marina Grande und, dörflich aufgelockert, das zauberhafte Quartiere delle Boffe in Anacapri, westlich der Piazza Armando Diaz (S. Sofia). Eine anacapresische Spezialität sind die »muri di dispetto«, frei stehende Bruchsteinmauern, die keinen anderen Zweck verfolgen, als dem Nachbarn die Aussicht zu verderben.
Ins 12. Jh. scheint der Kern des Castello di Barbarossa zurückzugeben, dessen Ruine an der N-Flanke des Monte Solaro den alten Zugang nach Anacapri beherrscht (s. S. 573). Barbarossa ist hier nicht unser Stauferkaiser, sondern der türkische Admiral und Seeräuber Kaireddin, der diese Burg auch nicht erbaut, sondern vielmehr zerstört hat (1535); erhalten haben sich, außer Resten von Mauern und Türmen, eine gewölbte Kapelle mit Apsis und Glockenstuhl, darunter eine große Zisterne.
Der Komplex des Palazzo Cerio gegenüber der Kathedrale von Capri, im 18. Jh. bischöfliches Seminar, enthält beachtliche Reste eines Trecento-Palastes, in dem schon Johanna I. von Anjou gewohnt haben
soll. Von außen weist nur noch die dicke Ecksäule an der Piazza auf das hohe Alter des Bauwerks hin. Das hübsche Treppenhaus (Piazzetta Ignazio Cerio 5) führt zu einem hohen Rechtecksaal mit 3 Kreuzgratgewölben auf Wandpfeilern vom Typus der angiovinischen Gotik (rechteckige Kerne flankiert von 3/4-Säulen), mit flach reliefierten Blattkapitellen. Andere kreuzgratgewölbte Säle schließen sich an. Weitere Räume des gleichen Typs (darunter noch ein großer Saal mit 3 Gewölbejochen auf Wandvorlagen) im Haus Nr. 11, links neben dem 3bogigen Portikus an der S-Seite der Piazzetta; das Dach wird hier (wie an der Certosa) durch »volte estradossate« von leicht spitzbogigem Zuschnitt gebildet.
Lo Palazzo (auch Palazzo Inglese, Palazzo Canale; Via Lo Palazzo 24) heißt ein in den Orangengärten unterhalb der Via Roma gelegenes, halb verfallenes Landhaus, das die schlichten Formen des Inselstils mit Ansätzen zu einer symmetrischen Fassadenkomposition verbindet (eine weite, flachbogige Arkade flankiert von 2 schmalen, im Obergeschoß die gleiche Bogenfolge). Es gilt als ein Werk Desiderio Marziales, des Erbauers der Kathedrale. Um die Mitte des 18. Jh. diente es Sir Nathaniel Thorold als Residenz, einem englischen Baronet, der die lange Reihe nordischer Dauergäste auf Capri eröffnet und schon von zeitgenössischen Reisenden um dieses seines Entschlusses willen beneidet wurde. Ferdinand IV. von Bourbon pflegte während gelegentlicher Jagdaufenthalte auf Capri im »Palazzo« Wohnung zu nehmen; in seinem Gefolge befand sich der Antikenkenner und -ausgräber ### Hadrawa, der in einem seiner capresischen Briefe die schöne und bequeme Einrichtung des Gebäudes lobt; 1808 wohnte hier der englische Inselgouverneur Hudson Lowe, der spätere Kerkermeister Napoleons auf St. Helena.
Palazzo Reale
Das größte Bauwerk der neapolitan. Könige, vom Volksmund einfach »la reggia« (das Schloß) genannt, liegt am Fuß eines kahlen Gebirgszugs etwa 30 km nördlich der Hauptstadt. Mit dem Escorial des spanischen Weltherrschers Philipp II. und der Residenz des Sonnenkönigs zu Versailles bildet es die große architektonische Trias des europäischen Absolutismus, der freilich zu jener Zeit schon den Keim des Niedergangs in sich trug.
Karl von Bourbon, seit 1734 König beider Sizilien, war ein Urenkel Ludwigs XIV. Mit dem Degen des Vorfahren hatte er, nach dem Wunsch seiner Mutter Elisabeth Farnese, sich »die schönste Krone Italiens« erobert; ihr den Glanz der französischen zu verleihen, war sein erklärtes Ziel. Demgegenüber verband das Bürgertum des Landes, seit dem Ausgang des Spanischen Erbfolgekrieges zu politischem Selbstbewußtsein erwacht, mit der Idee absoluter Fürstenmacht »die eschatologische Hoffnung auf ein Zeitalter der Gerechtigkeit und Glückseligkeit« (E. Pontieri); die »perfettissima
monarchia«, die nach der Lehre G. B. Vicos auf die heroische Epoche des Feudalismus folgt, sollte nichts anderes sein als die höchste Form des bürgerlichen Staates. Dabei erscheint der Monarch als Erbe des röm. Kaisertums, dessen Rechtsordnung sich zuletzt in den »Constitutiones Siculae« Friedrichs II. verkörpert hatte; das Mittelalter als »finsteres« wurde in diesem Geschichtsbild durch die ausbeuterische Fremdherrschaft der Anjou, der Spanier und Österreicher repräsentiert, die nun durch die Thronbesteigung Karls ihr Ende fand.
Welch hochgespannte Aspirationen sich mit dem Bau des neuen Schlosses verknüpften, zeigt ein dem Mario Gioffredo zugeschriebenes Idealprojekt, das in einer Serie von Zeichnungen überliefert ist. Es stellt einen quadratischen Baukomplex von mehr als 500 m Frontlänge dar, dessen Raumprogramm — Parlament, Bibliothek, Museum, Theater, Sternwarte, Bischofskirche, theologisches Seminar u. a. — zugleich ein politisches Manifest enthält. Der Rastergrundriß verbindet den Idealstadt-Gedanken der Renaissance mit dem Bilde des Templum Salomonis als Sitz eines weisen Herrschers, wie er von den Architekturtheoretikern des 16. und 17. Jh. (Villalpando, Goldmann, Fischer v. Erlach) rekonstruiert worden war.
Von der Wirklichkeit des Bourbonenstaates war dieser Traum weit entfernt; doch ist ein Zug von »Utopia« (Nirgendwo) auch in der realen Geschichte des Schloßbaus nicht zu verkennen. Er äußert sich in der Wahl des Ortes, der Anlage einer »künstlichen« Residenz vor den Toren der Metropole, in den Ausmaßen des Palastes wie in den Funktionen, die ihm zugedacht, aber niemals realisiert wurden; als letzte Metamorphose der Idealstadt-Vorstellung — Sozialutopie im Zeitalter der Empfindsamkeit — erscheint am Ende der Baugeschichte die Einsiedelei König Ferdinands in S. Leucio (s. S. 614). Doch gab es auch handfeste Motive, die den Bau einer Residenz im Landesinneren nahelegten, und die Abkehr von den naturgesegneten Küsten des Golfes läßt sich auch als strategischer Rückzug vor ihren mannigfachen Gefahren verstehen. Caserta lag gleich weit entfernt vom Vesuv, von der Großstadt mit ihrem unruhigen Pöbel und von der See, auf der jederzeit feindliche Kriegsschiffe auftauchen konnten; eine britische Flottendemonstration von 1742 hatte diese Bedrohung drastisch vor Augen geführt. Andererseits war der Ort von Neapel aus bequem erreichbar, die Via Appia bot gute Verbindung zu weiteren wichtigen Städten des Reiches; der ebene Bauplatz entsprach dem im Norden Europas geprägten modernen Geschmack, während die Nähe der Berge doch auch die Anlage des traditionellen Kaskadengartens »all’italiana« ermöglichte. Nicht zuletzt fand Karls manisch gesteigerte Jagdleidenschaft hier ein ideales Tätigkeitsfeld.
Als Stützpunkt gelegentlicher Streifzüge diente anfangs ein Landsitz der Gaetani, der sich seit 1734 in königlichem Besitz befand. Der Palast, am O-Rand des jetzigen Schloßbezirkes gelegen, war
im 16. Jh. von den Acquaviva d’Aragona, Grafen (seit 1579 Fürsten) von Caserta, gegründet und im Lauf der Zeit zu einer prächtigen Villa ausgebaut worden. Die Hauptachse der Gärten lief von O nach W und endete in einem Waldpark; in seiner Mitte lag ein viell. noch mittelalterl. Wohnturm, der den Fürsten als Jagdcasino diente. Die ersten auf den »sito reale« von Caserta bezüglichen Baupläne hatten offenbar die Erweiterung dieses Gebäudes zum Ziel; gegen 1750 jedoch trat die Angelegenheit in ein neues Stadium. Die beiden berühmtesten röm. Architekten, Niccolò Salvi und Luigi Vanvitelli, wurden aufgefordert, Entwürfe für einen Neubau einzureichen. Salvi, auf Jahre hinaus vom Bau der Fontana Trevi in Anspruch genommen, lehnte dankend ab; Vanvitelli präsentierte einen Plan, der die Billigung des Königs fand, und wurde 1751 zum Hofbaumeister ernannt. Der damals 51jährige Künstler war Neapolitaner von Geburt, Holländer seiner Abkunft nach: als Sohn des Vedutenmalers Gaspar Adriaensz van Wittel aus Amersfoort (s. S. 233) war er in Neapel zur Welt gekommen, in Rom aufgewachsen und hatte sich dort zunächst unter Anleitung seines Vaters zum Maler und Architekten herangebildet. Ein Schülerverhältnis zu Filippo Juvara, wie es von zeitgenössischen Biographen behauptet wird, läßt sich aus chronologischen Gründen ausschließen; in Wahrheit scheint Vanvitelli einer der ersten »akademisch« gebildeten Architekten gewesen zu sein, bei denen ein mehr oder minder geregeltes Studium der »Klassiker« — von Vitruv bis Carlo Fontana — die Stelle einer persönlichen Lehre vertrat. 1733 berief man ihn selbst zum Mitglied der Lukas-Akademie; seit dem gleichen Jahr stand er in päpstlichen Diensten, aus denen er nun in Gnaden entlassen wurde.
Vanvitellis Auftreten in Neapel hebt das Bauwesen Karls von Bourbon, das bis dahin von so inferioren Figuren wie Medrano und Canevari beherrscht worden war, mit einem Schlag auf europäisches Niveau. Man war jetzt allgemein überzeugt, der König von Neapel sei im Begriff, den Ruhm Versailles’ in den Schatten zu stellen: »In zehn Jahren«, schreibt Madame du Boccage 1755, »wird es der stolzeste Palast in Europa sein.« Mit der Weite seines künstlerischen Horizonts verband Vanvitelli die solidesten technischen Kenntnisse; sein integrer Charakter erwarb sich sofort das Vertrauen des Königs, der die Leitung des riesigen Bauunternehmens ohne Zögern in Vanvitellis Hände legt. Noch 1751 wird mit der Zurichtung des Bauplatzes begonnen; am 20. Januar 1752 (dem 36. Geburtstag des Königs) erfolgt die Grundsteinlegung. Ein Karree von Soldaten markiert den Umfang des Baues, die Eckrisalite werden durch je 2 Kanonen dargestellt, die den feierlichen Akt mit donnernden Salutschüssen begleiten. Den 2. Stein setzt Vanvitelli selbst; er trägt den hoffnungsvollen Spruch »Möge das Haus und die Schwelle wie das Herrschergeschlecht der Bourbonen dauern bis dieser Stein auffliegt aus eigener Kraft.« Als Tag des Baubeginns wird der 19. Juni des gleichen
Jahres genannt. Die zügig vorangetriebenen Arbeiten erleiden eine Verzögerung, als Karl 1759 Neapel verläßt, um seinem verstorbenen Halbbruder Ferdinand V1. auf dem spanischen Thron zu folgen. Doch ordnet der König vor seinem Weggang ausdrücklich die Fertigstellung des Schloßbaus an und läßt sich auch in Madrid über den Fortgang berichten; man sagt, das Bauunternehmen habe ihm näher am Herzen gelegen als die Erziehung seines Sohnes Ferdinand, der später hier residieren sollte. 1772 arbeitet man schon an der Dachbalustrade. Am 1. März 1773 stirbt Vanvitelli. Sein Sohn Carlo übernimmt die Bauleitung, hat aber nicht mehr die Autorität, die Fertigstellung des Bauwerks durchzusetzen: 1774 wird das Gebäude ohne Kuppel und Ecktürme (s. u.) für vollendet erklärt; die Arbeiten an der Innenausstattung und an den Gartenanlagen setzen sich bis ins folgende Jahrhundert fort.
Einige Zahlen mögen einen Begriff von den Dimensionen des Ganzen geben. Der Palast bedeckt eine Fläche von 44300 m2, davon entfallen 16000 m2 auf die Höfe. Die Zahl der Fenster beträgt 1741, die der Räume über 1200 (Vestibüle, Korridore etc. nicht gerechnet); dazu kommen 2 große Treppenhäuser und 30 Nebentreppen. Auf dem Dach stehen 1026 Kamine. Sämtliche Räume sind gewölbt; die Außenmauern sind 3,5 m dick. Die Gesamtkosten der Anlage (einschließlich des Parks) hat man auf etwa 10 Millionen Dukaten berechnet.
Vom Zustand der Residenz unter Ferdinand IV. hat Goethe in seiner Lebensbeschreibung Philipp Hackerts ein anschauliches Bild entworfen. »Das neue Schloß«, notierte er sich nach seinem Besuch i. J. 1787, »ein ungeheurer Palast, escorialartig, ins Viereck gebaut, mit mehreren Höfen, wahrhaft königlich... schien mir nicht genug belebt, und unsereinem können die ungeheuren leeren Räume nicht behaglich vorkommen. Der König mag ein ähnliches Gefühl haben, denn es ist im Gebirge für eine Anlage gesorgt (San Leucio), die, enger an die Menschen sich anschließend, zur Jagd- und Lebenslust geeignet ist.« Tatsächlich diente das Schloß damals mehr zu gelegentlichen Frühjahrs- und Herbstaufenthalten denn als feste Residenz. Erst Ferdinand II. (1830-59) hielt ständig in Caserta Hof; eine Audienz bei ihm wird in Lampedusas »Gattopardo« beschrieben. Nach dem Ende des Regno di Napoli (1860) ging das Schloß in den Besitz des Königs von Italien über, seit 1921 gehört es dem Staat. Im 2. Weltkrieg diente es (seit 1943) als Hauptquartier der alliierten Mittelmeerstreitkräfte; am 29. April 1945 wurde hier die Kapitulation der deutschen Truppen in Italien unterzeichnet. Nach dem Kriege wurden die Bombenschäden beseitigt und Teile des Baues als Museum zugänglich gemacht.
Der Werdegang von Vanvitellis Entwürfen läßt sich aus Texten, Zeichnungen und Modellen mit einiger Sicherheit rekonstruieren.
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Caserta. Palazzo Reale, Grundriß des Erdgeschosses nach Vanvitelli
Am Anfang steht ein nur schriftlich überlieferter Plan, der an Juvaras Madrider Schloß (und damit zugleich an den Escorial) anknüpft: Der Mittelblock umschließt einen großen Hof, die Seitenflügel je 2 kleinere; im Zentrum — d. h. wohl im Grunde des Haupthofs — liegt eine Kirche; ausdrücklich hervorgehoben werden das Prachtportal (Ingresso magnifico) und 2 grandiose, hell erleuchtete und bequeme Treppenhäuser. Erst in einer 2. Planungsphase taucht der Grundgedanke des ausgeführten Palastes auf: Ein großes Quadrat wird in 4 gleichfalls quadratische Höfe unterteilt, im Mittelpunkt liegt ein oktogonales Vestibül mit seitlich abgehendem Treppenhaus. Der Ingresso magnifico erscheint hier gleichsam ins Innere des Gebäudes verlegt, wird im wörtlichen Sinne zum zentralen Motiv des Entwurfs.
Vergleicht man den Plan Vanvitellis mit den zeitgenössischen Mustern, die er gekannt und studiert hat — Louvre, Versailles und v. a. Madrid —, so fällt sofort seine Sonderstellung ins Auge: Den ins Breite gedehnten Prospekten des nordischen Schloßbaus tritt hier noch einmal das Würfelideal des »Palazzo« entgegen. So läßt die Vorgeschichte des Typs (Quadrat mit kreuzförmig angeordneten Binnenflügeln) sich in der italien. Architekturgeschichte bis ins 15. Jh. (Filarete) zurückverfolgen. Um 1700 wird er im Umkreis Carlo Fontanas neu belebt; auch Fugas Albergo dei Poveri in Neapel und seine Vorgängerbauten gehören in diesen Zusammenhang. Die Grundform des Achteckvestibüls mit angeschlossener Treppe findet sich vorgebildet auf einem Idealprojekt Gaetano Chiaveris, der 1748 von Dresden nach Rom zurückgekehrt war.
Vanvitelli wird eine Begegnung mit ihm gesucht haben, da die Gemahlin Karls von Bourbon dem sächsischen Königshaus entstammte. Nicht zuletzt mögen Raumphantasien Piranesis, mit dem Vanvitelli seit 1740 persönlich bekannt war, hier ihre Wirkung geübt haben — gebändigt freilich durch die unerbittliche Disziplin des praktischen Architekten, der seine Visionen in Maß und Zahl zu verwirklichen hat. Tatsächlich ist Vanvitellis Entwurf, bei aller Freizügigkeit der Erfindung, »more geometrico« entstanden. Ausgehend vom inneren Oktogon des Zentralvestibüls, läßt sich der Grundriß mit dem Zirkel nachkonstruieren; die Oktogonseite (24 Spannen) bildet den »Modul« eines Maßsystems, aus dem alle wichtigen Grundmaße bis zur Achseinteilung der Flügel hervorgehen. Dementsprechend ist auch der Aufriß von innen nach außen durchkomponiert; alle Gliederungen der Vestibüle, Höfe und Außenfronten sind maßgerecht aufeinander bezogen. Nichts ist kennzeichnender für den Stil Vanvitellis als dieser Umschlag vom Phantastischen ins Rationale, vom Schaugepränge fürs Auge zur in sich stimmigen Konstruktion; im »Schwanengesang des Barock« (R. Wittkower) kündigt unüberhörbar das Zeitalter der Vernunft sich an.
Im Laufe der Planungsarbeit erfuhr der »Idealentwurf« Vanvitellis 2 Erweiterungen, die seine Gestalt nicht unwesentlich veränder-
[Tafel mit SW-Abb. entfernt]
Caserta
ten. Die erste betraf den Grundriß, der vom Quadrat zum Querrechteck verbreitert wurde (37 x 27 Achsen, 247 x 184 m). Damit verloren auch die Höfe ihre quadratische Grundgestalt (Erweiterung von 7 x 7 auf 7 x 11 Achsen), und die im Zentralvestibül sich kreuzenden Diagonalen treffen nun nicht mehr die Außenecken, sondern laufen an beliebigen Punkten gegen die Hofwände an. Der Grund für diesen empfindlichen Eingriff war vermutl. der Wunsch des Königs, die im mittleren Querriegel gelegene Kapelle zur Kopie der Schloßkirche von Versailles auszugestalten.
Vanvitellis Entwurf sah nur einen relativ kurzen Kapellensaal in den Maßen des gegenüberliegenden Treppenhauses vor; die neue Idee machte eine Verlängerung nötig, die sich auf die ganze Organisation des Grundrisses auswirken mußte. Aber auch das Aufrißsystem Vanvitellis blieb nicht unverändert; in die anfangs geplante Stockwerksfolge — je 1 1/2 Geschosse in Sockel- und Oberzone — wurde ein neues Vollgeschoß eingeschoben, was für die Gliederung der Außen- und Hoffassaden einschneidende Folgen hatte (s. u.). Der erste Anstoß mag auch hier in der Höhe der neuen Kapelle zu suchen sein; dazu aber kam wohl die Vorstellung eines gesteigerten Raumbedarfs, seit der Minister Tanucci plante, den gesamten Regierungsapparat im Schloß zusammenzuziehen.
Die endgültige Redaktion des Entwurfs publizierte Vanvitelli 1756 in Form eines prächtigen Kupferstichwerks (Abb. S. 591); sie blieb für den ferneren Bau im großen und ganzen verbindlich, wurde allerdings nicht mehr vollständig ausgeführt. V. a. sollte das mittlere Vestibül von einer hochaufragenden Achteckkuppel bekrönt werden; über den Eckrisaliten waren turmartige, mit flachen Dachterrassen versehene Belvedere geplant. Ob diese Aufbauten überhaupt je als realisierbar galten, steht dahin; daß der Gedanke schon bald nach Baubeginn aufgegeben wurde, läßt sich der Gliederung der Fassade entnehmen. In den Stichen war nämlich für das Hauptgeschoß die ionische, für die Eckaufbauten die korinthische Ordnung vorgesehen; in der Ausführung aber wählte man als Hauptordnung die Komposita (ionisch + korinthisch), über der keine andere mehr erscheinen darf. So hätte noch Vanvitelli selbst sein Opus magnum als Torso aufwachsen sehen: Die Silhouette der riesigen Baumasse war ihrer Akzente beraubt, das Raumbild der Höfe verlor die entscheidende Orientierung zur Mitte hin. V. a. aber verwischte sich nun der bildhafte Sinn des zentralen Achteckbaus, über dem die Kuppel als »Herrscherkrone« erschienen wäre — eine letzte, schon ganz abstrakte Apotheose des monarchischen Gedankens in der Tradition antik-mittelalterl. Kaiserarchitektur.
Unausgeführt blieb auch der Skulpturenschmuck des Kupferstichplans. Als Hauptstück war ein kolossales Reiterbild des Königs vorgesehen, das nach Art einer antiken Quadriga (»non senza imitazione degli Antichi«) über dem Giebel des Mittelrisalits auf-
gestellt werden sollte. Frei stehende Statuen waren ferner für den Kuppeltambour und die Ecktürme geplant; die Sockel zu seiten des Hauptportals sollten allegorische Figuren tragen: Großartigkeit (Magnifizenza, mit einem Plan des Schlosses in der Hand), Gerechtigkeit, Milde und Frieden.
Eine einschneidende Reduzierung erfuhr schließlich die Gestaltung des Vorplatzes: die umgebenden Nebengebäude (Wachkasernen) hätten nach dem Vorbild des Petersplatzes ein geschlossenes Queroval mit sternförmig einmündenden Straßen bilden sollen; den niedrigen Flügelbauten zu seiten des Palastes war wohl eine ähnliche proportionsausgleichende Rolle zugedacht wie Berninis Korridorarmen. An dieser Stelle ist Vanvitellis Konzept auf doppelte Weise verdorben worden. Einmal unterblieb die geplante Verlegung der Via Appia in die Querachse des Ovals; so läuft diese Hauptverkehrslinie jetzt unmittelbar an der Front des Schlosses entlang und trennt sie von dem ihr zukommenden Platzbereich. Vollends destruktiv wirkte dann die Durchführung der Eisenbahn zwischen Platz und Zufahrtsstraße, welche die Blickbahn zerschneidet und den von Neapel her Kommenden zu einem absurden Umweg nötigt.
Die Ankunft zu Wagen über die von Neapel herangeführte, schnurgerade auf die »Reggia« zulaufende Bourbonenstraße und die Einfahrt in den Palast selbst gehören unbedingt zur Besichtigung von Caserta. Der Besucher findet sich hier in dem seltenen Fall, von seinem Auto einen im Sinne des Kunstwerks legitimen Gebrauch zu machen: Es ist ein Stilmerkmal dieser Architektur, daß man sie in der Bewegung aufnehmen, ja förmlich durcheilen muß, um ihren Ausdrucksgehalt zu erfassen; nicht zufällig jagt auf dem großen Prospektstich von 1756 ein Zug von Karossen in voller Karriere dem Eingang zu. Die Folge der Eindrücke, die man auf diesem Wege empfängt, beginnt mit dem Auftauchen des Mittelcorps der Fassade am Ende der großen Platanenallee. Es schwebt dem sich Nähernden vor und gewinnt allmählich an Klarheit, ohne daß dabei neue Einzelheiten zutage träten: Alle Gliederungsformen sind hier auf weiteste Fernsicht angelegt. Beim Erreichen des Vorplatzes springt der Prospekt seitlich auf, das Risalitmotiv wiederholt sich identisch an jeder Flanke des Blockes, die dazwischenliegenden Fensterreihen sind mit einem Blick überschaut; auch die Platzarchitektur bietet nichts, was das Auge festhalten möchte. Nun aber die Einfahrt ins Vestibül: ein Sichüberstürzen der Bilder und Perspektiven! Gleich sausenden Windmühlenflügeln tun die
Schrägdurchblicke sich auf, Pfeiler- und Bogenstellungen schieben sich durcheinander, und der scharfe Beleuchtungswechsel unter dem Portikus, nach der gleichmäßig blendenden Helligkeit des Vorplatzes, hat etwas Betäubendes. Ein Halt ergibt sich im Zentrum des Baues; wer nun zu Fuß die große Treppe betritt, sieht neue, überraschende Bilder vor sich aufsteigen. Doch kann man die Fahrt auch fortsetzen und das Schloß an der Gartenseite wieder verlassen; die Raumfolge läuft dann noch einmal rückwärts ab, bis am Ende, vom Park aus, ein zweiter Fernblick auf den Bau im ganzen sich herstellt.
Diese glatte Passage hat etwas sehr Merkwürdiges; sie läßt den riesigen Baublock fast transparent erscheinen, und tatsächlich sieht man ja schon im Anfahren von der Stadt her durch das Portal hindurch die große Kaskade des Parks: Blick-und Verkehrsachse münden unmittelbar in die Natur, während der König — in Versailles das sammelnde Zentrum aller Richtungsbezüge — hier gleichsam unsichtbar, von der Außenwelt abgesondert in seinem Piano Reale thront. Der Aufstieg dorthin ist im Grunde genommen ein Seitenweg, d. h. er zweigt von der Hauptrichtung ab und führt, wie man später bemerken wird, in ein neues Achsensystem, das nicht mehr mit der Außenwelt kommuniziert.
Betrachtet man die Fassade in Ruhe, so wirkt sie einförmig bis zur Monotonie: Da die Bewegung hier ganz ins erlebende Subjekt verlegt ist, erstarrt das Gebilde selbst zur bloßen Kulisse. Die gliedernden Einzelformen sind auf das notwendige Minimum reduziert — je ein Fenstertyp pro Geschoß, gleiche Säulen-und Pilasterstellungen im Zentrum wie an den Flanken, Dachbalustraden und Giebel als auswechselbare Zutaten aufgesetzt; die Risalitbildung vollzieht sich trocken und hart, ohne plastische Übergänge — anstelle der »Einfühlung« in den Baukörper tritt eine rein optisch wirksame Stufung der Fläche. Um so mehr ist es zu beklagen, daß Vanvitellis urspr. Proportionsrechnung, die sich den vorbereitenden Skizzen entnehmen läßt, durch die Einfügung eines 2. Vollgeschosses anstatt des oberen Mezzanins aus den Fugen geriet. Auch war das Zentralmotiv der Fassade, die Riesennische über dem Eingangsportal, aus dem alten Geschoßsystem hervorgegangen: Das Kämpfergesims der (etwas gedrungener proportionierten)
Nische entsprach der Trennungslinie zwischen Haupt- und Mezzaningeschoß; die Mittelgruppe im ganzen folgte so dem Triumphbogenschema von Salvis Fontana-Trevi-Fassade. Daß das Fehlen der Mittelkuppel und der beiden Ecktürme die Front ihrer vertikalen Akzente beraubt, braucht nicht noch einmal gesagt zu werden; das formlos durchlaufende, mit Kleinkram besetzte Dach übt jetzt im Verein mit der Bahnhofsuhr des Giebels eine wahrhaft sinistre Wirkung.
Erfreulich ist demgegenüber die Erhaltung der originalen Farbigkeit. Sie beruht auf der Kombination von Werkstein und Backstein — kein Putz! — und bereitet so auf die reine Marmorarchitektur des Inneren vor. Die Behandlung des Steines ist, der kolossalen Ausmaße ungeachtet, von seltener Präzision und Gediegenheit, der Eindruck im ganzen lebhaft und frisch, ja eigentlich »malerisch« im Sinne der niederländischen Vorfahren Vanvitellis. Charakteristischerweise wechselt der Stimmungsgehalt dieser Architektur je nach Licht und Wetter; unter trübem Himmel wirkt das Gebäude düster und schwer, an klaren Herbsttagen nimmt es manchmal etwas geradezu Leuchtendes an.
Die Wandgliederung der 4 Höfe erfuhr durch die Aufstockung des Palastes die einschneidendsten Veränderungen. Für die urspr. vorgesehenen 11/2 Obergeschosse über dem Rustika-Sockel plante Vanvitelli eine rhythmisch fortlaufende Pilaster- und Blendbogenstellung in den Maßen und Proportionen der Fassadenrisalite. Sie sollte sich rings um die Höfe ziehen, wobei auf jedes der schrägen Eckfelder ein Bogen entfallen wäre. Diese Eckbögen, in voller Weite zu Fenstern und Nischen geöffnet, sind als vereinzelte Überbleibsel des alten Systems in die Ausführung eingegangen; Vanvitelli mußte an ihnen festhalten, da das Zentralvestibül des Obergeschosses nur auf diese Art zu beleuchten war. I. ü. ist es für Vanvitellis Denkweise kennzeichnend, daß er die Blendgliederung, nachdem sie sich einmal als undurchführbar erwiesen hatte, einfach wegließ; was blieb, war die Wandfläche mit ihren Fensterreihen, die sich in nichts (auch nicht im Detail) von der Außenfront unterscheidet. Wiederum erscheint Einförmigkeit, Wiederholung des Gleichen, als hervorstechendstes »Stilmerkmal« dieser Architektur; erst der Wechsel von Blickfeld, Lichteinfall, Perspektive, wie er im Fahren von Hof zu Hof sich
ergibt, läßt eine Folge verschiedenartiger Bilder entstehen, die am Ende zur Vorstellung eines riesigen Ganzen zusammenschießen.
Auch Vestibüle und Portiken sind in ihren Maßen wie in ihren Gliederungsformen durchweg »genormt«; allein die verwickelte Grundrißbildung dieser Partien bringt Raumbilder von kaleidoskopischer Vielfalt hervor. Im Gegensatz zu der gleichsam fugendichten Geschlossenheit der Fassaden zieht die Portikus-Architektur ihre Hauptwirkung aus der Öffnung: Nicht Wände, sondern Pfeiler, Bögen und Nischen begleiten die Mitteldurchfahrt auf ihrer ganzen, gut 180 m messenden Länge. So wird der Blick nirgends aufgefangen, sondern gleitet nach jeder Richtung ins Freie bzw. in neue architektonisch geordnete Räume. Dazu kommt die Vielzahl unterschiedlicher Winkel, die im Aufeinandertreffen vier- und achteckiger Grundformen entstehen. Sie geben Anlaß zur Bildung keilförmig zugespitzter Pfeilermassen, die Flachkuppeln, Kreuz-und Kappengewölbe tragen. Zu ihrer Unterstützung hat Vanvitelli Säulen eingesetzt, die das Raumgefüge lockern und plastisch beleben. Die Durchbildung dieses überaus komplizierten Stützsystems, in dem jeder Winkel geklärt, jede Form zu Ende gedacht ist, zeigt Vanvitelli als Meister des »strengen Satzes« einer architektonischen Kompositionslehre. Nicht minder kunstvoll ist die Behandlung der Wölbzone, die mit einfachen Gurtbändern und Kassetten die Strukturlinien nachzeichnet und das Ineinandergreifen der Räume anschaubar macht.
Ihre äußerste Prachtwirkung erreicht die Architektur des Palastes im Treppenhaus. Darin liegt nur scheinbar ein Anknüpfen an neapolitan. Traditionen. Vanvitelli hat sich, im Gegensatz zu den Experimenten des »barocchetto«, an den klassisch-einfachen Typ der 3-Rampen-Treppe gehalten. Sie steigt in einem von geraden Wänden begrenzten Rechtecksaal auf; auch die Treppenwangen sind durch Wände maskiert, die den Durchblick zwischen den Läufen verwehren. Wir finden hier das gleiche Kontrastmotiv, welches das Verhältnis der Höfe zum Portikustrakt kennzeichnet: Auf die »offene« folgt wiederum eine »geschlossene« Struktur, auf den mehrschiffigen Pfeilerbau der Einheitsraum; dazu kommt der jähe Wechsel der Raumhöhen und der Helligkeitswerte. Gleichwohl sind Vestibül und
Treppen nicht nur »additiv« aneinandergefügt, sondern räumlich verklammert: Der Anstieg beginnt (und endet im Obergeschoß) bereits in der Umgangszone des Vestibüls, zwischen dessen Pfeiler sich einige Stufenfolgen einschieben. Man fühlt sich dabei an zeitgenössische Bühnenbilder oder auch an die »Carceri« Piranesis erinnert, die aus solchen »Verwerfungen« des Bodens reiche Effekte ziehen. Der praktische Vorzug dieser Anordnung liegt auf der Hand: Die Höhendifferenz der Geschosse — insgesamt 115 Stufen — war nicht in 2 Rampen allein zu bewältigen; deren Länge streift mit je 48 Stufen auch so noch die Grenzen barocker »comodità«. Das System der Wandgliederung folgt in etwa Le Vaus Gesandtentreppe im Schloß zu Versailles. Doch wird das berühmte Vorbild hier nicht nur an Größe, sondern auch durch die komplette Marmorauskleidung übertrumpft, bei der sämtliche im Lande vorkommenden Sorten des kostbaren Steines Verwendung fanden — eine das Auge blendende Pracht, die zugleich die wirtschaftliche Autarkie des Reiches demonstrieren sollte.
Im Dienste des Staatsgedankens steht auch der plastische Schmuck des Treppenhauses. Der Zyklus beginnt im Zentralvestibül, gegenüber dem Treppenaufgang, mit einer kolossalen Herkulesfigur; sie ist das Fragment einer Gruppe, welche die Krönung des Tugendhelden durch den Ruhm darstellen und, nach Vanvitellis Worten, die Benutzer der königlichen Treppe zu tugendhafter Haltung animieren sollte. In den seitlichen Nischen des Vestibüls hat man später Antikenkopien von P. Solari und A. Violani aufgestellt. Den Zugang zum Treppenpodest bewachen 2 Marmorlöwen (von P. Solari und P. Persico): Sie erweisen dem Aufsteigenden ihre Reverenz und symbolisieren zugleich die Macht der Vernunft und der Waffen, die dem König den Besitz seines Reiches sichern. Die 3 Nischenfiguren der darüber aufgehenden Wand fordern zu vorbeugender Gewissenserforschung auf. Vanvitelli teilt die Audienzsuchenden in 2 Gruppen ein: die einen bewerben sich um eine Stellung — auf sie ist die linke Figur, der »Verdienst«‚ gemünzt (von A. Violani); die anderen wollen eine Beschwerde vorbringen — ihnen gilt die Mahnung zur »Wahrheit« (rechts, von G. Salomone). In der Mitte aber thront die »königliche Majestät« (von Solari), die Verdienst und Wahrheit zu würdigen weiß und sich nicht von falschen Reden verführen läßt; als Sitzgelegenheit dient wiederum ein Löwe, »das einzige Tier, in dem Stärke und Milde einander die Waage halten«.
Das große Deckenfresko (von Girolamo Starace, 1769) stellt die Herrschaft Apolls im Kreise der Jahreszeiten dar. Der etwas unvermittelte Aufschwung aus der grämlichen Allegorie des höfischen
Kanzleibetriebs ins Reich der Musen läßt einen Programmwechsel vermuten, der kaum auf der Linie Vanvitellis lag. In der Tat zeigt das Stichwerk von 1756 an dieser Stelle ein geschlossenes Muldengewölbe ohne jede figürliche Dekoration, wie denn überhaupt die strenge Beschränkung auf die Wirkungsmittel des Architekten (auch farbig!) zu den wichtigsten antibarocken Impulsen der Kunst Vanvitellis gehört. Deckenmalerei, als reines Innenraum-Motiv, zerreißt den Zusammenhang einer Folge von »Architekturbildern«, die vom Außenbau bis zum oberen Vestibül den Weg des Beschauers begleiten soll; als äußerste Konsequenz dieses Stilbruchs erscheint hier die reale Durchbrechung der Wölbeschale (vgl. S. 296), die den Ausblick in eine fiktive, jenseits des Architektonischen liegende Welt eröffnet und das Bauwerk zum bloßen Rahmen relativiert. Für den Benutzer der Treppe wirkt das Deckenbild schon dadurch desorientierend, daß es sich in seinem Gewölbeausschnitt verschiebt und von dessen Rändern teilweise verdeckt wird; wer es betrachten will (wozu nach der Qualität der Malerei kein Anlaß besteht), muß an einer bestimmten Stelle des Weges haltmachen.
Eine ungleich stärkere Anziehungskraft übt nun aber der Blick in das Obere Vestibül, das Schritt für Schritt vor dem Aufsteigenden aus dem Boden wächst. 3 offene Bogenstellungen machen die volle Weite des Raumes sichtbar; die Wirkung der Untersicht mit ihren stürzenden Linien und schräg überschnittenen Gewölben steigert den Eindruck ins Phantasmagorische. Die Grundform der oktogonalen Pfeilerhalle entspricht dem Erdgeschoß, doch zeigt die aufgehende Struktur eine Anzahl fein kalkulierter Abweichungen, die den Charakter des Raumes nicht unwesentlich verändern. Auf Überhöhung, Entrückung ist schon die Führung der oberen Treppenstufen berechnet: Sie heben nach Art eines Tempelsockels den Mittelraum über das Umgangsniveau hinaus und suchen den Ankommenden noch für einen Augen-Blick in Distanz zu halten (während die geteilten Stufenfolgen im“ Untergeschoß gerade das Verbindlich-Einladende betonten). Zudem sind die Proportionen der Pfeiler und Bögen hier etwas steiler; im Mittelraum nimmt eine Rundkuppel die Stelle des niedrigen Kappengewölbes ein; die schlanke und zierliche Ionica ersetzt die dorische Ordnung, und der Marmor spiegelt und prunkt in den seltensten Qualitäten. Nur noch gedämpft durch die (von Anfang an vorgesehenen) Glasfenster wirkt die Außenwelt herein. Es herrscht die Stimmung eines Sakralraums; wir spüren, daß wir die Mitte des Schlosses erreicht haben,
unter der »Krone« stehen. Indes, diese Mitte ist leer — ihrer Funktion nach ein bloßer Verteiler, ihrer Form nach pure Architektur, ohne jede figürlich-sprechende Zutat. Hier ist die Baukunst Selbstzweck geworden; ihr Sinn besteht, nach einem Piranesi zugeschriebenen Ausspruch, in der Hervorbringung von »grandes idées — et je crois, que si l’on m’ordonnait le plan d’un nouvel univers, j’aurais la folie de l’entreprendre«.
Die mittlere der 3 Türen des Vestibüls, gegenüber dem Treppenaufgang, führt in die Palastkapelle (Cappella Palatina). Sie bildet den Abschluß, ja gleichsam das Ziel der monumentalen Raumfolge; dies wird nicht nur durch ihre Lage, sondern auch durch die Wahl der korinthischen Ordnung ausgedrückt, mit der hier wie am Außenbau (nach dem urspr. Plan, s. o.) der Zyklus der Ordnungen endet. Die Vollendung des Raumes fällt in die Jahre nach Vanvitellis Tod; erst in der Christnacht 1784 wurde der Eröffnungsgottesdienst gehalten. Ein Vergleich mit dem Kupferstichplan von 1756 zeigt, daß die Wirkung urspr. noch freier und reicher gedacht war: Die Ovalfenster des Gewölbes liegen dort in großen Stichkappen, deren Rahmungen verflechten sich zu einem Netz ausschwingender Gurtbänder, die 3 längliche Spiegelfelder umfassen. Auch die Apsiskalotte sollte durch Stichkappen und schräg überkreuzte Gurte gegliedert werden. Diese sehr bewußt gesetzten Akzente — man vergleiche die Kuppel der SS. Annunziata in Neapel — wurden in der Ausführung wieder zurückgenommen oder jedenfalls so weit gedämpft, daß der Eindruck des Förmlich-Korrekten vorherrscht. Wahrscheinl. handelt es sich um einen Eingriff von Vanvitellis Sohn Carlo, der hier wie an anderen Bauten des Vaters dem veränderten Zeitgeschmack Rechnung trug; auch die Annunziata-Kuppel war ja schon auf zeitgenössische Ablehnung gestoßen.
Die Grundform des Raumes geht bekanntlich auf J. Hardouin-Mansarts Schloßkirche von Versailles zurück. Dies darf nun nicht einfach als Symptom eines französ. Einflusses auf Vanvitelli gewertet werden — er hat im Gegenteil alles getan, die ihm fremde Raumform zu »italianisieren« —, sondern erklärt sich wohl aus einem Wunsch des Königs, der dem Architekten allerlei Kopfzerbrechen bereitete (s. o.). Eine spezielle Schwierigkeit ergab sich aus
dem 2geschossigen Aufriß, der zur traditionellen Ikonographie der Palastkapellen gehört. In Versailles liegt das Kirchenschiff im Erdgeschoß, während die Empore mit der Königsloge dem Niveau des Hauptgeschosses entspricht. Vanvitelli, der mit ganz anderen Stockwerkshöhen zu rechnen hatte, mußte beide Kapellengeschosse im Piano Reale unterbringen; der König tritt hier durch das Portal des Schiffes in die Kirche ein und erreicht erst über ein Treppchen zur Rechten seine »Tribuna« gegenüber dem Hochaltar. Konsequenterweise spielt im Aufrißsystem Vanvitellis die Geschoßteilung eine eher beiläufige Rolle. Die untere Zone, wesentlich niedriger als in Versailles, wirkt nur mehr als Sockel der großen Emporenordnung; der Raum ist im ganzen breiter und weiter, aus dem Stockwerksbau ist ein in sich zentrierter Saal geworden (Breite :Höhe des Mittelschiffs in Versailles etwa 1 :2,5, hier 1 :1,75). Auch der Rhythmus der Wandgliederung hat sich verändert: in Versailles unten einfache Pfeilerbögen, darüber Einzelsäulen — hier die Stützen paarweise gruppiert, im Untergeschoß zu kompakten Mauerblöcken zusammengefaßt, zwischen denen nur schmale architravierte Durchgänge offen bleiben. So wird die halb got. »Gitterwand« des französ. Baues (die dort folgerichtig in eine Art Kreuzgewölbe ausläuft) von Vanvitelli ins Plastisch-Tektonische umgebildet; ein Vorgang, der ja schon für Italiens Verhältnis zur Hochgotik charakteristisch war (S. 176). Am augenfälligsten wird der Unterschied in der Chorlösung: In Versailles laufen Seitenschiffe und Emporen als Umgänge rings um den Chor, der Raum erscheint allseits von einer durchsichtigen Hülle umfangen — dagegen hier die geschlossene Höhlung der Apsis, in der die Strukturen der Wand sich reliefhaft zusammendrängen.
Von der sublimen Geistigkeit des französ. Vorbildes ist Vanvitelli kaum berührt worden; doch läßt der Raum überall jene Kraft und Sicherheit spüren, die alle seine Architekturen auszeichnet. Mit besonderer Sorgfalt ist die Beleuchtungsfrage geregelt: das Schiff erhält sein Licht teils indirekt von den Emporen her, teils direkt durch ein großes Fenster in der Eingangswand über der Königsloge (das Dach ist an dieser Stelle unterbrochen); so bilden sich keine die Einheit des Raumes gefährdenden Schattenlöcher, und die herrlichen Marmorsäulen stehen nicht als dunkle Sil-
houetten vor den Seitenfenstern, sondern werden allseits vom Licht umspielt. Die figürliche Ausstattung der Kapelle blieb teils unausgeführt (Heiligenstatuen zwischen den Säulenpaaren), teils fiel sie einem Bombenvolltreffer des 2. Weltkrieges zum Opfer (Bilder von Conca, Bonito und Mengs); nur das schöne Hochaltarbild mit der Unbefleckten Empfängnis von Bonito überstand die Katastrophe. Die architektonische Dekoration wurde in den 1950er Jahren sorgfältig restauriert.
In die Räume des Piano Reale tritt man durch die Seitenportale des Vestibüls: Das linke führt, nach dem Plan Vanvitellis, in das Appartement des Königs, das rechte in das der Königin. Die Sphäre der »absoluten Architektur« ist damit zu Ende; der monumentale Anspruch wird unvermeidlich kompromittiert durch die Forderungen des Wohnkomforts, und der Zentralbaugedanke, als höchster Ausdruck des italien. Individualismus, gerät in Konflikt mit dem höfischen Zeremoniell und seinem in Frankreich entwickelten Reihenideal. So sind die Wohnflügel ihrer Länge nach in 2 Raumreihen unterteilt (»appartements doubles«), d. h. die Fluchten der Haupträume — Saal der Hellebardiere, Saal der Leibgarde, erstes, zweites, drittes Vorzimmer, Audienzsaal, Schreibkabinette, Privatkapelle und Wohngemächer — werden an der dem Hof zugewandten Seite von Nebenräumen, Korridoren, Verbindungstreppen etc. begleitet. Die Abfolge geht jeweils vom Vestibül durch den Mitteltrakt zur Fassade, biegt dort nach W um und setzt sich im W-Trakt von den Ecken zur Mitte hin fort, wo die beiden Appartements durch eine lange Galerie miteinander kommunizieren. In der O-Hälfte des Baues sind die Wohnungen der königlichen Prinzen und Prinzessinnen untergebracht; sie bilden ähnliche Reihen, die im Zentrum des O-Traktes in einen Ovalsaal münden.
Mit eiserner Pedanterie hat Vanvitelli die fast unabsehbare Masse der Säle und Zimmer symmetrisch geordnet; jeder Raum, jedes Appartement findet in der anderen Hälfte des Planes sein Spiegelbild. Auf die erlebnismäßige Einheit des Baues hat diese Logik sich eher nachteilig ausgewirkt. Denn die Achse des Piano Reale, durch die Richtung der Treppe bedingt, steht quer zu der des Untergeschosses und damit zu jenem umfassenden Achsensystem, das die Beziehung des Bauwerks zur Außenwelt regelt. So kommt es, daß der
Besucher auf seinem Weg durch das Obergeschoß eine Art Antiklimax erlebt: Er erreicht den Thronsaal an einer beliebigen, im Außenbau gar nicht markierten Stelle des Seitenflügels; das Hauptrisalit der Fassade aber, hinter dem man unwillkürlich den König vermutet hatte, ist in 2 einfache Vorzimmer unterteilt, und auch die Riesennische mit dem Balkon, die wie geschaffen schien für die Epiphanie des Herrschers, enthüllt sich am Ende als pure »Idee«, der gar kein sozialer Inhalt entspricht. Ohnehin hat die Kraft des bourbonischen Hofes nicht ausgereicht, das Raumprogramm Vanvitellis mit Leben zu füllen. So wurde der Grundriß des Piano Reale nur mehr im Rohbau realisiert; die Innenausstattung der Räume blieb den Nachfolgern Karls III. vorbehalten, die es sich sukzessive in den einzelnen Flügeln des kolossalen Gehäuses wohnlich zu machen suchten.
Die Säle des Mitteltraktes vom Vestibül zur Eingangsfassade (Sale di Rappresentanza) erhielten ihre erste Ausstattung unter Ferdinand IV. gegen Ende der 1780er Jahre; einige Veränderungen wurden unter Joachim Murat und. in der bourbonischen Restaurationsperiode nach 1815 vorgenommen. Das Wand-und Gewölbesystem der ersten beiden Räume entspricht noch in etwa den Vorschlägen Vanvitellis; die Deckenfresken stammen von Domenico Mondo (Die Tugenden tragen die Waffen des Hauses Bourbon), Girolamo Starace (Der Ruhm des Hauses Farnese und die 12 Provinzen des Reiches, darunter Flachreliefs von G. Salomone) und Mariano Rossi (Hochzeit Alexanders d. Gr.). Im Fassadentrakt folgt nach rechts (W) das Appartamento Nuovo, eingerichtet 1807 bis 1845; die Architektur des Thronsaals (des dritten in dieser Reihe) stammt von Gaetano Genovese. — Von hier aus kann man den W-Trakt durchlaufen; er enthält das sog. Appartamento del Re, mit reicher Ausstattung des 19. Jh. — Vom Mitteltrakt nach O erstreckt sich das Appartamento Vecchio, das seit dem Ende des 18. Jh. als königliche Wohnung diente (derzeit nicht zu besichtigen). Die sehr reizvolle Ausstattung schwankt zwischen Louis XVI und einem verspäteten Rokoko; schöne Deckenfresken von De Dominici und Fischetti; im 5. Raum (Studio Ferdinands II.) Supraporten von Tischbein und Veduten von Hackert. — Der große Ovalsaal im Zentrum des O-Traktes enthält die von den Bourbonen gesammelte Weihnachtskrippe, eines der berühmtesten Stücke der Gattung, mit über 1200 Figuren der besten Meister des 18. Jh. (1950 restaur. und neu aufgestellt). In den westlich angrenzenden Räumen (Mitteltrakt zum Treppenhaus) befindet sich das Material eines hoffentlich bald zu eröffnenden Museo Vanvitelliano (Zeichnungen, Stiche, Holzmodelle etc.).
Die Anlage eines Hoftheaters (Teatrino di Corte) scheint zu den königlichen Sonderwünschen gehört zu haben, die erst im Laufe der Planungsarbeit an Vanvitelli herangetragen wurden. Es fand seinen Platz im Zentrum des W-Traktes, und zwar im Erdgeschoß. Die Eingangstüren befinden sich in den Ecken der westl. Höfe; als Zugang vom Piano Reale war eine große Rundtreppe rechts hinter der Apsis der Palastkapelle gedacht, die aber unvollendet blieb. Nicht ohne Mühe hat Vanvitelli den etwa 500 Sitzplätze umfassenden Zuschauerraum in das Geschoßsystem des Sockels eingepaßt; der oberste der 5 Ränge liegt in den Stichkappen des ganz flachen Gewölbes, der unterste mit dem Parkett ein Stück unter dem Hofniveau. Der Grundriß zeigt die übliche Hufeisenform, das Hauptmotiv des Aufrisses bildet eine Kompositordnung aus 12 prächtigen Marmorsäulen, welche die 3 mittleren Ränge zusammenfaßt. Die malerische Dekoration stammt von Crescenzo della Gamba. Schon 1769 wurde das Theater eröffnet und bis zum Ende des Jahrhunderts mehr oder weniger regelmäßig bespielt; seine Glanzzeit erlebte es unter Giovanni Paisiello, der 1787 zum Hofkapellmeister ernannt worden war. 1772 brach man die dem Garten zugewandte Rückwand des Bühnenhauses auf und ließ die Schlußszene von Metastasios »Dido« — den Brand von Karthago — im Freien spielen; später wurden an dieser Stelle zerlegbare Wände eingebaut, so daß man bei Bedarf den Garten in das Bühnenbild einbeziehen konnte.
Die Besichtigung des Parks findet wieder zu Wagen statt (möglichst unter Vermeidung des Sonntagnachmittag-Verkehrs); als Fußgänger kommt man sich in diesen endlosen Gefilden ganz verloren vor. Die Länge der Hauptachse vom Schloß zur großen Kaskade beträgt etwa 3 km. Davon ist allerdings nur das 1. Drittel wirklich als Park gestaltet; der Rest besteht aus einem Streifen von knapp 100 m Breite, eingefaßt von Baumreihen und Bosketts, welche die seitlichen Grenzen kaschieren und den Blick in die Tiefe ziehen. Dieser Eindruck des Unbegrenzten, dem Horizont Zustrebenden gehört zu den Wesenszügen des Parks als eines absolutistischen Machtsymbols. Rechnete die Renaissance, nach einem Wort Jacob Burckhardts, stets mit dem »Kontrast der freien Natur, die in den Garten von
außen hereinschaut«, so bildet der barocke Park ein künstliches Universum, das die Außenwelt gleichsam substituiert.
Jedoch, wo im Norden (Versailles) der Blick ins Weite verschwimmt, sorgt die italien. Landschaft für feste Konturen; an die Stelle »zart verschwebender Unendlichkeiten« (H. Junecke) tritt die starre Balance von Ebene und Berg, Bauwerk und Felsgestein. Für die Situation von Caserta ist nun bezeichnend, daß diese Balance nur mehr optisch, d. h. im Fernblick erlebt werden kann. Der Palast liegt vorn in der Ebene, der Berghang so weit im Hintergrund, daß er keinerlei plastische Empfindung mehr auslösen kann; das »Kulissenhafte«, als Charakterzug dieser Architektur, bestimmt auch ihre Beziehung zum Landschaftsraum.
Vanvitellis Aufgabe als Gartenarchitekt war dreifacher Art. Er mußte das Wasser heranführen und vom Berg herab in die Ebene leiten; ein Brunnenprogramm angeben, das den Fluß des Elements allegorisch verbrämt und schmückt; schließlich die Park-und Gartenanlagen der unteren Zone entwerfen. Selbstverständlich verfügte er über die Kenntnis der röm. Wassergärten der Renaissance (Bagnaia, Frascati) wie auch der großen Barockparks in Holland und Frankreich; ein spezielles Vorbild bot der Park von La Granja bei Madrid, ein Werk französ. Architekten vom Anfang des Jahrhunderts, in dem Karl von Bourbon seine Jugendtage verlebt hatte. Wie kaum anders zu erwarten, blieb Vanvitellis Idealplan (Kupferstich) großenteils auf dem Papier. Einiges wurde gar nicht, anderes später und abweichend von den Ideen des Meisters ausgeführt; dafür drängten sich Nebengedanken hervor, die dem König besonders gefielen und den großen Entwurf allmählich zersetzten. Allein die Wasserspiele sind im Laufe von etwa 3 Jahrzehnten fast vollständig realisiert werden, was angesichts ihrer Ausmaße und der im Wege stehenden technischen Schwierigkeiten eine kaum glaubliche Energieleistung darstellt.
Das Hauptproblem war die Beschaffung einer ausreichenden Wassermenge für den Kaskadengarten wie auch für die Versorgung der Residenz. Bei deren Gründung war von gelehrter Seite der Vorschlag gemacht worden, einen von Dio Cassius erwähnten Aquädukt Julius Cäsars zu reaktivieren, der aus den Bergen nach Capua geführt und dabei die Gegend von Caserta passiert haben sollte. Doch verging das Jahr 1751 mit fruchtlosen Sucharbeiten nach Überresten des Römerbaus; man fand nur ein paar Spuren im Valle di Maddaloni, etwa 5 km östlich von-Caserta.
Immerhin gab dies einen Anhaltspunkt für die Richtung, aus der die Baumeister Cäsars Wasser herbeigeschafft hat-
ten; verlängerte man die damit gegebene Linie nach 0, so stieß man auf das Massiv des Monte Taburno, das in der Tat genügend ergiebige und hoch gelegene Quellen enthielt. Vanvitelli erlebte später die Genugtuung, in der Nähe des Quellgebietes die Reste der röm. Anlage aufzufinden. Der Bau des Acquedotto Carolino wurde 1752 begonnen, 1764 im wesentlichen beendet; 1769 fand die feierliche Eröffnung statt, doch wurden noch ein Jahr später neue Quellen eingeleitet. Es war ein Unternehmen, wie es seit dem Altertum nicht mehr gewagt worden war; Winckelmann, der 1758 Caserta besuchte und übrigens von »Größe, Pracht und gutem Geschmack« der Architektur sich beeindruckt zeigte, pries die neue Wasserleitung als »etwas, was man nirgends in der Welt sehen wird«. Die Gesamtlänge betrug 27 Meilen, das sind 41 km. Über Täler, Flüsse und Sümpfe wurden Brücken gebaut, die Berge teils umgangen, teils mit in den Felsen gehauenen oder gesprengten Tunneln durchbohrt. Das schwierige Kunststück der Nivellierung einer so langen und unübersichtlichen Strecke gelang perfekt, man kam genau an dem Punkt heraus, den Vanvitelli bei Baubeginn durch eine Tafel markiert hatte.
Das imposanteste der dabei entstandenen Bauwerke sind die Ponti della Valle über der Straße Maddaloni-Telese, etwa 3 km nördlich von Maddaloni. Quer über das Tal spannt sich eine Brücke von 528 m Länge und maximal 58 m Höhe, getragen durch 3 Ordnungen von Pfeilerbögen. Nicht anders als die röm. Architekten hat Vanvitelli auf jeden Schmuck verzichtet; es spricht nur der Rhythmus der Bogenreihen und der schräg anlaufenden Streben, die jeden 2. Pfeiler verstärken. Die Achse der Straßendurchfahrt, am rechten Ende des Talbodens, ist durch eine etwas größere Spannweite ausgezeichnet, der untere Bogen vorgestaffelt und an jeder Seite mit einer Inschrifttafel dekoriert. Die Fundamente der Mittelpfeiler reichen an die 30 m ins Erdreich hinab; in großer Tiefe stieß man auf eine mit verkohlten Skeletten gefüllte Grotte, die zusätzliche Fundierungsarbeiten notwendig machte. »Nicht einmal der Erdenschoß ist frei von Tücke«‚ schrieb der geplagte Architekt an einen Freund. Die Tragfähigkeit des Steinmaterials (Backstein und Tuff) scheint exakt kalkuliert; die Höhe der Bögen nimmt von unten
nach oben gleichmäßig zu, dementsprechend verjüngt sich der Pfeilerquerschnitt. Daß die Rechnung aufging, erweist der makellose Zustand des Mauerwerks, dem auch die zahlreichen Erdbeben dieser Zone keinen Riß beizubringen vermochten.
Die Arbeiten im Bereich des Parks begannen mit der Rodung des Waldes in der Ebene hinter dem Schloß. Sie war zur Anlage eines Gartenparterres bestimmt; Vanvitelli sah Blumenbeete mit zierlichen Rokokomustern, geometrisch geführte Wege, Statuen und Fontänen vor, alles in Monumentalformat. Zustande kam nur eine weite, von dichtem Eichen- und Steineichenwald gerahmte Rasenfläche, die man heute in Richtung der großen Achse durchfährt. Von einem Rundplatz im Zentrum strahlen weitere Wege aus und verlieren sich in den Tiefen des begleitenden »bosco«. Im N treten die Bäume und Hecken zu einem weitgespannten Halbkreis zusammen; 16 Hermen aus weißem Carrara-Marmor heben sich vom Hintergrund des Dickichts ab. — Man blickt von hier aus zurück auf die Gartenfassade des Schlosses. Es gehört zu den Vorrechten einer Gartenfront, sich freier, weniger offiziell zu geben als die nach außen gekehrte Seite des Baues. Im System Vanvitellis waren Lücken dieser Art nicht vorgesehen; dem Wunsch nach Auflockerung konnte nur durch »schmückendes Beiwerk« entsprochen werden./So läuft die Pilasterordnung, die vorn als Begleitung der Risalite auftritt, hier gleichmäßig über die ganze Front — ungehemmt übrigens durch die Hofeinfahrten des Sockelgeschosses, über denen je 2 Pilaster zur Hälfte »hohl« stehen. Auf der Dachbalustrade erscheint im Kupferstich eine Reihe froh bewegter Statuen. Als Gipfel des Leichtsinns plante Vanvitelli eine neue, giebellose Bekrönung für die Fenster des obersten Stockwerks, wovon man dann in der Ausführung wieder Abstand nahm. Daß der Effekt im ganzen doch sehr verschieden und in gewisser Weise glücklicher ist als der der Eingangsfassade, hängt wesentlich von der Umgebung ab: Inmitten des Grüns steht der Block isoliert, die große Idee tritt hier klar und rein in Erscheinung, ohne daß — wie im Vorplatz — die Realität der »Außenwelt« sich ernüchternd dazwischenschiebt.
Der Bosco Vecchio im W des Parterres gehört noch zum Waldbestand der Acquaviva-Villa; auch das Wege-
netz, mit leicht abweichender Orientierung, geht mindestens teilweise auf die Anlage des 16./17. Jh. zurück. In seiner Mitte liegt die Castelluccia, eine mit Bastionen, Gräben und Zugbrücken bewehrte Miniaturfestung, an Stelle des alten Jagdcasinos 1769 errichtet, um die königlichen Prinzen im Kriegshandwerk zu unterweisen. 1819 wurde die Anlage zum Gartenpavillon umgebaut. Der oktogonale Mittelturm enthält hübsche Räume mit klassizist. Dekorationen (1953 restaur., meist verschlossen); das Mobiliar wurde von der alliierten Besatzung des 2. Weltkrieges zertrümmert. — Ein Stück weiter nördlich stößt man auf ein 120 x 300 m großes Wasserbecken, die Peschiera Grande (1762-69). Der junge König Ferdinand ließ hier Schiffchen fahren und veranstaltete kleine Seeschlachten. Auf der Insel wollte Vanvitelli einen Rundtempel bauen; später entwarf er auf Wunsch des Königs einen Pavillon mit einem runden, kuppelbekrönten Ballsaal, diagonalen Eckkabinetten und elegant geschwungenen Treppenaufgängen. Der Grundriß des überaus reizvollen Baues erinnert in Vanvitellis Zeichnung von ferne an das »Teatro Marittimo« der Hadriansvilla zu Tivoli. Ausgeführt wurde davon nichts; Vanvitellis Sohn Carlo verwirklichte einen ähnlichen Gedanken in seinem Inselschlößchen im Lago Fusaro (s. S. 459).
Am N-Ende des Parterres öffnet sich ein zweiter, von Hecken gefaßter Rundplatz. Ringsum stehen 10 Marmorhermen (Apoll und die Musen); im Zentrum liegt die kreisförmige Fontana Margherita. Hier beginnt der Canalone, jene Folge von Brunnen, Kaskaden und langgestreckten Bassins, die das Hauptmotiv des Parks bilden.
Das vom Berg herabkommende Wasser wird in all seinen Zuständen vorgeführt: stehend als spiegelnde Fläche, fließend, sprudelnd und stürzend — endlich, nach dem nicht verwirklichten Plan Vanvitellis, emporschießend in einer Fontäne im Gartenparterre und den zahllosen Steig-und Springstrahlen ihrer Trabanten. Der Übergang aus der Ebene in die Steigung vollzieht sich in vielfältig wechselnden Stufen und Böschungen, die aus der minimalen natürlichen Bodenbewegung herauszuziehen unendliche Mühe gekostet haben mag. Gegen den Berghang zu wird der Rhythmus rascher, die Stufenfolge verkürzt sich, um am Ende in einer Serie von Rampen, Terrassen und Futtermauern in die Höhe zu steigen — ein Perspektiveffekt, der
freilich nur im Kupferstich voll zur Geltung kommt, da die abweichende Ausführung der großen Kaskade das Schlußbild von Grund auf verwandelt hat. Für das figürliche Brunnenprogramm holte Vanvitelli den Rat eines gelehrten röm. Freundes namens Porzio Lionardi ein; dieser entwarf einen mythologisch-allegorischen Zyklus nach Ovids Metamorphosen. Seine Realisierung fiel erst in die Jahre nach Vanvitellis Tod; sie zeigt den allmählichen Rückzug aus der Sphäre des Mythos ins Genrehaft-Anekdotische, bis schließlich die Figuren überhaupt beiseite treten und die »Natur« — Wasser, Felsgestein, Vegetation — die Hauptrolle übernimmt. Für die architektonisch-technischen Anlagen zeichnete Vanvitellis Sohn Carlo verantwortlich; in Entwurf und Ausführung der plastischen Gruppen teilten sich die Bildhauer Paolo Persico (der Hauptmeister des Diana-Brunnens), Tommaso und Pietro Solari, Angelo Brunelli, Andrea Violani und Gaetano Salomone (von ihm die 1783 datierte Ceres und die Venus-Adonis-Gruppe).
Eine erste Serie von Göttern und Helden — Perseus, Atalante, Bacchus, Herkules, Minerva und die Hippokrene — sollte in den Brunnen des Gartenparterres auftreten; der großen Fontäne waren 3 Flußgötter zugedacht: der Ebro, die Weichsel (wohl als größter Fluß von Sachsen-Polen, dem Heimatland der Königin), und, gewissermaßen als deren Kind, Klein-Sebeto (»picciol Sebeto«, für Neapel). — Anstelle der bescheidenen Fontana Margherita war eine weitausgreifende Brunnenanlage geplant, die das Reich des Neptun vorstellen sollte. Über die seitlich ausschwingenden Rampen erreicht man die 1. Niveaustufe des Canalone. Eine Brücke (Ponte di Ercole) führt über die Verbindungsstraße zwischen den Dörfern Aldifreda und Ercole hinweg. Rechts und links stehen marmorne Statuen, darstellend Herkules und 5 Monate. — Das nachfolgende Wasserbecken (Peschiera superiore), 475 m lang, wird gespeist von der Cascata dei Delfini am oberen Ende: Eine im Halbkreis zurücktretende Futtermauer umfaßt einen künstlichen Felsaufbau mit 3 riesigen, ins Monströse verzerrten Delphinen, aus deren Mäulern das Wasser hervorschießt. — Auf der folgenden Ebene wird das Wasser unterirdisch geführt; am Ende des Rasenstreifens steigen die Seitenwege abermals an und vereinigen sich zu einer weitgespannten Portikus-Architektur, über deren Mitte sich ein breiter Wasserfall ergießt. Die Szenerie wird ausgefüllt von 29 Figuren (geplant waren 54), die das Reich des Äolus vorstellen; über dem Wassersturz hätte Juno auf ihrem Pfauenwagen erscheinen sollen, die (nach Vergil) den Gott ersucht, die Winde loszulassen, um Äneas von den Küsten Italiens fernzuhalten. Man kann unter dem Portikus von einer Seite zur anderen gehen und sieht von der
Mittelgrotte aus Park und Schloß hinter einem gläsernen Wasservorhang auftauchen. — Es folgt wieder ein langgestrecktes Bassin, das am oberen Ende in eine Folge von 7 Stufen übergeht, über die das Wasser stromschnellenartig herabstürzt. Über ihnen thront Ceres Trinacria als Göttin Siziliens, der Kornkammer des Reiches, umgeben von Nymphen und Amoretten; die beiden wichtigsten Flüsse der Insel, Anapro und Simeto, spenden Wasser, im darunterliegenden Becken tummeln sich speiende Delphine und Tritonen, die auf Muschelhörnern blasen. Bei vollem Wasserdruck (wenn die Kaskade im Hintergrund als fast geschlossenes weißes Band erscheint) gibt es ein munteres Durcheinander sich überkreuzender Bogenstrahlen. — Auf der nächsten Stufe ist das Wasser wieder verschwunden; erst jenseits einer Rasenfläche folgt eine neue Serie von 12 Stromschnellen (Cascatelle). Die oberste trägt wieder eine große mythologische Gruppe: Venus sucht Adonis von der verhängnisvollen Eberjagd zurückzuhalten. Nymphen und Putten mit Jagdhunden sind malerisch über die Klippen verteilt — auf Architektur ist schon ganz verzichtet; links lauert das Untier, das den Jüngling zerreißen wird.
Man betritt nun über eine Freitreppe die oberste Terrasse. Ein weites, von Wald und Felswerk gesäumtes Becken empfängt den ungeheuren Wassersturz der großen Kaskade (Tafel S. 593). Die Mitte, wo der Hauptstrom niedergeht, ist frei; 2 seitlich angeordnete Felseninseln tragen den Skulpturenschmuck. Dargestellt ist die Geschichte des Jägers Aktäon, der Diana im Bade beobachtet hat: Wir sehen zur Rechten die erzürnte Göttin im Kreis ihrer Nymphen, im Begriff, den strafenden Spruch zu verkünden; links Aktäon, schon hirschköpfig, von seinen eigenen Jagdhunden angefallen. Frei und locker in die grandiose Naturszenerie gestellt, erscheinen die heftig bewegten Figuren wie erstarrt im Zauberbann der Verwandlung — ein Moment panischen Entsetzens, dem das unaufhörliche Brausen des Wassers etwas sonderbar Unwirkliches verleiht. Der Gesamtentwurf stammt von Paolo Persico. Die beiden Titelfiguren und 3 der Nymphen führte er eigenhändig aus; die anderen Nymphen arbeitete Angelo Brunelli, die Hunde Pietro Solari.
Wie schon angedeutet, plante Vanvitelli an dieser Stelle eine rein tektonische Anlage, die in breit gestaffelten Rampen und Treppen zu einem Kuppelbau auf dem Gipfel des Berges emporsteigen sollte; das Wasser wäre auch hier nur in einzelnen, plastisch gefaßten Brunnen aufgetreten. Nach seinem Tode gab man diesen Gedanken auf zugunsten des
quasi natürlichen Falls über roh behauene Klippen und Felsbrocken, die die ganze Höhendifferenz (78 m) in einem Zuge durchläuft — eine schwer zu analysierende Mischung aus barockem Naturalismus in der Art der »fontane di natura« und moderner Landschaftsempfindung, wie sie schon zu Anfang des Jahrhunderts in Kassel-Wilhelmshöhe aufgetreten war. Über seitlich ansteigende, halb vom Wald überwachsene Treppenwege erreicht man die Quellgrotte, ein wüst zurechtgehauenes Felsentor, aus dem mit Getöse die Wassermassen des Acquedotto Carolino hervorbrechen. Die Aussicht geht über die weite und einförmige kampanische Ebene; am linken Rand des Blickfelds erscheint der in flachem Bogen ansteigende Hang des Vesuvs, rechts erstrecken sich die Phlegräischen Felder; das Meer liegt in undeutlicher Ferne. Unfehlbar stellt sich die Erinnerung an Veduten von Philipp Hackert ein, der jahrelang in Caserta gewohnt und gearbeitet hat; der Mann, der »selbst vom Golf Neapels den Zauber von Licht und Farbe hinwegzufrösteln« imstande war (Justi), hat für diese Landschaft das richtige Auge gehabt. Die Reggia, von dieser Höhe aus gesehen, verklärt sich zum Märchenschloß. Die »umgekehrte Perspektive« macht erst die gewaltigen Dimensionen des Ganzen bewußt. Die Achse des Parks läuft als sanft gewelltes Band in die Tiefe, wo der Querriegel des Schlosses, nun in voller Breite über den Bäumen sichtbar, den Blick aufhält; man sieht den Mittelweg in der Einfahrt verschwinden, dann wieder auftauchen und sich in Richtung Neapel in die Ebene verlieren. Ein feiner Wasserdunst, der von den Bassins und Kaskaden aufsteigt, hebt die Palastfassade vom Boden ab und hält Masse und Gliederungen in schwebendem Gleichgewicht; das vollkommene Regelmaß des Entwurfs triumphiert über alle Schwächen der Wirklichkeit.
Als Nachspiel und späte Variante des großen Plans entstand am O-Hang des Canalone der Englische Garten (Giardino Inglese, Eingang durch das Gittertor zur Rechten des Diana-Brunnens; auf der gegenüberliegenden Seite geht die Straße nach S. Leucio ab, das man heute nur auf dem Umweg über Caserta erreicht — s. u.).
Der Wunsch, einen Landschaftsgarten im modernsten Geschmack zu besitzen, ging auf Maria Carolina von Österreich zurück, die 1768 als Gemahlin Ferdinands IV. in Neapel eingezogen war.
Mit der Zurichtung des Terrains, der Wasserführung und der Anlage verschiedener Baulichkeiten wurde Carlo Vanvitelli beauftragt; die entscheidende Rolle aber fiel einem Botaniker namens Giovanni Andrea Graeffer zu, den man eigens aus England kommen ließ, um den seit 1752 in Caserta tätigen französ. Gartenmeister Martin Biancour zu ersetzen. Die Arbeiten begannen 1782 und setzten sich bis ins 19. Jh. fort; 1826 wurde die got. Kapelle errichtet, 1830 die Tempelraine auf der Insel des Schwanensees.
Eine Vielzahl seltener Bäume und Pflanzen aus Europa und Übersee — darunter die erste auf den Kontinent verbrachte Kamelie — gruppiert sich zwanglos um Wiesen, Blumenbeete und Steingärten; man bewegt sich auf Schlängelwegen, über Brückchen und Treppen, entlang an Weihern, Bächen und kleinen Wasserfällen. Der Anblick der kahlen und steinigen Berge, die über den Wipfeln dieses subtropischen Paradiesgartens aufsteigen, verschärft den Genuß des Wandelns im Schatten und macht zugleich das Paradoxe der Situation bewußt: Erst die schwierigste Kunstbemühung hat hier die Anlage einer »Landschaft« ermöglicht, die der Boden an sich gar nicht hergibt; was als »Rückkehr zur Natur« proklamiert wird, bedeutet in Wahrheit den äußersten Grad an Entfremdung. Die Abweichung von den englischen Mustern tritt naturgemäß zuerst im Bereich der Vegetation hervor. Das starre und düstere Immergrün des Südens — von Alexander Pope als »Nimmergrün« verspottet — verdrängt die zarte Frische nordischer Laubgewächse; an den Rändern der Lichtungen, wo das Auge freie und weite Ausblicke sucht, treten Bäume und Sträucher zum undurchdringlichen mediterranen Buschwald zusammen. Ein wahres Zauberdickicht umgibt das Bagno di Venere am oberen See, wo halb versteckt im Ufergebüsch die Statue einer kauernden Venus (nach einem bekannten antiken Typus) aufgestellt ist. Die Vereinzelung der Figur inmitten der kunstvoll erzeugten Wildnis spiegelt das neue Verhalten des Individuums zur Natur: sie will einzeln betrachtet, oder besser, belauscht werden, nicht mehr wie die Brunnenfiguren des Parks als Kulisse bewegter Geselligkeit dienen. Dahinter entdeckt man die künstliche Ruine eines halbrunden Kryptoportikus mit Retikulatmauerwerk, fingierten Resten von Marmorverkleidung und einer sehr feinen, eher renaissancemäßig anmutenden Pilaster-und Säulengliederung; die Nischenfiguren stammen aus Pompei und Herculaneum.
Die Stadt Caserta entstand erst im Gefolge der Reggia. In der Gegend des kleinen Dörfchens La Torre (wohl nach dem Turm im Bosco Vecchio) plante Karl von Bourbon die Anlage einer Residenzstadt nach dem Vorbild von Versailles; auf Vanvitellis Kupferstichen erscheinen zu seiten des Schloßplatzes lange Straßenzüge mit kasernenartig gereihten Häuserblocks, überragt von Kirchtürmen und -kuppeln. Zur Ausführung dieses Plans bot sich keine Gelegenheit mehr; dafür entwickelte sich im O des Schlosses längs der Via Appia (Corso Trieste) das heutige Städtchen, mit rechtwinklig angelegten Hauptstraßen und unregelmäßigen Nebengassen. Bis 1819 hieß der Ort Villa Reale, dann ging der Name des nahegelegenen Caserta (seitdem Caserta Vecchia) auf ihn über. Gleichzeitig wurde er zur Provinzhauptstadt erhoben und bildet seitdem das Zentrum der für ihre Fruchtbarkeit berühmten »Terra di Lavoro« (die Bezeichnung Leboriae‚ Campus Leborinus‚ wahrscheinl. von griech. lebes, Talkessel, wird von Plinius für die Gegend von Cumae gebraucht). 1842 zog der Bischof des damals schon fast verlassenen Caserta Vecchia in die neue Stadt.
Der Dom, vordem Pfarrkirche, eine klassizist.‚ 3schiffige Pfeilerbasilika mit Portikusfassade, erhielt seine jetzige Gestalt durch Pietro Bianchi (Grundsteinlegung 1822). — Die bescheidene Saalkirche S. Agostino (Via Mazzini) soll noch auf einen Entwurf Vanvitellis zurückgehen.
Die Via Mazzini mündet auf der Piazza Vanvitelli, mit einem Denkmal des Architekten von 1879. Der Palazzo della Prefettura auf der gegenüberliegenden Seite nimmt die Stelle des alten Acquaviva-Palastes ein, von dem die Geschichte der Reggia ihren Ausgang nahm.
Die Straße am O-Rand des Schloßparks (Piazza Vanvitelli-Corso Giannone — Via Tescione) biegt kurz hinter Aldifreda nach W ab und führt unter dem »Canalone« hinweg in das Dörfchen Sala. Etwa 1 km nordwestlich an der Straße nach Caiazzo liegt S. Leucio, die Einsiedelei (romitorio) König Ferdinands IV.
In der Figur des »Re Nasone«‚ wie er wegen seiner gewaltigen Hakennase genannt wurde, hatte der alte bourbonische Hang zu Jagd und Landleben einen deutlichen Stich ins Abartige angenommen. Dem zwar gutmütigen und nicht dummen, aber völlig ungebildeten Mann, der von Zeitgenossen als halber Analphabet geschildert wird, war jeder Vorwand recht, den Staatsgeschäften zu entfliehen; Er kleidete sich am liebsten als Bauer, sprach meist im Dialekt und suchte auf alle Weise mit dem Volk in Kontakt zu kommen, ja gleichsam in ihm unterzutauchen. Die Beute seiner häufigen Fischzüge am Strand von Posillipo verhökerte er unter den dort ansässigen Händlern und genoß es, dabei in wüstester
Form beschimpft zu werden; in seine Theaterloge ließ er sich Makkaroni bringen und verzehrte sie unter dem Jubel des Publikums nach Lazzaroni-Art mit den Fingern. Allein vor dem Hintergrund der sozialen und wirtschaftlichen Zustände seines Reiches, die damals schon unaufhaltsam der Katastrophe entgegentrieben, gewinnt sein Charakterbild zeittypisches Relief; als Flucht aus der Realität des sterbenden Absolutismus läßt sich auch der Modellstaat von S. Leucio verstehen, den Ferdinand im Revolutionsjahr 1789 proklamierte.
Der Monte S. Leucio heißt nach einem Bischof von Alexandrien, der im 2. Jh. in Apulien Heiden bekehrte, Wunder tat und seitdem von den Landleuten Süditaliens als Regenbringer verehrt wird. Eine diesem Heiligen geweihte Kapelle auf dem Gipfel des Berges wird 1113 zuerst erwähnt; sie scheint gegen 1700 verschwunden zu sein. Im 17. Jh. trug der aussichtsreiche Südhang einen »Belvedere« genannten Villenpalast der Fürsten von Caserta, der z. Z. Karls von Bourbon schon wieder verfallen war. Vanvitelli wollte den Bau restaurieren und in den Park von Caserta einbeziehen. Ferdinand IV. entdeckte die Eignung des Ortes als Jagdstützpunkt; 1773 ließ er ein Wildgehege anlegen, westlich oberhalb des Belvedere ein kleines Casino erbauen und gründete außerdem eine Meierei (Vaccheria — nach dem Vorbild der vacherie suisse im Petit Trianon zu Versailles), die 5 Bauernfamilien ein Auskommen bot. Dazu kam 2 Jahre später eine Seidenmanufaktur, die in kurzer Zeit zu einem prosperierenden Unternehmen aufstieg und dem ganzen Projekt eine neue Richtung gab. 1779 erhielt der Vanvitelli-Schüler Francesco Collecini den Auftrag, das alte Belvedere zur königlichen Residenz auszubauen; es sollte zugleich das Zentrum der »Ferdinandopoli« bilden, einer kleinen Idealstadt mit rundem Mittelplatz und einem Netz von Radial-und Ringstraßen mit 2geschossigen Reihenhäusern für die »coloni« (Arbeiter). Ein Abzweig des Acquedotto Carolina versorgte die Siedlung mit Wasser und diente als Antrieb für die Maschinen der Manufaktur. Ihre Produkte, insbesondere die in der vormaligen Vaccheria hergestellten Seidenstrümpfe, waren bald in ganz Italien berühmt und wurden auch im Ausland gehandelt. Seit 1843 an Privatunternehmer verpachtet, sind die Werkstätten heute noch in Betrieb (z. T. mit alten Handwebstühlen) und erzeugen v. a. Dekorationsstoffe und liturgische Paramente. Schon frühzeitig waren einzelne Techniker und Handwerker, die man vielfach erst aus Toskana, Piemont und Frankreich herbeigerufen hatte, aus dem Staatsbetrieb wieder ausgeschieden und hatten sich in der Umgebung als selbständige Meister niedergelassen; es kam zu erbitterten Konkurrenzkämpfen, die den sozialen Frieden der Zone gründlich erschütterten.
Dem König ist kaum bewußt gewesen, welche Geister er in sein stilles Refugium gerufen hatte; ihm erschien die Industrie noch als ländlich-idyllisches Gegenbild zum Getriebe der großen Stadt.
»Das Schloß von Caserta«, verkündete er 1789, »brachte uns zwar die Entfernung von der Stadt, aber noch nicht jene Stille und Einsamkeit, die zur Meditation und Entspannung des Geistes notwendig sind; es bildete vielmehr eine neue Stadt auf dem Lande, nicht weniger luxuriös als die Hauptstadt selbst. So faßte ich ebendort den Entschluß, einen verborgenen Ort aufzusuchen, der einer Einsiedelei gleichkäme, und fand dafür S. Leucio am geeignetsten.« Das Leben der »Einsiedler« sollte durch eine von dem Literaten, Philosophen und Musiker Antonio Planelli ausgearbeitete Verfassung geregelt werden. Ihr oberster Grundsatz war die »Gleichheit der Individuen, aus denen sich die Gesellschaft zusammensetzt«. So war für alle die gleiche Kleidung vorgeschrieben; die Anrede »Don« blieb nur den Priestern vorbehalten. Schul- und Berufsausbildung war Sache des Staates, für Kranken- und Altersversorgung wurden gemeinsame Kassen gebildet, an die ein Anteil des Arbeitslohns abzuführen war. Private Testamente waren ungültig, an ihre Stelle trat ein allgemeines Erbrecht, das Söhnen und Töchtern gleiche Ansprüche zubilligte. Ehen sollten nur aus freiem Willen der Partner geschlossen werden, ohne daß die Eltern dreinreden durften. Ein gewählter Gemeinderat sollte Verwaltung und Rechtsprechung ausüben, aber auch die Sauberkeit der Wohnungen kontrollieren. Für fleißige Arbeit in der Fabrik wurden Orden verliehen, welche die Sitzordnung in der Kirche bestimmten. All diese Regeln wollte der König nicht als Befehle des Souveräns an seine Untertanen verstanden wissen, sondern als Belehrungen eines Vaters an seine Kinder. »Befolgt meine Gesetze«, schloß er seinen Erlaß, »und ihr werdet glücklich sein/« Persönlich trug er dafür Sorge, daß nur kräftige und wohlgestaltete junge Leute aufgenommen wurden, aus denen eine gesunde Bevölkerung hervorgehen sollte. Er suchte Ehen zu stiften, trat als Taufpate auf und kümmerte sich angelegentlich um das leibliche Wohl seiner Schützlinge, auch der weiblichen — ein jungverheirateter Kolonist sah sich eines Tages veranlaßt, auf den König einen Flintenschuß abzufeuern, und mußte aus der Gemeinschaft entfernt werden. An die Stimmung von »Figaros Hochzeit« erinnern auch die Berichte von dem tagelang währenden Fest, mit dem im Juni 1789 der Erlaß der Verfassung gefeiert wurde. Philipp Hackert fungierte als Festleiter; Paisiellos »Nina pazza per l’amore«, für diesen Anlaß komponiert, wurde in einem hölzernen Freilichttheater am Weg zur großen Kaskade aufgeführt. Tagsüber zog man ins Freie, besuchte die Meierei und vergnügte sich bei der Heuernte; abends gab es Bankette, einen großen Ball in den Sälen des Belvedere und Tanz für das Volk im festlich erleuchteten Hof. Ferdinands Gemahlin Maria Carolina fand in ihrem Alkoven eine »jolie toilette tout pour le deshabiller« und ging »tout enchantée« zu Bett.
Auch in der Architektur herrscht der Eindruck des Heiter-
Festlichen vor. Zwar hat Collecini, als getreuer Schüler Vanvitellis, sich aller Schnörkel enthalten, doch ist vom moralisch getönten Ernst des Klassizismus oder der Revolutionsarchitektur nichts zu spüren; wir bewegen uns immer noch in der Kulissenwelt des Ancien régime, aus der mit landesväterlichem Wohlwollen das Auge des Monarchen auf uns herabschaut.
Von der Siedlung ist nur ein kleiner Teil verwirklicht worden. Die Hauptstraße zwischen den beiden Wohnvierteln (Quartieri S. Carlo und S. Ferdinando) steigt in gerader Linie zum Schloßplatz auf. Die Fassade des Belvedere (heute Palazzo dello Stabilimento Serico) erhebt sich über einer weitausgreifenden Rampen- und Treppenanlage. Der ungegliederte Sockel trägt eine Ordnung aus ionischen Kolossalpilastern, welche die beiden Hauptgeschosse zusammenfaßt. Den trockenen Gleichtakt der 9 Fassadenachsen hat Collecini durch rhythmischen Wechsel der Fensterformen zu beleben gesucht; die mittleren 3 Achsen bilden ein flaches Risalit, darüber erscheint ein Giebel mit der unvermeidlichen Uhr. Flankierende Terrassengärten mit Palmen und Marmorbrunnen betonen den Villencharakter. Hinter dem Fassadentrakt liegt ein in die Tiefe gestreckter Hof mit Pfeilerportiken und Lisenengliederung; im rückwärtigen Flügel wiederholt sich die große Pilasterordnung der Eingangsfassade mit reicherer und freierer Risalitbildung; Collecini war hier unabhängig von der Disposition des Vorgängerbaus. Die Statue des Königs im Mittelbogen des Obergeschosses stammt von Antonio Sancio (1824). — Das Innere wurde mehrfach umgebaut, im 2. Weltkrieg beschädigt und bietet kaum noch Sehenswertes (in einem Saal des Erdgeschosses Fresken von Fischetti, oben einige Spuren des königlichen Appartements).
Die östlich vom Vorplatz abzweigende Straße führt zwischen Gärten und Agrumenhainen in ein waldiges Tal oberhalb von Briano, das ehemals zum Park von Caserta gehörte. Hier erbaute sich Ferdinand zwischen 1789 und 1801 ein neues Refugium, das Casino S. Silvestro. Das bescheidene Landhaus in Hufeisenform enthielt ein paar Wohnzimmer und eine Schäferei, ringsum lagen Gärten, Weinberge und Obstplantagen, auf den Hügeln Jagdhütten und ein offener Eßplatz, wo der König im Kreis der Landleute zu speisen pflegte.
Die Straße nach W führt hinauf zur Vaccheria. Im Grunde des von niedrigen Wirtschafts-und Fabrikgebäuden umgebenen Platzes erhebt sich die 1801-05 von Collecini und
seinem Schüler Patturelli erbaute Kirche S. Maria delle Grazie, ein feiner Kuppelzentralbau in der Art der Vanvitelli-Nachfolge mit einer sehr sonderbaren spitzbogigen 2-Turm-Fassade, wohl das früheste Denkmal der Neugotik in Süditalien, eher von einheimischen (angiovinischen) als von englisch-romantischen Vorbildern angeregt. Auf der Höhe das Casino Ferdinands von 1773.
Zu den Ausflügen, die der König von S. Leucio aus zu unternehmen pflegte, zählte die Fahrt zum Casino Reale von Carditello in der Ebene zwischen Capua und Aversa (Einfahrt von der Straße Capua — Castel Volturno, 4,3 km westlich von Capua).
Karl von Bourbon hatte hier 1745 einen »sito reale« gegründet; sein Hauptzweck war neben der Jagd die Aufzucht von Rassepferden und von Rindern und Büffeln, die noch heute in riesigen Herden die Ebene bevölkern. Nachdem unter Karl nur ein einfaches »castello« erbaut worden war, erteilte Ferdinand IV. 1787 Francesco Collecini den Auftrag Zur Errichtung eines weitläufigen Landgutes mit Villenpalast und Garten.
Die heute ganz verwahrloste Anlage gibt von den Fähigkeiten des kaum bekannten Vanvitelli-Schülers einen unerwartet günstigen Begriff; nicht leicht tritt ein Stil im Moment seines Ausklingens mit so viel Kraft und Sicherheit auf wie hier der bourbonische Spätbarock. Die 1geschossigen Wirtschaftsflügel gruppieren sich in Hufeisenform um einen Gartenhof von ca. 300 m Durchmesser; sie werden durch ein Pavillonsystem rhythmisiert, wie man es ähnlich bei den großen Villengütern der Terraferma von Venedig findet. Im Zentrum erhebt sich der Hauptpalast mit 2 Vollgeschossen und einem Belvedere, gegliedert durch Quaderputz mit kräftig ausgearbeiteten Vertikalakzenten. — Im Inneren 2 symmetrisch angeordnete Treppen, Reste von schönen Stuck-und Marmordekorationen und Fresken von Hackert, Kniep, Chelli und Fischetti. — Die sehr interessante Kapelle hat eine Zentralkuppel auf Wandpfeilern und 8 ionischen Marmorsäulen; am Altar eine Himmelfahrt von Brunelli.
In der Mittelachse des völlig verwilderten Gartenparterres steht ein runder Tempietto, seitlich 2 große, von Obelisken bekrönte Brunnenanlagen.
Anhang
Die Erläuterungen der Fachausdrücke sind auf der Grundlage eines von Herrn Dr. Lutz Heusinger erarbeiteten Verzeichnisses von Herrn Dr. Thuri Lorenz unter spezieller Berücksichtigung der archäologischen Monumente erweitert worden.
Abfasung. Abschrägung von eckigen Bauteilen.
Ädikula (lat. aedicula = Tempelchen, Häuschen). Rahmender architektonischer Aufbau um Portale, Fenster, Reliefs oder Gemälde.
Akanthus. Distelähnliche Pflanze. Die Form ihrer gezackten oder gelappten Blätter findet sich an korinthischen Kapitellen. Seit der Antike vielfach verwendetes und abgewandeltes Ornamentmotiv. Akroter (griech. = äußerste Spitze). Von der antiken Baukunst übernommenes Zierglied auf der Spitze oder an den Ecken eines Giebels. In der deutschen Renaissance mit Roll- oder Beschlagwerk, Obelisken oder figürlicher Plastik bereichert.
Alveus (lat.). Der vertiefte Wasserbehälter in den Bädern.
Ambo (griech.). Niedriges, kanzelartiges, um mehrere Stufen erhöhtes Lesepult an oder vor den Chorschranken. Aus dem A. entwickelt sich die Kanzel.
Amphora (griech.). Zweihenkeliges‚ bauchiges Vorratsgefäß.
Antependium (lat. antependere = davorhängen). Bekleidung der Altarvorderseite, aus gesticktem Stoff, als Treibarbeit, auch gemalt, geschnitzt oder als Einlegearbeit.
antikisch. Das von Antike genommene Adjektiv drückt die Absicht einer mehr oder minder engen Nachahmung antiker Formen aus Naivität der Nachahmung, die den eigenen Zeitstil nicht ausschließt, kennzeichnet den Begriff.
Apodyterium (griech.). Das Auskleidezimmer im Bade.
Apsis (griech. : Bogenrundung). Die das Ende des Chores oder der Seitenschiffe bildende Altarnische über urspr. halbrundem, später auch polygonalem Grundriß.
Aquamanile (lat. aqua = Wasser; manus = Hand). Gießgefäß, aus dem bei liturgischen Handlungen das Wasser auf die Hände des Priesters gegossen wird. Im Mittelalter meist aus Buntmetall hergestellt und oft in Tierform oder als Fabelwesen ausgebildet.
Arabeske (it. arabesco, rabesco). Ein wohl aus der Kunst des Islam stammendes Ornament aus feingliedrigem Blatt- und Rankenwerk, das den jeweiligen pflanzlichen Vorbildern sehr nahekommt; es tritt um die Mitte des 16. Jh. in Deutschland auf; häufig sind Masken und Putten eingefügt.
Architrav. Der waagerechte Steinbalken über Säulen, Pfeilern oder Pilastern in der antiken und der von ihr abhängigen Architektur.
Archivolte. Rahmenleiste an der Stirnseite eines Bogens oder die (meist plastische) Innengliederung einer Bogenlaibung.
Arkade (lat. arcus = Bogen). Bogenstellung, d.h. ein Bogen über Säulen oder Pfeilern. Das Wort A. bezeichnet auch die fortlaufende Reihe solcher Bogenstellungen.
Arma Christi (lat. arma = Waffen). Die Passionswerkzeuge Christi (Kreuz, Geißelsäule, Dornenkrone, Nägel, Essigschwamm etc.), meist um die Gestalt des Schmerzensmannes angeordnet, beliebte Darstellung im Spätmittelalter.
Aryballos (griech.). Bauchiges Ölgefäß mit enger Mündung, scheibenförmigem Mündungsrand und Henkel.
Atlant. Nach dem Riesen Atlas der griech. Sage, der das Himmelsgewölbe trägt, menschlich (männlich) gebildeter, scheinbarer oder wirklicher Träger eines Architekturteiles. Weibliche Entsprechung ist die Karyatide.
Atrium. 1. Offener Hauptraum des altröm. Hauses. — 2. Vorhof einer Basilika mit Säulenhallen an 3 Seiten und einem Brunnen in der Mitte, auch Paradies genannt.
Attika. Mehr oder minder reich gegliederte brüstungsartige Aufmauerung über dem Hauptgesims eines Bauwerks.
Attisches Profil. Folge von Baugliedern, v. a. an Basen, aber auch an Kämpfern und Gesimsen. Sie besteht aus 2 Wülsten, meist unterschiedlicher Größe, die durch eine Kehle getrennt werden.
Baldachin. Urspr. ein kostbarer Stoff, dann der daraus gefertigte Prunkhimmel über einem Thron oder Bischofsstuhl, auch der Traghimmel bei Prozessionen. In Stein — oder auch Holz — umgesetzt als Auszeichnung über einem Altar (vgl. Ciborium) oder einem Grabmal, in verkleinerter Form als luftiges Gehäuse für Figuren an got. Strebepfeilern (vgl. Tabernakel) oder nur als krönender Überfang einer Einzel- bzw. einer Gewändefigur got. Kirchenportale. Die Bezeichnungen schwanken: z. B. Altartabernakel
Baluster (it. balaustro). Niedriges, profiliertes, oft auch ausgeschwungenes Säulchen oder Vierkantpfosten aus Holz oder Naturstein als Träger eines Geländers oder Handlaufs und mit diesem Zusammen als Balustrade bezeichnet. Der deutsche Name für B. lautet Docke, der vom Französ.-Niederländischen abgeleitete heißt Tralje.
Baptisterium. Taufkirche, als Zentralbau stets einer Bischofskirche zugeordnet, aus dem Frühchristentum herkommend.
Basilika (griech. : Königshalle). Die röm. B., Markt- und Gerichtshalle, ist eine flachgedeckte Säulenhalle mit 3 oder mehr Schiffen. Längsrichtung und Höhenstufung der Schiffe, wobei das Mittelschiff sein Licht von der über den Seitenschiffdächern aufsteigenden Fensterzone, dem Lichtgaden, empfängt, sind die Wesensmerkmale der B., die in ihren zahlreichen Abwandlungen zum wichtigsten Typ des christlichen Kultbaus wurde.
Basis. Der ausladende, meist profilierte Fuß einer Säule oder eines Pfeilers, um den Druck der Stütze auf eine größere Grundfläche zu verteilen.
Birnstab. Stabartiges Bauglied der Gotik (Dienst, Gewölberippe) mit birnförmigem Querschnitt.
Blende. Das einem Baukörper eingefügte, der Dekoration und Gliederung dienende »blinde« architektonische Motiv, das nicht räumlich vorhanden ist, z. B. ein Blendfenster oder eine Blendarkade.
Bogen. Die gedrückte oder elliptische Form des Rundb. heißt Korbb. Der Segmentb. (auch Flach- oder Stichb. genannt) entsteht aus dem flachen Segment eines Kreises, dessen Durchmesser größer ist als die Weite der zu überspannenden Öffnung. Der Kleeblattb. zeigt durch Zusammenfügen eines mittleren Dreiviertel- und zweier Halbkreise die Form eines regelmäßigen Kleeblatts. Der Hufeisenb. entsteht durch Einziehung der B.-Schenkel. Die bes. Form des Spitzb. mit engen steilen Schenkeln wird Lanzettb. genannt. Beim Eselsrücken, bes. bei dem weich schwingenden Kielb., sind die B.-Schenkel S-förmig. Beim Vorhangb. liegen die Mittelpunkte der kreissegmentförmigen Schenkel oder ihrer einzelnen Abschnitte außerhalb des B.; sie wirken daher wie hängende Drapierungen.
Bossenquader, Buckelquader => Quader.
Bündelpfeiler. In der got. Baukunst ein Kernpfeiler mit ringsherum gruppierten kleinen und großen Dreiviertelsäulen, sog. jungen und alten Diensten. In der Hochgotik wird diese Gruppierung so verdichtet, daß der Kernpfeiler unsichtbar wird.
Caldarium (lat.). Der warme Raum im röm. Bad.
Cardo (aus dem Griech.). Wendepunkt, Pol, von da die auf den Äckern von S nach N gezogene Linie — in der Archäologie auch die von S nach N verlaufenden Straßen in regelmäßig angelegten röm. Städten.
Chor (griech. =Tanz, Tanzplatz). Urspr. Raum für den Chorgesang der Geistlichen, seit dem 15. Jh. übliche Bezeichnung für den Altarraum und seine Annexe.
Chronogramm. Inschrift mit einzelnen durch Größe oder Farbe gekennzeichneten römischen Buchstaben, die als Ziffern zu verstehen sind und zusammengezählt eine bestimmte Jahreszahl ergeben.
Ciborium (lat. cibus = Speise). Der steinerne, auf Säulen oder Pfeiler gesetzte Altarbaldachin mit flacher Decke oder Gewölbe und entsprechender Verdachung. An ihm hing das Gefäß mit dem eucharistischen Brot. Häufig im frühmittelalterl. Italien. In Deutschland nur vereinzelt. Als C. wird seit dem späten Mittelalter auch der Wandtabernakel (Sakramentsnische) bezeichnet und das seit dem 13. Jh. dem Meßkelch nachgebildete und mit Deckel versehene Gefäß aus Edelmetall zur Aufbewahrung des eucharistischen Brotes.
Cista (mystica). »Korb«, in dem die geheimgehaltenen, heiligen Symbole mancher Mysterienkulte aufbewahrt wurden, v. a. für die des Dionysos und der Demeter.
Compluvium (lat.). Die von den Dächern eingeschlossene obere Öffnung, durch die das Regenwasser in das Atrium fiel.
Concordia (lat.). Die als göttlich verehrte »Eintracht«.
Confessio (lat.). Das unter dem Hochaltar einer Kirche angelegte Grab eines Märtyrers, des Kirchengründers oder Titelheiligen. Seit dem 8. Jh. meist von einem halbkreisförmigen Gang umzogen, der eine direkte Verehrung ermöglichte. Die C. ist die Vorform der mittelalterl. Krypta.
Corps de logis. Mittelbau einer barocken Schloßanlage, in größeren Dimensionen und oft mit reicherer Fassadenzier als die übrigen Trakte, für Repräsentationsräume und das Treppenhaus vorgesehen.
Cubiculum (lat.). Das Zimmer zum Liegen, Schlaf- und Wohnzimmer.
Dach. Die wichtigsten D.-Formen sind: Satteld., bestehend aus 2 schrägen, gegeneinander geneigten und im First zusammenstoßenden D.-Flächen, die an ihren Enden durch Giebel begrenzt werden. Sind bei rechteckigen Gebäuden auch die Giebelseiten mit schrägen D.-Flächen versehen, so ist ein Walmd. gegeben; die D.-Flächen der Schmalseiten anstelle der Giebel heißen Walme; die Traufkante umzieht das ganze Gebäude. Bei gleicher Ausführung über quadratischem Grundriß treffen alle 4 D.-Flächen in einem Punkt zusammen; es entsteht das Zeltd., das bei steilem Neigungswinkel der D.-Flächen als Turmd. (Helm) beliebt ist. Wird der Walm bei Dächern über rechteckigem Grundriß nicht bis zur Traufkante herabgeführt, so daß noch ein Giebelrest erhalten bleibt, entsteht das Krüppelwalmd. Beim Mansardd. werden die D.-Flächen gebrochen, um eine günstigere Ausnützung des D.-Raumes für Wohnzwecke zu erreichen. Diese seit dem ausgehenden 17. Jh. bekannte D.-Form leitet ihren Namen von dem französ. Baumeister Francois Mansart ab, der sie jedoch nicht erfunden hat.
Dachreiter. Dem Dachfirst meist über der Vierung aufsitzendes Türmchen zur Aufnahme einer Glocke, von den Zisterziensern und Bettelorden anstelle eines aufwendigen Turmes verwendet, seit dem späteren Mittelalter auch bei profanen Bauten gebräuchlich.
Decumanus (lat.). Die auf den Äckern von W nach O gezogene Grenzlinie — in der Archäologie auch die von W nach O verlaufenden Straßen in regelmäßig angelegten röm. Städten. — D. Maximus = Hauptstraße.
Deesis. Darstellung des im Jüngsten Gericht thronenden Christus, bei der Maria und Johannes d. T. zu seinen Füßen knien und für die Auferstandenen bitten.
Diamantquader => Quader.
diaphan. Durchscheinend, aber nicht durchsichtig.
Dienst. Der einer Wand oder Pfeilern vorgelegte Rundstab zur Aufnahme der Rippen, Gurte und Schildbögen des in der Gotik üb-
lichen Kreuzrippengewölbes. Die stärkeren D. bezeichnet man als die alten, die dünneren als die jungen. (Vgl. a. Bündelpfeiler.)
Dom (lat. domus = Haus). Bischofskirche.
Domikalgewölbe => Gewölbe.
Donjon. Bergfried oder wehrhafter Wohnturm einer Burg.
dorisch => Säulenordnungen.
Dorment, Dormitorium. Schlafraum der Mönche im Kloster.
Dorsale. Rückwand des Chorgestühls, häufig reich gegliedert und geschmückt.
Ebenist. Ebenholzarbeiter, im allgemeineren Sinne Kunsttischler, bes. des 17. und 18. Jh., der Möbel mit Ebenholz-, aber auch mit anderen Einlagen anfertigte.
Echinos (griech.). Runder, wulstartiger Teil des Kapitells der dorischen Säule.
Eckblatt (-knolle‚ -sporn). Blattartige Verzierung an den 4 Ecken der Säulenbasis, die den zwischen dieser und der quadratischen Fußplatte (Plinthe) vorhandenen Zwickel ausfüllt. Diese Ecklösung beginnt mit der Wende des 11. zum 12. Jh. Email. Im Feuer auf einen (Metall-)Träger aufgeschmolzene, durch Metalloxyde gefärbte, meist durchscheinende Glasmasse. Beim Grubenschmelz wird die Glasmasse in den vertieften Grund eingesenkt; beim Zellenschmelz werden auf die Metallplatte hochkant stehende Stege als Umrißzeichnung aufgelötet. Beim Gold-E. ist Gold als Träger und für die Stege verwendet.
Entasis (griech.). Schwellung des Säulenschafts.
Epistelseite. Die vom Hochaltar linke, südl. Kirchenseite, auf der die Episteln verlesen wurden, auch Männerseite genannt. Das Gegenstück ist die Evangelien- oder Frauenseite.
Epitaph. Gedächtnismal mit Inschrift und meist bildlicher Darstellung an Wand oder Pfeiler.
Exedra (griech.). Nach einer Seite hin offener Raum mit Sitzbänken.
Fächergewölbe => Gewölbe.
Fassung. Die in der Regel auf eine Grundierung aufgetragene Bemalung von Skulpturen aus Holz oder auch Stein, aber auch der Architektur.
Fauces (lat. = Schlund). Eingang des röm. Hauses.
Feston. Schon in der Antike verwendete Ornamentgirlande aus Blumen, Laub und. Früchten. Später häufig in barocker Stuckdekoration. Auch Fruchtgehänge genannt.
Fiale. Schlankes spitzes Türmchen als Zierglied der got. Baukunst.
Fischblase. Fischblasenförmiges Ornament, das im spätgot. Maßwerk häufig vorkommt. Seine asymmetrischen und geschwungenen Formen — in Frankreich als Flamboyant bezeichnet — stehen im Gegensatz zu den strengen geometrischen Motiven des hochgot. Maßwerks.
Fortuna Redux (lat. = zurückführendes Glück). Ein Altar der F. R. wurde i. J. 19 v. Chr. an der Porta Capena in Rom errichtet als
Zeichen der Freude über die Rückkehr des Augustus nach langer Abwesenheit.
Fresko (it. al fresco : frisch). Auf den feuchten Putz (»al fresco«) aufgetragenes Gemälde, das durch gleichzeitiges Abbinden und Eintrocknen von Putz und Erdfarben besonders haltbar ist. Gegenteil: al secco, die Malerei auf der trockenen Wand. Eine Mischtechnik wird als Fresco-Secco-Malerei bezeichnet; sie ist im frühen und hohen Mittelalter vorherrschend.
Frigidarium (lat.). Der Kühlraum im röm. Bade.
Frontispiz. Der mittlere Teil einer Fassade, meist leicht vorgezogen und mit Giebel abgeschlossen.
Gaden, Fenstergaden, Obergaden. Obergeschoß einer architektonischen Wandgliederung, V. a. der überhöhte Teil des Mittelschiffs in der Basilika.
Gaube (Gaupe). Dachausbau mit Walm oder Giebel zur Belichtung und Belüftung des Dachraumes. In der Renaissance oft reich verziert und im Barock vielfach unter der elegant vorgeschwungenen Dachhaut als sog. Fledermausg. ausgeführt. Daneben gibt es noch seit dem Mittelalter bei Steildächern die Schleppg., bei derdie Dachhaut über der niedrigen Fensteröffnung gleichsam emporgehoben und von der Fensterwand unterstützt wird.
Gebundenes System. Die für alle Teile des Grundrisses einer roman. 3schiffigen Basilika verbindliche Maßeinheit ist durch das Vierungsquadrat festgelegt, das, nach O wiederholt, das Chorquadrat, nach N und S die Querhausarme ergibt. Den Mittelschiffjochen des Langhauses liegt ebenfalls diese Maßeinheit zugrunde. Die Seitenschiffe haben halbe Breite des Mittelschiffs, so daß jedem quadratischen Gewölbe eines Mittelschiffjoches je 2 kleinere Gewölbequadrate von halber Seitenlänge in beiden Seitenschiffen entsprechen und stark belastete Hauptpfeiler mit schwächeren Zwischenpfeilern wechseln, die nur die Last der Seitenschiffgewölbe aufnehmen. Seit Anfang des 13. Jh. werden zuweilen die Mittelschiffgewölbe in 6 Kappen unterteilt, wodurch die Mittelschiffstützen in gleicher Stärke wie die Zwischenpfeiler ausgebildet sind, da alle statisch einheitlich beansprucht werden.
Gesprenge. Meist hoher Aufbau über spätgot. Altaraufsätzen, aus zierlichen Architekturgliedern wie Tabernakeln und Fialen errichtet.
Gewände. Die durch schrägen Einschnitt eines Fensters oder Portals in der Mauer entstehenden Schnittflächen, die oft reich aufgegliedert und bei got. Portalen, bes. der französ. Kathedralen, mit Gewändefiguren besetzt wurden. Bei rechtwinkligem Einschnitt ist die Bezeichnung Laibung gebräuchlich.
Gewölbe. Die grundlegende Wölbform ist das Tonneng. Sein Querschnitt kann einen Halbkreis, einen Segmentbogen, Korb- oder Spitzbogen bilden. Wird ein über quadratischem Grundriß erstelltes Tonneng. mit Halbkreisquerschnitt durch 2 Diagonalschnitte in 4 Teile zerlegt, so entstehen 2 Wangenstücke und 2
Kappenstücke. Durch Zusammensetzen von 4 Wangenstücken wird das Klosterg. gebildet, bei dem am Zusammenstoß der Wangen kein Grat, sondern eine zurückspringende Kehllinie vorhanden ist. Werden bei einem Klosterg. 2 gegenüberliegende Wangen auseinandergezogen, so daß statt des Firstpunktes eine Firstlinie entsteht, spricht man von einem Muldeng. Es kann aber auch durch Einfügen einer Wange an beiden Schmalseiten eines Tonneng. auf Rechteckgrundriß gebildet werden. Wird dagegen der Grundriß eines Klosterg. nach beiden Seiten verbreitert, so entsteht statt der Firstlinie eine horizontale Fläche, die, Spiegel genannt, der nun entstehenden Wölbform den Namen gibt. Tonnenstreifen kleinen Querschnitts, die sich rechtwinklig mit dem Tonneng. durchdringen, führen zur Bildung der sog. Stichkappentonne, die dort bevorzugt wird, wo auf die Anbringung hoher Fenster bei tonnengewölbten Räumen nicht verzichtet werden soll. Durch Zusammensetzen von 4 Kappenstücken entsteht das Kreuzg., das man geometrisch auch aus der rechtwinkligen Durchdringung von 2 Tonneng. gleichen Querschnitts ableiten kann (Kreuztonneng.). Die Durchdringungslinien heißen Grate; daher ist auch die Bezeichnung Kreuzgratg. üblich. Treten an die Stelle der Grate Rippen, so können die Kappen in einem gesonderten Bauvorgang dünnwandiger ausgeführt werden; es entsteht das Kreuzrippeng. Der Gewölbeschub wird hier wie beim Kreuzg. auf 4 Stützpunkte abgeleitet. Werden die Rippen nicht mehr durchgehend angeordnet, sondern sternartig verzweigt, so entsteht das in der Spätgotik beliebte Sterng. Beim Fächerg. streben die Rippen von einer Stütze allseits fächerförmig empor. Beim Stern- und Fächerg. bleibt im Gegensatz zum Netzg. aber die Jochfolge gewahrt. Dort überziehen die Rippen netzartig eine aus dem Halbkreis oder Spitzbogenquerschnitt entwickelte tonnenartige Wölbschale. — Eine Weiterentwicklung des Kreuzg. stellt das mit 6 oder meist 8 Rippen unterlegte Domikalg. dar, bei dem vorwiegend über quadratischem Jochfeld die einzelnen G.-Kappen stark ansteigen und gebust sind, daher in der Regel keine geometrisch reine Form mehr darstellen. Optisch entsteht der Eindruck eines kuppelartigen Raumabschlusses. Technisch wurden die Kappen gern in ringförmiger Mauerung gewölbt und die Rippen ohne Verband vorgeblendet.
Gorgo, Gorgonen. Töchter des Phorkys und der Keto, gräßliche Ungeheuer mit Schlangen im Haar. Der Singular Gorgo bezeichnet meist die Sterbliche von ihnen, Medusa. Ihr schlägt Perseus, der sie nur im Spiegel anschaut, das Haupt ab, das er der Göttin Athena übergibt. Auf ihrem Schild als Gorgoneion, von diesen Darstellungen angeregt, wird es später ein dekoratives Motiv.
Grisaille. In verschiedenen Abstufungen einer einzigen Farbe (grau in grau) gehaltene Malerei.
Groteske (it. grottesco). Ornament aus dünnem Rankenwerk, in
das phantastische Menschen- und Tiergestalten, Blumen und Früchte, Trophäen und Architekturelemente eingefügt sind. Gegen Ende des 15. Jh. in unterirdischen Räumen, sog. Grotten, antiker röm. Gebäude wiederentdeckt und künstlerisch neu ### be.
Grubenschmelz => Email.
Gurt. Kräftiger, rechtwinklig vortretender oder profilierter Bogen zwischen benachbarten Gewölben, der die einzelnen Raumabschnitte, die Joche, voneinander scheidet.
Hades (griech.). Unterwelt — Gott der Unterwelt.
Hallenkirche. Eine mehr-, meist 3schiffige Kirche, deren Gewölbekämpfer in gleicher Höhe liegen. Meist mit einheitlichem Satteldach, bisweilen solches über jedem Schiff. Das Mittelschiff empfängt sein Licht nicht mehr wie bei der Basilika direkt durch einen eigenen Fenstergaden, sondern indirekt von den Fenstern der Seitenschiffe. Liegen die Gewölbescheitel annähernd in einer Ebene, so ist die echte H. gegeben; sind sie im Mittelschiff hinaufgeschoben, ist die Bezeichnung Staffelkirche oder Stufenballe üblich. Zuweilen kann die Höhe der Mittelschiffgewölbe gegenüber denjenigen der Seitenschiffe so beträchtlich sein (Stutzbasilika), daß eine basilikale Dachbildung erforderlich wird (Pseudobasilika). — Bei der reduzierten H. entfällt das auf der Klosterseite gelegene Seitenschiff; der Kreuzgang schließt außen direkt an das Mittelschiff an (seit Ende des 13. Jh., im 15. Jh. auch von Pfarrkirchen übernommen). Im Gegensatz zu dieser asymmetrischen Grundrißgliederung stehen symmetrische 2schiffige Hallenkirchen.
Hängezwickel = Pendentif (=> Kuppel).
Hellenismus. Von J. G. Droysen geprägter und seit 1836 bekannter Begriff für den Zeitraum, »der aus dem Griechentum zum Christentum hinüberführt«‚ zwischen Alexander d. Gr. und Augustus (ca. 330-30 v. Chr.).
Herme. Büste auf 4kantigem, hohem Sockel, urspr. wohl der Hermes-Darstellung vorbehalten, später auch für die anderer Götter und würdiger Menschen. H.-Säulen oder -Pilaster sind stützende oder auch nur schmückende Architekturglieder.
Hieroglyphen (griech.). Altägypt. Bilderschrift.
Hippokamp (griech.). Seepferd.
historisieren. Nachahmen eines historischen Stils.
historizistisch. Formalistisches Wiederaufnehmen historischer Stile; vgl. das Gegensatzpaar klassisch — klassizistisch.
Hufeisenbogen => Bogen.
Hydria (griech. = Wassergefäß). Kannenartiges Gefäß mit runder Mündung, einem Vertikal- und zwei Horizontalhenkeln.
Hypokaustum (griech.-lat.). Vorrichtung für die Warmluftbeheizung von Fußböden und Wänden.
Impluvium (lat.). Sammelbecken für Regenwasser unterhalb des Compluviums (vgl. d.) im Atrium des röm. Hauses.
Inkrustation. Bekleiden von Mauern und Wänden mit Steinplatten (z. B. Marmor), auch Einlegearbeiten in Stein, mit denen ein farbiger Schmuck von Flächen erzielt wird.
Insula (lat.). Von Straßen eingefaßter Häuserblock in der röm. Stadt.
Intarsia. Eingelegte Arbeit zur Verzierung in Holz, Stein, Stuck (Scagliola), Elfenbein und anderen Werkstoffen. Höhepunkt dieser Technik im 16. und 17. Jh. Intercolumnium (lat.). Lichter Abstand (Zwischenraum) zwischen 2 Säulen.
ionisch => Säulenordnungen.
ithyphallisch (griech.). Mit aufgerichtetem Phallos.
Joch. Die Gewölbeeinheit innerhalb einer Folge derartiger Einheiten sowie der dadurch bestimmte Raumabschnitt. Auch der von Pfeiler zu Pfeiler begrenzte Abschnitt einer Brücke.
Kaffgesims. In der Gotik übliches, oben abgeschrägtes Gesims, das unterhalb der Fensterzone horizontal verläuft und um die Strebepfeiler gekröpft sein kann, zuweilen auch an den Absätzen der Strebepfeiler angebracht.
Kalotte (frz. = Käppchen). Kuppelform, die mittels eines horizontal geführten Schnittes durch eine Kugel oberhalb ihres Großkreises (= Äquator) entsteht. Auch Bezeichnung für eine geviertelte Kugel als Wölbung über einer Apsis auf Halbkreisgrundriß.
Kämpfer. Die abschließende Platte eines Pfeilers, einer Säule oder eines Dienstes, die als Auflager für Bogen oder Gewölbe dient.
Kantensäulen. In die Außenkante einer Wand oder eines Pfeilers eingelegter Rundstab, der dekorative, nicht tragende Funktion hat (im Gegensatz zum Dienst), vorwiegend 12. und 13. Jh. Kantharos (griech.). Trinkbecher mit hochgezogenen Henkeln und abgesetztem Fuß, Gefäß des Dionysos.
Kapitell. Zu den antiken Kapitellformen vgl. »Säulenordnungen«. Die wichtigsten späteren K. sind: Würfelk., entstehend aus der Durchdringung von Kugel und Würfel; dieses K. vermittelt ideal zwischen der runden Säule und der kubischen Last. Das Kelchk. ist als eine kelchartige Erweiterung der Säule zu begreifen. Beim Knospenk. (auch Knollenk.) ist der K.-Kelch von aufsteigenden Blättern umhüllt, die an den Ecken knospend eingerollt sind.
Kapitelsaal. Raum für die täglichen Zusammenkünfte der Klosterbrüder, in der Regel hallenartig und an der O-Seite des Kreuzgangs gelegen. Im K. finden außer Lesungen aus der Schrift oder Ordensregel Beratungen über Arbeiten und Vorgänge im Kloster statt.
Kappe. Das durch Grate oder Rippen ausgesonderte Teilstück eines Gewölbes (vgl. auch Gewölbe).
Kartusche. Aus dem Wappenfeld entwickelte (barocke) Flächendekoration, bei der die Betonung nicht auf dem inneren Feld, sondern auf dem Rahmen liegt, der meist aus Rollwerk, später auch aus Rocaillen oder ähnlichen Schmuckformen gebildet wird.
Karyatide => Atlant.
Kassettendecke. Eine flache oder gewölbte Decke mit gleichmäßig oder rhythmisch verteilten, zugleich vertieften Feldern, die quadratisch, rechteckig, polygonal oder rund sein können und Kassetten genannt werden. Sie können bemalt oder mit Reliefs versehen, ihre Wandungen profiliert sein.
Kathedrale. Bezeichnung für Bischofskirchen (von dem Sitz des Bischofs, der »Kathedra«, abgeleitet).
Kenotaph (griech. = leeres Grab). Grabdenkmal in Gestalt einer Tumba oder eines Sarkophags.
Kentaur (griech.). Mischwesen aus Mensch und Pferd.
Kielbogen => Bogen.
Kithara (griech.). Griech. Saiteninstrument, wird mit dem Plektron geschlagen.
Klangarkade, Schallarkade. Arkadenförmige Schallöffnung im Glockengeschoß eines Turmes.
Klausur (lat. claudere = einschließen). Der ausschließlich den Klosterinsassen vorbehaltene Bezirk der Klosteranlage, zu dem Fremden allgemein kein Zutritt gewährt wird.
Kleeblattbogen => Bogen.
Klostergewölbe => Gewölbe.
Knorpelwerk. Ornament des 17. Jh., das aus knorpelartigen, verschlungenen Gebilden besteht, meist symmetrisch als Rahmung oder Füllung entwickelt.
Kolonnade. Säulengang mit horizontal abschließendem Gebälk als selbständiges Bauwerk oder im Anschluß an ein Gebäude. Im Barock und Klassizismus als städtebauliches Element besonders beliebt.
Kompositkapitell => Säulenordnungen.
Konche. Das (griech.) Wort (Muschel bedeutend) meint zunächst die Kuppelschale der Apsis, dann, übertragen, diese selbst. »Dreikonchenchöre« entstehen bei einer kreuzförmigen Basilika, deren Querhausarme in ihren Abmessungen dem O-Chor angeglichen sind und auch in Apsiden endigen. Grundrißlich ergibt sich die Form eines regelmäßigen Kleeblatts.
Konsole. Ein aus der Mauer hervortretender Tragstein für Bögen, Gesimse, Figuren usw.
korinthisch => Säulenordnungen.
Kothurn (griech.). Hochgeschnürter, verzierter Theaterschuh.
Krabbe (Kriechblume). Blattornament der Gotik, das an den Kanten Von Turmhelmen, Giebeln, Wimpergen, Fialen angebracht ist.
Krater (griech.). Gefäß zum Mischen von Wein und Wasser; in verschiedenen Formen. Mit Voluten an den Henkeln => Volutenkr.
Kreuzgewölbe, Kreuzgratgewölbe, Kreuzrippengewölbe, Kreuztonnengewölbe => Gewölbe.
Krotalen (griech.). Handklapper — häufig bei Satyrn und Mänaden im Gefolge des Dionysos.
Krypta. Unterkirche, aus der Confessio entwickelt (vgl. d.).
Kuppel (it. cupola). Grundformen sind die Stutzk. und die Pendentif- oder Zwickelk., die beide meist über quadratischem Grundriß gewölbt sind. Die Stutzk. wird durch eine Halbkugel über eingeschriebenem Quadrat gebildet, bei der durch Vertikalschnitte die außerhalb des Quadrats liegenden Kugelsegmente entfernt sind. Bei der Pendentifk. bleibt dagegen die Halbkugel unberührt und der Übergang von ihrem Grundkreis zu den Ecken des hier umschriebenen Quadrats erfolgt durch sphärische Dreiecke, sog. Pendentifs. Durch Einschiebung eines Kreiszylinders, eines sog. Tambours, zwischen Pendentifs und Halbkugel entsteht die seit der Renaissance beliebte Tambourk. Der Scheitel jeder K. kann kreisförmig oder polygonal geöffnet sein, so daß der Blick in eine bekrönende Laterne gelenkt wird.
Labrum (lat.). Großes, flaches Becken im Heißbad für kaltes Wasser.
Labyrinth (griech.). Die von Daidalos auf Kreta erbaute Wohnung des Minotauros.
Laibung (auch Leibung) bezeichnet die Wandungen des Mauereinschnitts von Tür oder Fenster. Über die Unterscheidung von »Gewände« s. d.
Lambrequin. Gelappter Behang am oberen Abschluß eines Betthimmels bzw. Fensters oder als seitliche Rahmung eines Baldachins. Die Kunst des Barock überträgt das Motiv — geschnitzt, stuckiert oder sogar in Stein ausgeführt — in die Architektur.
Laren (lat.). Schutzgötter des röm. Hauses, Lararium ihr Schrein in einem röm. Haus.
Laterne (lat. laterna). Rundes oder polygonales zierliches Türmchen, das mit Fenstern oder Öffnungen versehen ist und auf dem Scheitel einer Kuppel sitzt, einen Dachreiter bekrönt oder, bei Welschen Hauben sowie Zwiebelhelmen, als Zwischenglied erscheint.
Laufgang. Gang, der entweder durch einen Mauerrücksprung entsteht oder aber in einer Mauer geführt ist. Laufgänge finden sich häufig an der Basis von Fensterhochwänden‚ bes. in den normannischen und rheinischen Bauten des 11.-13. Jh. sowie in den reich gegliederten Werken der reifen Gotik des 13. Jh.
Leibung => Laibung.
Lekythos (griech.). Ölkanne mit engem Hals, trichterförmiger Mündung und abgesetztem Fuß.
Lettner (Lectorium). Scheidewand als Chorschranke zwischen Chor und Mittelschiff mit einer Lese- und Sängerbühne.
Levitensitz. In got. Zeit anfänglich Nische in der Chormauer für den Priester und seine beiden Diakone, später aus Holz gearbeitet, oft in Zusammenhang mit dem Chorgestühl.
Lisene. Senkrechter flacher Mauerstreifen ohne Basis und Kapitell.
Loggia. Von Pfeilern oder Säulen getragene, meist überwölbte Bogenhalle, die freistehen oder Gebäuden vorgesetzt sein kann.
Dann oft mehrgeschossig als Zugangskorridor für die Räume angelegt.
Lukarne (frz.). Dachfenster.
Lünette (frz.). Halbkreisförmig oder von einem Kreissegmentbogen begrenztes Feld über Türen und Fenstern, oft mit Malerei oder Reliefschmuck ausgefüllt.
Lupanar (lat.) Bordell.
Manierismus. Künstlerische Strömung, die die »klassische« Form einer natürlichen Gesetzlichkeit hinter der betonten »Künstlichkeit«, der »Manier«, zurückstellt. Sie läuft neben den Formprinzipien der Spätrenaissance und des Frühbarock her. Zeitliche Eingrenzung etwa 1530-1600.
Mansarde => Dach.
Maßwerk. Das geometrisch »gemessene« Bauornament der Gotik, v. a. entwickelt für die Füllung der oberen Bogenzone in den großen, durch Pfosten unterteilten Fensteröffnungen.
Maureske. Aus der islamischen Kunst hervorgegangenes reines Flächenornament mit streng stilisierten Blättern und Blüten. Ein beliebtes Motiv der Renaissance.
Mausoleum. Grabgebäude, so genannt nach jenem, das die Gemahlin des Königs Mausolos von Karien für ihren Gatten (gest. 352 v. Chr.) in Halikarnass errichten ließ.
Mensa (lat. = Tisch). Platte des Altartisches.
Metope => Triglyphe.
Mezzanin (it.). Zwischen- oder Halbgeschoß. Niedriges Stockwerk, das zwischen Erdgeschoß und 1. 0bergeschoß, zuweilen auch unmittelbar unter der Traufkante des Daches erscheint. Seit der Renaissance bekannt.
Miserikordie. Kleine Konsole auf der Unterseite der hochklappbaren Sitze eines Chorgestühls. Sie erlaubt bei langem Stehen ein Stützen des Körpers.
Monopteros (griech.). Baldachinartiger Säulenrundbau ohne Cella.
Muldengewölbe => Gewölbe.
Nebris (griech.). Rehkalbfell, gehört zur charakteristischen Tracht des Dionysos und der Mänaden.
Netzgewölbe => Gewölbe.
Niello. Schwarze Zeichnung in Edelmetall. Sie wird eingraviert, die Ritzung mit der N.-Masse (Silber, Kupfer, Blei, Schwefel, Borax) gefüllt und die Metallfläche dann poliert.
Nonnenempore. Meist auf Gewölben ruhendes Obergeschoß, urspr. an der W-Seite in den Kirchen von Frauenklöstern, um den Nonnen einen abgesonderten Raum für Gottesdienst und Chorgebet zu gewähren, wo sie für die übrigen Kirchenbesucher unsichtbar bleiben. Daher mit eigenem Altar, Chorgestühl und Andachtsbildern ausgestattet. Später rückt die N. mehr in die Nähe des Altarraums, oft an eine Seite des Kirchenlang- oder -querhauses.
Nymphäum. Privater oder öffentlicher Prunkbrunnen vor einer Wand, oft als Nische mit Mosaik ausgelegt, in Gärten und Villen.
Obelisk. Hoher rechteckiger, nach oben sich verjüngender Steinpfeiler, der mit pyramidenförmiger Spitze endet. Der im alten Ägypten als Kultsymbol dienende O. war in der Renaissance ein beliebtes Zierglied der Architektur und des Kunsthandwerks.
Oculus (lat. = Auge). Rundfenster, auch Ochsenauge genannt.
Oecus corinthius (lat. : korinthisches Zimmer). Repräsentativer Saal mit eingestellten Säulen.
Omphalos (griech.). Nabel, ein eiförmiger, dem Apollon heiliger Stein in Delphi.
Opus graticium (lat.). Fachwerk.
Opus reticulatum (lat.). Netzwerk, Mauerwerk aus kleinen, quadratischen Steinen, die schräggestellt ein Netzmuster ergeben.
Oscillum (lat.). Runde, flache, vom Gebälk herabhängende Marmorscheibe, auf beiden Seiten mit Relief versehen.
Ostium (lat.). Haustür.
Palästra (griech.). Urspr. Ringplatz, dann allgemein jede größere Sportanlage, seit dem 4. Jh. v. Chr. gleichbedeutend mit Gymnasium, bezeichnet v. a. den Peristylhof.
Palladion (griech.). Kultbild der Athene in altertümlicher Darstellung mit Schild und erhobener Lanze — v. a. des Athenetempels in Troja, wo es den Bestand der Stadt garantiert und deshalb von Odysseus und Diomedes geraubt wird.
Palmette. Ornamentform, bei der um eine betonte Mittelsenkrechte fächerförmig sich auseinanderlegende Blätter flächig geordnet sind. Am weitesten in der Antike verbreitet.
Papyrus (griech.). Schreibstoff der Antike, aus dem Mark der Papyrusstaude durch das Aneinanderkleben feiner, senkrecht zueinander verlaufender Streifen.
Paradies => Atrium.
Parament. Bezeichnung für kirchliche Bekleidungsstücke, z.B. für die des Priesters, des Altars oder der Kanzel. Für die verschiedenen kirchlichen Feiertage ist die Farbe der Paramente jeweils vorgeschrieben.
Paraskenien (griech.). Seitliche Bühnenabschlüsse im griech. Theater.
Parlatorium. Sprechraum in Klöstern.
Paß. Das Wort P. ist gleichbedeutend mit Zirkel. Die aus Dreiviertelkreisen zusammengefügte Maßwerkfigur wird daher P. genannt. Nach Anzahl der Kreisstücke unterscheidet man den Dreip., bei dem die Mittelpunkte der Kreisteile die Spitzen eines gleichseitigen Dreiecks bilden, den Vierp., bei dem diese Mittelpunkte die Ecken eines Quadrats bestimmen, den Fünfp. usw.
Pavillon. Im urspr. Sinne des Wortes ein großes Rechteckzelt, dann auf kleine Gartenhäuser über zentralem Grundriß übertragen. Im barocken Profanbau werden auch die in der Fassadenmitte
oder an den Ecken hervortretenden und im Dach mehr oder minder stark betonten Teile eines Gebäudes als P. bezeichnet.
Penaten (lat.). Schutzgötter, die im Inneren des röm. Hauses wohnen, beschützen die Wohnstätte der Familie.
Pendentifkuppel => Kuppel.
Peplos (griech.). Das Gewand der griech. Frau, aus Wolltuch, besteht aus einer Tuchbahn, die mit Stecknadeln, Fibeln, über den Schultern festgesteckt wird, hat weder Naht noch Ärmel und wird gegurtet.
Peristyl (griech.). Einen Hof umgebende Säulenhalle.
Pietà, Vesperbild. Darstellung Mariae mit dem Leichnam Christi auf dem Schoß, seit dem späten 13. Jh. vorkommend, dann bes. im 14. und 15. Jh., aber auch noch in der Barockskulptur häufig.
Pilaster. Flacher Wandpfeiler mit Basis und Kapitell, antiker Abkunft.
Piscina. 1. Taufbecken in einem Baptisterium. — 2. Kleine Nische in der S-Wand des Chors mit einem Ablauf für das Wasser, das der Priester bei der Messe zum Waschen der liturgischen Gefäße und der Hände benützt.
Plektron (griech.). Plättchen zum Anschlagen der Saiten eines Musikinstruments.
Polsterquader => Quader.
Polygon (griech.), Vieleck. Polygonale Chorschluß-Konstruktionen der Gotik aus Sechs-, Acht-, Neun-, Zehn- oder Zwölfeck.
Pomerium (lat.). Sakrale und politische Grenze der röm. Stadt, die nicht mit der tatsächlichen Grenze übereinstimmen muß.
Portikus (lat.). Säulenhalle. Der von Säulen oder Pfeilern getragene Vorbau eines Gebäudes an der mit dem Haupteingang versehenen Fassade. Nach dem Vorbild der klassischen Antike und meist unter Anwendung der Säulenordnungen seit der Renaissance vielfach üblich.
Predella (auch Sarg oder Staffel). Untersatz eines got. oder Renaissance-Altarschreines oder -Altarbildes.
Presbyterium. Chorraum, urspr. mit den Sitzen für die Geistlichen und Presbyter.
Prostylos. Tempel mit einer Säulenreihe an der Front.
Prothyron (griech.). Bei den Römern die Einfriedung vor der Tür.
Pseudobasilika. Basilikaler Kirchenraum, der in der Hochwand des Mittelschiffs keine Fenster hat und das Licht, gleich der Hallenkirche, allein aus den Fenstern der Seitenschiffwände erhält. Die Hochwand des Mittelschiffs ist in voller Höhe errichtet und meist mit Blendfenstern versehen. Zu unterscheiden von der Staffelkirche (vgl. Hallenkirche).
Puteal (lat.). Brunneneinfassung aus Marmor.
Putto, Putti (it. = Knäblein). Nackte kleine Knaben, meist mit Flügeln. Letztlich auf die antiken Eroten zurückgehend, ist der
Putto eine in der it. Frührenaissance vorgenommene Umformung got. Engelskinder. Weiteste Verbreitung in der Kunst des Barock.
Quader. Der in der Ansichtsfläche des Mauerwerks nur mit einem Randschlag versehene Steinblock wird Bossenqu. (Buckelqu.) und ein derartiges Mauerwerk Rustika genannt. Ähnelt die Ansichtsfläche des Qu. einem geschliffenen Diamanten, so spricht man vom Diamantqu., bei polsterähnlicher Ansichtsfläche von einem Polsterqu. Bei den Bauten der Weserrenaissance treten derartige Qu.-Formen aus ornamentalen Gründen oft vereinzelt oder schichtweise in Erscheinung. Allgemein werden seit der Renaissance Bossen-, Diamant- und Polsterqu. für das Mauerwerk der Sockelzone bei Gebäuden und durchgehend bei Befestigungswerken verwendet.
Quaderung. Nachahmung von Quadermauerwerk durch Putz mit eingeritzten oder gemalten Fugen.
Querhaus, Querschiff. Rechtwinklig zum Langhaus angelegter Querraum, der das Schiff vom. Chor trennt. Meist 1-‚ in großen Anlagen auch 3schiffig.
Radialkapelle. Chorkapelle, die zusammen mit anderen einen Kapellenkranz um den Chorumgang bildet.
Refektorium. Speisesaal der Mönche, meist der Klosterkirche gegenüber am Kreuzgang gelegen als paralleler Raum zum Kreuzgangflügel oder häufiger senkrecht zu ihm. Dem Eingang in das R. gegenüber, in den Hof vorspringend, in der Regel die Brunnenkapelle zum Waschen der Hände.
Régence. Stilphase des Barock, in Deutschland etwa 1715-40, örtlich darüber hinaus, benannt nach der Regentschaft während der Unmündigkeit Ludwigs XV. von Frankreich (1715-23). Ihr beliebtes Stilprinzip ist die 4seitige Symmetrie entlang einer Längs- und einer Querachse.
Reliquien (lat. relinquere : zurücklassen). Behälter zur Aufbewahrung der Überreste (Reliquien) eines Heiligen oder für die seinem Andenken geweihten Gegenstände, um diese den Gläubigen zur Verehrung zu zeigen oder auf dem Altar auszustellen. Die Form des R. wird durch Art und Umfang der Reliquien bestimmt. Neben Reliquienkästen und -büchsen sowie Medaillons sind figurierte Behälter, z.B. Statuetten, Büsten, Arm-, Fuß- und Finger-R., weit verbreitet. Außerdem wurden R. Architekturen nachgeformt, wie z. B. das Kuppel-R. im Welfenschatz um 1175 nach einer byzantinischen Kreuzkuppelkirche. Haupttyp ist jedoch der Reliquienschrein, der meist in Haus oder Basilikaform die äußere Hülle des Reliquiensarges bildet und zu den bedeutendsten Leistungen mittelalterl. Goldschmiede- und Emailkunst gehört.
Retabel (lat. : Rückwand). Altaraufsatz — nicht vor dem 11. Jh. nachweisbar — mit gemalten oder geschnitzten Bildern, seltener auch der Schrein mit den Gebeinen eines Heiligen.
Rippe => Gewölbe.
Risalit (it. risalto = Vorsprung). Ein aus der Hauptfluchtlinie eines Baues in dessen ganzer Höhe hervortretender Gebäudeteil, der die Symmetrie des Baues nicht aufheben darf.
Rocaille (frz. = Muschel). Sprühendes, leicht schwingendes und anschmiegendes Dekorationselement von muschelähnlicher Struktur. In Frankreich erfundene Leitform des R.-Ornaments, das zwischen 1730 und 1770 (Rokoko), örtlich noch wesentlich länger verbreitet war.
Rundbogenfries. Fries aus glatten oder ornamentierten kleinen Halbrundbogen. Der R. begleitet die teilenden oder abschließenden Gesimse roman. Wände.
Rustika => Quader.
Saalkirche. 1schiffige Kirche.
Sacellum (lat.). Kleines Heiligtum, kleine Kapelle.
Sakramentshäuschen => Tabernakel.
Satteldach => Dach.
Satyr, Silen (griech.). Menschengestaltige Wesen mit Pferdeschwanz und -ohren, oft auch -hufen, die zum mythischen Gefolge des Dionysos gehören.
Säulenordnungen. Die griechische Baukunst kennt 3 verschiedene Säulen- und Gebälksysteme, die für die rhythmische Gliederung ihrer Tempelbauten maßgebend sind: die dorische, ionische und korinthische Ordnung. Am Anfang steht die dorische Ordnung, deren Säule einen kannelierten Schaft ohne Basis und ein wulstförmiges Kapitell mit quadratischer Deckplatte (Abakus) aufweist. Das Gebälk besteht aus glattem Steinbalken (Architrav), darüber der Fries im Wechsel von 3schlitzigen Platten (Triglyphen) mit meist reliefierten Metopen und abschließend das profilierte Kranzgesims mit der Traufleiste. — Bei der ionischen Ordnung weist die Säule eine aus mehreren Einzelgliedern zusammengesetzte Basis und am Schaft durch Stege getrennte Kanneluren auf. Das Kapitell hat als Hauptmerkmal 2 ausladende Schnecken (Voluten). Der Architrav ist in 3 horizontale Streifen unterschnitten und darüber ein durchgehender Relieffries angeordnet. — Die korinthische Ordnung, weitgehend der ionischen verwandt, zeigt ein Kapitell, das aus 2 Reihen gegeneinander versetzter und nach vorn umgeklappter Akanthusblätter besteht. Diese 3 S. haben in röm. Zeit verschiedene Umbildungen erfahren. — Durch Aufpfropfung des ionischen Kapitells auf das korinthische ist das zusammengesetzte sog. Kompositkapitell entstanden. — Die dorische Säule wurde durch Hinzufügen einer Basis sowie eines Halsrings und Wegfall der Kanneluren am Schaft zur toskanischen. — Die S. sind durch ihre wohlabgewogenen und nach strenger Regel festgelegten Maßverhältnisse ausgezeichnet und an keinen bestimmten Stil gebundene Ausdrucksformen, sondern unterscheidende Merkmale aller klassisch direkt oder indirekt beeinflußten Stilperioden.
Scagliola => Intarsia.
Schaftring => Wirtel.
Schallarkade => Klangarkade.
Scheidbogen. Der ein Joch des Mittelschiffs vom entsprechenden Joch des Seitenschiffs trennende Bogen.
Segmentbogen => Bogen.
Sistrum (lat.). Bronzeklapper; für den Isis-Kult typisches Instrument.
Sohlbank. Die waagerechte untere Begrenzung einer Fensteröffnung, die deren Gewände trägt.
Sphinx (griech.). Mischwesen mit Löwenleib und Menschenkopf.
Spiegelgewölbe => Gewölbe.
Spolie (lat. spolia = Beute). Werkstück eines Baues (z. B. Säule), das für einen älteren Bau geschaffen wurde.
Sprengwerk => Gesprenge.
Staffel => Predella.
Staffelkirche => Hallenkirche.
Stamnos (griech.). Weingefäß mit kurzem Hals und horizontalen Henkeln an der Schulter.
Steinmetzzeichen. Arbeits- und Ehrenzeichen des Steinmetzen, das an den fertigen Werkstücken angebracht wurde, um den Urheber zu kennzeichnen. St. sind seit dem frühen 12. Jh. nachweisbar. Sie waren urspr. vom Steinmetzen nicht individuell und einmalig gewählt, sondern in allen Hütten gleichzeitig benutzte Typen. Mit der Auflösung der letzten Reste mittelalterl. Bauhüttentradition und des Zunftwesens im 18. Jh. verschwanden sie.
Stele (griech.). Freistehender Pfeiler, als Grabstein häufig mit einem Relief versehen.
Sterngewölbe => Gewölbe.
Stichbogen. Bogenform, bei der ein Kreissegment auf 2 Senkrechten aufsitzt. Häufig im Barock; in der Spätgotik oft bei den inneren Fensterlaibungen.
Stichkappentonne => Gewölbe.
Stipes (lat. : starker Pfahl, Klotz). Blockförmiger Unterbau des Altars, der die Mensa trägt. Der St. umschließt Reliquien.
Strebe. Im Fachwerk Schrägholz, das eine sichere Dreiecksverbindung zwischen Horizontaler und Vertikaler herstellt. Kleinere Streben heißen Bänder (Kopfband, wenn nach oben, Fußband, wenn nach unten gerichtet).
Strebewerk. Das System von Strebepfeilern und Strebebögen zur Abstützung von Wänden und Gewölben, wie es in der Gotik üblich ist.
Stuck. Masse aus Gips, Kalk und Sand, die in feuchtem Zustand leicht knetbar ist, aber schnell erhärtet. Stuckmarmor entsteht nach Beimischen von Pigmentfarben und Leim durch eine abschließende Polierung.
Stufenhalle => Hallenkirche.
Stutzbasilika => Hallenkirche.
Stützenwechsel. Der rhythmische Wechsel von Säule und Pfeiler (jambisch) oder von 2 Säulen und Pfeiler (daktylisch) bei den Mittelschiffwänden in der roman. Basilika.
Stutzkuppel => Kuppel.
Substruktion. Unterbau zum Ausgleich von Terrainunterschieden.
Suburbium (lat.). Vorstadt.
Supraporte. Das über einem Türsturz angebrachte Zierstück.
Syrinx (griech.). Hirteninstrument, auch des Flurgottes Pan, aus mehreren, verschieden langen und verschieden starken Pfeifen nebeneinander.
Tabernakel (lat. tabernaculum: Hütte, Zelt). 1. Aufbewahrungsort für Kelch und Hostie. — 2. Ziergehäuse (für Figuren), häufig von Säulen oder Pfeilern getragenes Spitzdach, z. B. an Strebepfeilern got. Kirchenbauten.
Tablinum (lat.). Repräsentativer Empfangsraum im röm. Haus, gegen das Atrium hin offen.
Tambourkuppel, Trommel => Kuppel.
Tauschierung. Verzierung unedler Metalle (z.B. Bronze) durch Einhämmern oder Einlegen von Gold und Silber.
Telamon (griech.). Gebälktragende Figur, pfeilerartig mit der Wand verbunden.
Tepidarium (lat.). Lauwarmer Raum im röm. Bad.
Terrakotta. Gebrannte Tonerde, die unglasiert anstelle von Stuck und als Material für Skulpturen verwendet wurde.
Thermen (griech.). Mehrräumige röm. Badeanlagen, öffentlich und in Privathäusern.
Thermopolium (griech.). Einfache Gastwirtschaft, in der ein Getränk aus Wein und heißem Wasser verkauft wurde.
Thiasos (griech.). Versammlung oder Vereinigung zu Ehren eines Gottes, Gefolge eines Gottes (v. a. bei Dionysos); Meerth.: Mischwesen im Gefolge des Poseidon.
Thyrsos (griech.). Ein langer mit Weinlaub oder Binden umwundener Stab, an der Spitze ein Efeubündel oder ein Pinienzapfen, Kennzeichen der Teilnehmer am Dionysos-Kult.
Tonnengewölbe => Gewölbe.
toskanisch => Säulenordnungen.
Tralje => Baluster.
Travée. Frz. Bezeichnung für das (meist querrechteckige) Joch.
Tribuna => Apsis.
Triclinium (griech.). Liegebank, auch 3 Bänke U-förmig aneinandergestellt im Freien unter einer Pergola oder in einem Raum. Auch dieser Raum selbst als Ort für gemeinsame Gelage und Festessen.
Triforium heißt der Laufgang in der Hochschiffwand got. Kirchen unterhalb der Fensterzone.
Triglyphe (griech. = Dreischlitz). Zierstück mit 3 durch Stege voneinander abgesetzten, senkrechten Rinnen; in der griech. Antike über dem Architrav — urspr. als Schutzplatte vor den Balken-
köpfen — im Wechsel mit den Metopen (Bildfeldern) verwendet, später ein reines Schmuckwerk.
Triumphbogen. Der Bogen, der den Chor vom Kirchenschiff trennt. Benannt nach der dort urspr. angebrachten Darstellung des über den Tod triumphierenden Erlösers.
Trompe (frz. : Jagdhorn). Bogen mit nischenartiger Wölbung zwischen 2 rechtwinklig zusammenstoßenden Mauern. Die Tr. dient bei Türmen und Kuppeln zur Überleitung des quadratischen Grundrisses ins Oktogon.
Tumba. Die T. besteht aus einem über dem. Grab sich erhebenden, rechteckigen und meist steinernen Unterbau, der die Grabplatte trägt. Auf dieser ist eine Inschrift, ein Wappen oder die Gestalt des Verstorbenen aus Stein oder Bronze dargestellt.
Tumulus (lat.). Runder Grabhügel.
Tympanon. 1. Die das Bogenfeld des Portals füllende Steinplatte, häufig mit ornamentalem oder figürlichem Relief geschmückt. — 2. Rundes Schlaginstrument von Mänaden, Attribut der Kybele.
Verkröpfung. Eine V. entsteht, wenn Gebälke oder Gesimse um Mauervorsprünge, Säulen oder Pfeiler herumgeführt werden.
Vesperbild s. Pietà.
Vierung. Meist quadratischer Raum einer größeren Kirchenanlage, der bei der Durchdringung von Langhaus und Querhaus entsteht (vgl. auch Gebundenes System).
Volute. Schneckenförmig gewundene Verzierung an Baugliedern und Möbeln. Urspr. Teil des ionischen Kapitells der griech. Architektur.
Vorhangbogen. In der Spätgotik beliebter Abschluß von Fenstern mit einer Folge girlandenartig hängender Bogen.
Voute (frz.). Meist im Viertelkreisbogen verlaufende Ausrundung zwischen Wand und Decke bei Innenräumen.
Walmdach => Dach.
Wandpfeilerkirche. Durch Versetzen der Außenwände bei einer got. Hallenkirche, seltener bei einer Basilika, in die Flucht der Stirnseiten der Strebepfeiler entstehen innen parallel zu den Seitenschiffen zwischen den Strebepfeilern kapellenartige Nischen. Dieser Raumtyp wird in der Renaissance beibehalten und im Barock im Sinne der Vereinheitlichung des Raumgefüges weiterentwickelt, so daß die Wandpfeiler kulissenartig das 1schiffige Langhaus flankieren.
Wasserschlag. Pultförmige Schräge an Gesimsen und sonstigen Vorsprüngen zur Ableitung des Regenwassers mit gekehlter Wassernase an der Unterseite, an der das Wasser abtropft, ohne die Mauer zu durchnässen.
Weicher Stil. Stilstufe der Spätgotik zwischen 1390 und 1430, charakterisiert durch die zierlich-holde Empfindsamkeit der »Schönen Madonnen« oder die Frühwerke Fra Angelicos da Fiesole.
Westwerk. Turmartiger, den frühen, bedeutenderen Kirchenbauten des Mittelalters vorgelegter Westbau, der im Untergeschoß als
Durchgangshalle zur Kirche dient, im Obergeschoß eine nach innen geöffnete Kapelle oder Empore mit Seitenräumen aufnimmt. Die Bedeutung des W. ist nicht ganz geklärt, seine Verwendung als Kaisersitz, Taufkapelle und Pfarrkirche ist nachgewiesen.
Wimperg. Got. Ziergiebel über Portalen und Fenstern, meist aus Maßwerk zusammengesetzt.
Wirtel. Steinerner Ring, der sich um die Mitte des Säulenschaftes legt, daher auch als Schaftring bezeichnet. Bereits seit frühroman. Zeit nachweisbar.
Zellenschmelz => Email.
Zeltdach => Dach.
Zentralbau. Im Gegensatz zum Langbau der Basilika der Bau mit einem oder mehreren um einen Punkt zentrierten Räumen über rundem, ovalem oder polygonalem Grundriß. Nach der Basilika ist der Z. die wichtigste Form des christl. Kultbaus.
Ziborium => Ciborium.
Zwerggalerie, Zwerchgalerie. In Säulenarkaden geöffneter, mit einer Längstonne oder mit Quertonnen gewölbter Laufgang, der unterhalb des Dachansatzes in die Mauer gelegt ist. In der Romanik sehr häufiges Gliederungsmotiv V. a. an Apsiden, doch gelegentlich auch auf Chortürme, Querhäuser oder Langhauswände ausgedehnt.
In der Reihenfolge des Textes. T = Bildtafel
Wegen der Fülle der Objekte können nicht alle Monumente in den beiden Plänen eigens verzeichnet werden; in diesen Fällen dient die Angabe des Planquadrats lediglich als Orientierungshilfe.
Beispiele:
8E;4-5G;10AB = Planquadrate auf dem Übersichtsplan am Beginn des Bandes
VIIIe; IV-Vg; Xab = Planquadrate auf dem Faltplan Altstadt am Schluß des Bandes